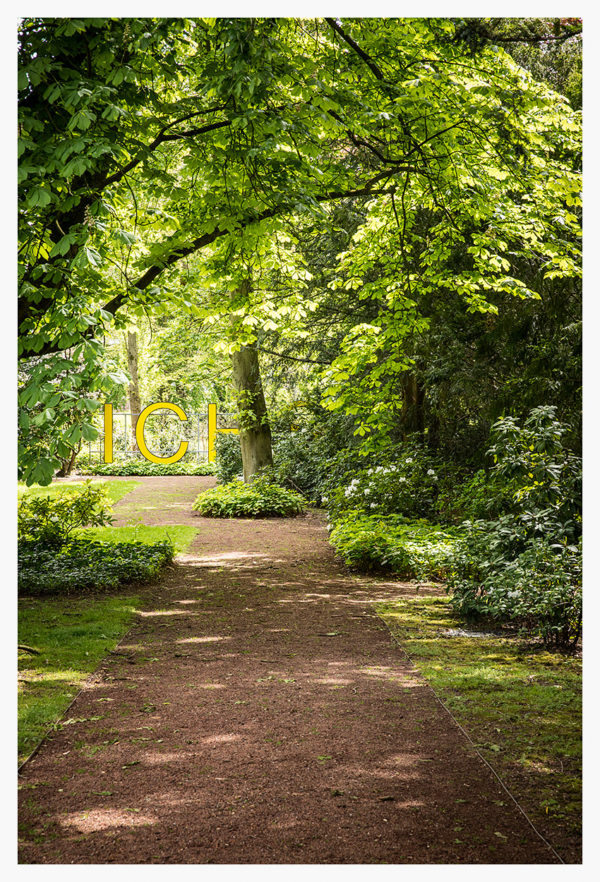Der Satz aus einer der zahlreichen Broschüren des European Centre for Creative Economy (ECCE) birst vor Anspruch: »Die Kreativ.Quartiere Ruhr wollen also ein Modell in Europa sein für eine kulturell-ökonomische Form der Stadtentwicklung«. Und dann steht man an einem Samstagmittag in Gelsenkirchen-Ückendorf auf der Bochumer Straße, mitten in einem der fabulösen Kreativquartiere, die Modell für Städte auf dem ganzen Kontinent werden soll: Die Döner-Läden haben geschlossen, im Tipco-Wettbüro hat schon vor Monaten der Letzte das Licht ausgemacht, und auch das Quartiersbüro der Stadt Gelsenkirchen, dessen Schaufensterplakate »Frei-Räume«, »Möglichkeits.Räume« und »Kreativ.Räume« versprechen, ist schon lange verwaist. Ebenfalls das Museum der geborgten Dinge, ein Projekt von über 50 Studenten der Amsterdamer Rietveld Akademie, hat längst geschlossen.
In Städten wie Berlin, Frankfurt oder Köln befänden sich in einer ähnlichen Straße Galerien, Cafés und Buchhandlungen. Die Bochumer Straße ist dabei nicht einmal unattraktiv. Migrantisch geprägt, strahlt sie selbst an einem kalten Frühlingstag mediterranes Lebensgefühl aus: Menschen stehen herum, rauchen, trinken Tee, unterhalten sich. Viele leerstehende Ladenlokale und Wohnungen nahe der Gelsenkirchener Innenstadt und dem Hauptbahnhof bieten viel Platz für Kreative jeder Art, mit mehr Ideen als Geld. Doch man sieht sie nicht.
Euphorie in Essen – im Herbst 2009
Dabei hatte alles mit viel Euphorie angefangen. Im Herbst 2009 sollte von der Zeche Zollverein ein Aufbruchsignal ausgehen. Der Initiativkreis Ruhr hatte zur Konferenz geladen, und neben Bundeskanzlerin Angela Merkel war auch der Hohepriester des Begriffs Kreativwirtschaft nach Essen gekommen. Der US-Soziologe Richard Florida hatte in seinem Buch »The Rise of the Creative Class« den Begriff der kreativen Klasse geprägt und zu Popularität verholfen. Auf Zollverein hielt er eine leicht aufs Ruhrgebiet angepasste Variante seiner damaligen Standardrede. Er erzählte vom Niedergang der Industrie in New Jersey, wo er aufgewachsen war, wie Pittsburgh, das US-Gegenstück des Ruhrgebiets, den wirtschaftlichen Anschluss immer mehr verlor, obwohl es in Museen und Orchester investiert hatte; die jungen Kreativen hätten die Stadt verlassen und wären woanders hin gezogen. Die Macher von Lycos, einer einstmals bekannten Suchmaschine, nach Boston zum Beispiel. Und mit ihnen Jobs für Grafiker und Programmierer. Nach Boston wären sie gezogen, weil die Stadt spannender als Pittsburgh gewesen sei. Die Clubs, die Galerien, all das hätte ein Umfeld geboten, spannender als das biedere Pittsburgh.
Die Lehre für das Ruhrgebiet war klar: Will man sich, nach Jahrzehnten des Abstiegs, als Standort neu erfinden, mussten Kreativquartiere aufgebaut werden, um den Mitarbeitern der Boom-Branchen ein attraktives Umfeld zu bieten, nur dann kämen sie ins Revier. Städte und Investoren träumten zudem davon, dass Kreative die Immobilienwerte steigern würden. Gentrifizierung sollte endlich auch im Ruhrgebiet stattfinden, heruntergekommene Quartiere zu neuen Prenzlauer Bergen werden. Das NRW-Wirtschaftsministerium befeuerte dieses Denken noch. »Kreativwirtschaft ist ein Immobilienthema«, so damals die im öffentlichen Dienst beschäftigten Experten für die freie Wirtschaft in Düsseldorf. Alle beriefen sich auf Richard Florida, jeder Unfug, jede Sprechblase wurde mit einem Verweis auf sein Buch begründet. Was weder das Buch noch sein Autor verdient hatten, denn die meisten, die sich darauf bezogen, hatten »The Rise of the Creative Class« nie in der Hand gehabt. Jedenfalls nicht gelesen.
Über das Kulturhauptstadt-Jahr hinaus
Florida beschrieb nicht nur die Bedeutung der Kreativwirtschaft für die wirtschaftliche Entwicklung. Er zeigte auf, dass Investitionen in die klassische Kultur nicht die gewünschten Effekte haben, hält Toleranz gegenüber Minderheiten wie Homosexuellen und Migranten für einen wichtigen Standortfaktor – was im Ruhrgebiet von den Epigonen nie erwähnt wurde – und sorgt sich um die geringen Einkommen in der Kreativbranche. Für ihn eine dringend zu lösende soziale Frage. Auch dieses Thema wurde im Ruhrgebiet nicht registriert, obwohl es im Buch deutlich steht.
Sechs Jahre nach Floridas Rede auf Zollverein und fünf Jahre nach Beginn der Kulturhauptstadt ist die Euphorie verflogen. Dieter Gorny, heute ECCE-Chef und damals der für Kreativwirtschaft zuständige Kulturhauptstadt-Direktor, sagte 2009 vollmundig: »Wir müssen mit den Kreativ-Quartieren eine Entwicklung anstoßen, die auch nach dem Kulturhauptstadtjahr anhält. Also sollen auch nach 2010 Leute in die Metropole Ruhr einziehen und die Mieten bezahlen können. Die durch Schrumpfung und Abwanderung gebeutelte Region soll durch den Zuzug kreativer Unternehmen neue Perspektiven bekommen.«
Heute klingt das etwas bescheidener: »Die Idee des Kreativquartiers ist eine prozessuale, urbane Entwicklung durch Kultur – kein Businesspark, keine Sonderwirtschaftszone und keine klassische Wirtschafts- oder Gründerförderung, die sich zum Beispiel durch Arbeitsplatzzahlen messen ließe.« Wäre das so deutlich undeutlich 2009 gesagt worden, ECCE wäre womöglich nicht gegründet und über Jahre mit Millionenbeträgen gefördert worden.
Nicht alles ist gescheitert
Auch mit den damaligen Kulturhauptstadtplänen mag man nichts mehr zu tun haben. Auf die Frage nach dem Erfolg der Kreativquartiere fünf Jahre nach ihrem Start sagt ECCE: »Das Förderprogramm existiert seit drei Jahren. Die Entwicklung der Kreativ.Quartiere liegt zum Großteil bei denen, die das Quartier ›machen‹ – die Städte in Kooperation mit den Künstlern, Kulturschaffenden und Kreativen im Quartier.« Die Entwicklung ist sehr unterschiedlich. Nicht alles ist gescheitert, es gibt Quartiere, die sich durchaus sehen lassen können und andere, über die man lieber schweigt. Kreativquartiere gibt es derzeit in Bochum, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen,
Herne, Herten, Mülheim, Oberhausen und Witten. Einige können heute bestehen. Vor allem diejenigen, bei denen wie in Bochum, Essen oder Dortmund an gewachsene Strukturen angeknüpft werden konnte. Im Umfeld des Bermudadreiecks Bochum gab es schon seit den 1980er Jahren Verlage, Agenturen, Galerien und eine das Viertel prägende Gastronomie- und Veranstaltungsszene. Dass es nun Viktoriaquartier heißt und ausgeweitet wurde, tat dem keinen Abbruch: Das Rottst5Theater, Zeichenschulen, das Veranstaltungszentrum Rotunde, neue Galerien und die Ansiedlung einer Design-Schule haben eine Entwicklung unterstützt, die in den 1970er Jahren begann und deren Hauptmerkmal es war, dass die Initiatoren nicht staatlich gefördert wurden.
Das Unperfekthaus als Anfang
In Essen war es ECCE, das bei der Entwicklung der nördlichen Innenstadt half, Kontakte zur Stadtverwaltung herstellte und immer wieder vermittelte. Lange bevor das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt wurde, wurde die Gegend mit der Eröffnung des Unperfekthauses durch den IT-Unternehmer Reinhard Wiesemann in Gang gesetzt, der heute noch Impresario des Stadtteils ist und mit weiteren Projekten wie dem Genera-tionenkult-Haus und dem Café Konsumreform den Prozess vorantreibt. Doch auch Wiesemann musste 2004 mit dem Unperfekthaus nicht bei Null anfangen. In der nördlichen Innenstadt gab es immer schon Kneipen, in denen Bands auftraten, kleine Galerien und Undergroundmode. Die Nähe zur Universität und die günstigen Mieten in dem gewohnt etwas rotlichtigen Viertel boten dafür schon lange eine Grundlage.
In Dortmund hat sich das Kreativquartier an der Rheinischen Straße im Schatten des U-Turms gut entwickelt. Auch hier ist man von der Arbeit durch ECCE angetan: Die hätten sich, sagt Hans Gerd Nottenbohm, Vorsitzender des Vereins Rheinische Straße, »mit vielen Ideen eingebracht und waren ein wichtiger Gesprächspartner«. Rund um die Rheinische Straße, die die Dortmunder Mitte mit Dorstfeld verbindet, wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Altbauten renoviert. Es haben sich ebenfalls Kneipen und kleine Galerien angesiedelt; aber auch diese Impulse konnten an eine Tradition anknüpfen, die eng mit Nottenbohm verbunden ist. Er gehörte zu den Besetzern des längst legalen Union Gewerbehofs, auf dem sich auf 5000 Quadratmetern zahlreiche Unternehmen, auch aus dem Bereich der Kreativwirtschaft ansiedelten. Der Union Gewerbehof sei auch heute eine treibende Kraft, so Nottenbohm: »Wir haben im vergangenen Jahr 1000 Quadratmeter von Hausbesitzern angemietet, die sich schwer taten, ihre Flächen zu vermarkten. Die sind bald alle vermarktet, und dann gehen wir an die nächsten 1000 Quadratmeter«.
Das Herzstück: ein Marmeladenladen
Neben den drei positiven Beispielen gibt es noch kleine Initiativen, die Mut beweisen. In Duisburg-Rheinhausen und im Wittener Wiesenviertel engagieren sich Quartiersmanager, die bereit sind, die dicken Bretter zu bohren, die bescheidene Erfolge vorweisen, aber auch, besonders in Duisburg, Rückschläge verkraften müssen. Andere Kommunen wie Herten oder Herne haben Kreativquartiere ausgewiesen, die den Namen kaum verdienen. In Herten ist das Herzstück der »prozessualen, urbanen Entwicklung durch Kultur« ein Marmeladenladen. Ohne Zweifel ist das Verkochen von Früchten zu Brotaufstrich ein achtbares Gewerbe, aber Antrieb für städtischen Fortschritt wird davon wohl nicht zu erwarten sein.
Die Kreativquartiere im Ruhrgebiet waren eine Kopfgeburt, der Versuch, an Tendenzen in Städten wie New York oder London anzuknüpfen und somit Teil der Metropolen-Simulation – die Nuller-Jahre im Ruhrgebiet. Die anfangs versprochenen wirtschaftlichen Entwicklungen sind nirgends eingetreten. Dort, wo die Idee der Kreativquartiere ohne Bezug zur Wirklichkeit – und ohne Anschluss an Vorhandenes – in Rathäusern aufgegriffen wurde, geschah nichts außer der Verschwendung von Fördermitteln.