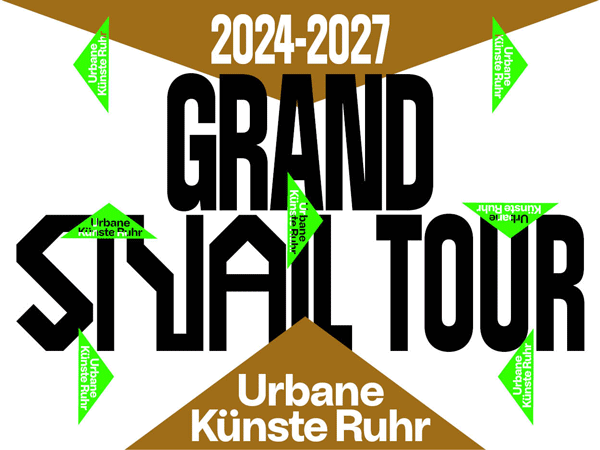Der junge Regisseur Florian Fischer inszeniert am Schauspielhaus Bochum Hervé Guiberts Roman »Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat«. Ein Gespräch über Aids und die Pandemie, das Sinnliche und das Sterben, Identität und Solidarität.
kultur.west: Als wir uns per Zufall an den Münchner Kammerspielen kennenlernten, Anfang 2016, warst Du Regiestudent an der Falckenberg-Schule und hattest im Rahmen des Studiums bei Johan Simons in Jelineks »Winterreise« hospitiert. Und Du hast, – ich möchte nicht sagen nebenher –, exquisit gekocht.
FISCHER: Immer dienstags. Wir nannten es »Kantine«. In unserer Wohnung gab es drei Gänge mit Wein für zehn Euro. Auf der Menükarte: Innereien, um das Geschmacksrepertoire zu erweitern. Einen Tag pro Woche konnte ich so aus meinem Kopf heraus, obwohl Kochen ja kein bloß handwerklicher Vorgang ist. Mir ging es um Gastgeberschaft. Tut es noch, auch im Theater, dass die Leute im Zuschauerraum sich gemeint und zuhause fühlen. Das hat für mich zu tun mit der Ausbildung der Sinne gemäß Friedrich Schiller. Theater ist doch, oder sollte sein, ein sinnliches Medium.
kultur.west: Um noch Deine Biografie zu streifen, die etwas Globetrotterhaftes hat…
FISCHER: Ich hatte Angst vor Heimweh nach München und fragte mich, wie löse ich das Problem. Indem ich das Zuhause auflöse, war meine Antwort. Mein Besitz war in einem Aluminiumkoffer von Rimowa verstaut, und ich hatte, zwischen Palermo und Stockholm, mehr als 30 Gastzimmer, die ich in der Zeit wechselnd bewohnte. Wieder Gastgeberschaft, nun als Empfänger.
kultur.west: Und in dem mobilen Betrieb Theater, wie lief es da für Dich?
FISCHER: Johan Simons ist für mich sehr wichtig gewesen – und geblieben, ich war bei einer Ruhrtriennale-Produktion, Luigi Nonos »Prometeo«, dabei, habe in Gent inszeniert, in Basel, Mannheim, Wien und bei Karin Beier am Schauspielhaus Hamburg.
kultur.west: Keine Klassiker. Nicht das, was zum Kanon gehört.
FISCHER: Mich interessiert, wie es gelingt, Stoffe – dabei von literarisch höchster Qualität, auch queere Literatur – und Themen in das Zentrum Stadttheater zu bringen und den Kanon zu erweitern. Um so Zentrum und Peripherie neu zu gewichten und zu verweben. Das andere ist, selbst zu schreiben und meine Texte zu inszenieren. Ich gehöre zu einem Postgraduierten-Kolleg der Universität Graz, genannt »Uni-T«, wo wir Autoren uns regelmäßig austauschen und die Texte im Wechsel einander vorstellen. In Hamburg hieß mein Projekt am Spielort Veddel »Monte Mortale«, übrigens erstmalig in strengem Versmaß verfasst, das sich mit einem dortigen Giftmüllskandal der 50er Jahre beschäftigte und das Spannungsfeld Vergiftung – Reinheit aufzog.
kultur.west: Ein Stichwort auch für Hervé Guibert und seinen Roman »Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat«, den Du in Deiner Bühnenfassung in Bochum uraufführst. Das erste Mal, dass das Buch aufs Theater kommt. Bei seinem Erscheinen 1990 in Frankreich fand es ungeheure Aufmerksamkeit, vergleichbar mit Edouard Louis heute. Das Krankheitsprotokoll eines jungen HIV-infizierten Künstlers und Freundes von Michel Foucault, der unter dem Pseudonym Muzil auftritt. In gewisser Weise hat Guiberts »Freund« wiederum mit einem früheren Projekt von Dir zu tun, der Rekonstruktion eines besonderen Todesfalls.
FISCHER: Die theatral gestaltete Chronik eines Mannes, der 28 Monate tot in seiner Brüsseler Wohnung lag und nicht vermisst worden war. Ich wollte an jemanden, den ich nicht gekannt habe, erinnern. Dafür habe ich mit einem Parfümeur zusammengearbeitet, der die Gerüche in dem Zimmer rekonstruiert und auch den Geruch des Mannes, der an Krebs erkrankt war, ‚nachgebaut’ hat. Wir wissen gar nicht mehr, wie der Tod riecht. Auch da war mir der sinnliche Aspekt wichtig. Die Aufklärung hat eine Hierarchie der Sinne vollzogen, den visuellen mit männlich gleichgesetzt, den Geschmacks- und Geruchssinn mit emotional und weiblich eng geführt. Das sollten wir überwinden.
kultur.west: Bei Guibert treffen sich mehrere existentielle Themen: die HIV-Infektion und wie die Öffentlichkeit damit umging um 1985/1990, indem sie den Außenseiter sozial, moralisch und erotisch stigmatisierte. Der Suizid, an dessen Folgen Guibert 1991 starb – er wurde 36 Jahre alt. Der Skandal, das Sterben von Foucault publik zu machen, der ebenfalls an Aids starb, obgleich offiziell an Krebs. Und das Leiden an einer Krankheit zum Tode, das sich im sprachlichen Akt seiner selbst bewusst wird, das gewissermaßen erzeugt wird in der Formulierung. Das Werk als »Exorzismus gegen die Ohnmacht«, wie Guibert schreibt.
FISCHER: Das Schreiben überlebt ihn. Guibert muss schreiben, um zu vergessen: sein Kranksein, das er zugleich extrem akribisch und krass mitteilt. Als würde er seinen Körper aufreißen vor uns. Total reflektiert, nie banal, nicht einfach nur ein Tagebuch. Das ist wie ein Geschenk, ein Angebot zur Teilhabe. So erscheint es überhaupt in seinen Arbeiten, vor allem den Fotografien in ihrer morbiden Lebensfeier. Radikal und dabei sanft in seiner Geste der Gabe und des Opfers. Um Provokation geht es überhaupt nicht, auch wenn Guibert alles andere als heteronormativ einzuordnen ist – auch mir nicht. Ich will niemanden befremden.
kultur.west: Lässt sich, zumindest indirekt, die Verbindung ziehen zwischen Aids und der Pandemie?Aids wurde mit Verunreinigung, Invasion und Infiltration, dem Fremden assoziiert. Wir sehen, wie anfällig dieser Komplex ist für Verschwörungstheorien, Wahngebilde, Feindbilder. Da ist man schnell bei Schuld oder der ästhetischen Brandmarkung durch körperliche Entstellung.
FISCHER: Fatal war eine Logik, die sich der Suche nach dem Ansteckungsherd hingab, das war rassistisch und homophob. Und um auf Peripherie und Zentrum zurückzukommen: Ohne die Aids-Forschung und die medizinischen Studien wäre es mit den mRNA-Impfstoffen nicht so weit gediehen. Hier die Schwulen am Rand und dort die Mitte der Mehrheitsgesellschaft – diese Separierung ist falsch. Eine gemeinsame Überschrift für Aids und die akute Pandemie wäre: Liebe in Zeiten von Krankheit. Da gibt es für einige bestimmt den Erinnerungsschock an Einsamkeit, Isolation, Angst vor Berührung. Dieser Kosmos interessiert mich. Vor allem der Aspekt der Intimität und die Formen von Identität.
kultur.west: Es ist das Soziale und das Sexuelle, das Guibert lebt und literarisch auslebt, indem er sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Susan Sontag schreibt, dass Aids zum Ausdruck einer »beschädigten Identität« geworden sei. Du würdest eher die Vielheit der Identitäten betonen wollen.
FISCHER: Guibert steht in Bezügen zu Menschen, die für ihn diverse Identitäts-Relationen bedeuten. Seine Identität verflüssigt sich, wie Foucault es vorgedacht hat. Welche Arten von Liebe gibt es: zunächst den Lebenspartner Stéphane, dann die Vaterfigur Foucault/ Muzil, den Arzt Dr. Chandi in seiner fürsorglichen Professionalität und den amerikanischen Freund Bill, ein hohes Tier in der Pharmaindustrie, der seine Position nutzt, um Abhängigkeit und Nähe zu schaffen.
kultur.west: Es gab damals nicht nur die männliche gay community. Wenn wir von Solidarität sprechen, dürfen wir die Frauen nicht ausblenden. Ich erinnere mich, dass es Schauspielerinnen gewesen sind, die um 1990 herum am Düsseldorfer Schauspielhaus drei junge Schauspieler gepflegt, beschützt, begleitet haben bis zum Tod.
FISCHER: Das ist mir ganz wichtig. Diese Lücke in der Geschichtsschreibung zu füllen und etwas zu korrigieren. Deshalb habe ich – neben William Cooper, Thomas Huber und Risto Kübar – Gina Haller unbedingt dabei haben wollen. Waren es doch eben vor allem Frauen, die sich um die Aids-Kranken kümmerten – die ‚Kranken-Schwestern’. Übrigens nicht selten blieben Blutsverwandte, die Eltern vor allem, ausgeschlossen.
kultur.west: In Extremsituationen wächst die Fähigkeit des Menschen, absolute Brüche mit absoluten Kontinuitäten zu verbinden. Beides repräsentiert Guibert.
FISCHER: Ja, da ist Hervé Guibert so individuell wie beispielhaft. Ich will eine schwule, nicht eine queere Geschichte erzählen, die Geschichte eines weißen, gebildeten, privilegierten Westeuropäers. Das war sein Kapital. Wir müssen präzise sein, differenzieren. Je genauer man schaut und den Punkt in der Tiefe sucht, desto mehr weitet sich der Blick.
Hervé Guibert
Der Autor kam 1955 in Saint-Cloud bei Paris zur Welt und starb 1991 in Clamart an den Folgen eines Suizidversuchs. In Frankreich schon in jungen Jahren nahezu ikonisch berühmt – als Fotograf, Autor, mit Drehbuch- und Filmprojekten –, wurde er in Deutschland erst posthum mit seinem Roman »Dem Freund, der mir das Leben nicht gerettet hat« (erschienen im August Verlag, 271 Seiten, 20 Euro) bekannt. Das Buch hatte eine enorme Wirkung im Zeitalter von Aids und der Emanzipation der Erkrankten von ihrer Stigmatisierung.
Premiere: 17. November 2022