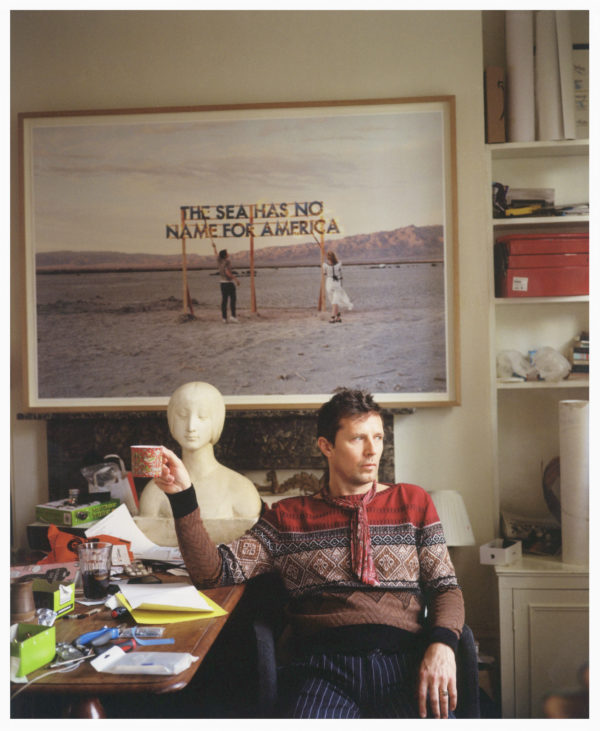Wie überträgt man Lyrik in Gebärdensprache? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Projekt »Droste in Bewegung«: Das Center for Literature auf Burg Hülshoff hat in Zusammenarbeit mit der Literaturinitiative handverlesen aus Texten gebärdete Performances gemacht. Auf einer Website sind so nun Annette von Droste-Hülshoffs »Der Knabe im Moor«, »Am Thurme«, »Das Spiegelbild« und »Die Mergelgrube« in Deutscher Gebärdensprache zu erleben.
Eine Frau steht an einem Burggraben voller Wasser, die Kamera fährt langsam auf sie zu. Sie bewegt ihre Hände in Gebärdensprache. Die Szenerie und ihr Gesichtsausdruck wirken düster. »O schaurig ist’s über’s Moor zu gehn, / Wenn es wimmelt vom Haiderauche«, so heißt es in den ersten Zeilen des Droste-Gedichts »Der Knabe im Moor«. Die Spannung, die der Text aufbaut, ist im Video greifbar – und das im besten Wortsinn. Denn Julia Kulda Hroch übersetzt Annette von Droste-Hülshoffs Lyrik in Deutsche Gebärdensprache (DGS). Die Aufnahmen sind atmosphärisch und thematisch passend umgesetzt, Schnitte unterteilen die Strophen. Während »Der Knabe im Moor« im Freien spielt, wurde etwa »Am Thurme«, übersetzt in DGS von Laura-Levita Valyte, in einem Treppenhaus gefilmt. Voller Intensität gebärden die Poetinnen die Gedichte, ihre Übersetzungen sind einnehmend als räumliche Performance gefilmt.
»Droste in Bewegung ist aus dem Wunsch hervorgegangen, das Werk Annette von Droste-Hülshoffs möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen«, sagt Swarje Boekhoff, die das Projekt als Literaturvermittlerin inhaltlich betreut. Schließlich arbeiteten sie schon seit vielen Jahren im Center for Literature daran, die Texte der Droste in verschiedene Sprachen zu übersetzen. »Dafür beauftragen wir Übersetzer*innen, die darin geübt sind, Literatur in ihre Erstsprache zu übertragen. Neben Lautsprachen wie dem Englischen, Arabischen, Französischen, ist es uns wichtig, auch die Deutsche Gebärdensprache abzubilden.«
Visuelles Erlebnis
Allerdings enstpricht die DGS nicht der Grammatik der deutschen Lautsprache. Sie funktioniert eigenständig, visuell-manuell, mit Gebärden statt mit Wörtern. In DGS kommunizieren rund 200.000 Taube und Hörende in Deutschland, Belgien und Luxemburg. Dabei verwenden viele DGS-Nutzer*innen sowie das Center for Literature bewusst das Wort ‚Taub‘ als eben positive Selbstbezeichnung nicht hörender Menschen, um nicht etwa mit Wörtern wie ‚gehörlos‘ einen Mangel auszudrücken.
Gesprochene Sprache funktioniert linear – es können immer nur nacheinander Sprachlaute produziert werden, die zusammen Wörter ergeben. Gebärdensprache hingegen ermöglicht, sprachliche Zeichen parallel einzusetzen – etwa die Hände zusätzlich zum Gesicht. Entsprechend viel passiert in den Videos in kurzer Zeit, der Blick für Details schärft sich bei nochmaligem Ansehen. Aber auch ohne Kenntnisse in Gebärdensprache ziehen die Videos Zuschauende in ihrem Bann. Sie sind um ein Vielfaches lebendiger als so manche Schullektüre zu Werken von Annette von Droste-Hülshoff.
Seit 2019 arbeitet das Center for Literature mit der Literaturinitiative handverlesen zusammen, die Gebärdensprachpoesie als Literatur in einem fast ausschließlich hörenden Betrieb etablieren möchte. Die emanzipatorische Initiative nimmt nach eigenen Worten »Literatur in die Hand« und spielt mit den Metaphern rund um die Gebärdensprache und bewegte Texte. Eines ihrer Ziele ist es auch, für eine stärkere Präsenz tauber Künstler*innen zu sorgen. »Für uns ist diese Zusammenarbeit eine große Bereicherung, denn handverlesen-Mitgründerin und Leiterin Franziska Winkler ist als Kind Tauber Eltern mit Deutscher Gebärdensprache als Erstsprache aufgewachsen«, sagt Boekhoff. »Sie hat damit schon von klein auf Kontakt zur Gemeinschaft und Kultur der Tauben gehabt, verbindet uns mit den Gebärdensprach-Poet*innen, ist quasi künstlerische Produktionsleiterin und Vermittlerin.« Die Videos leisten so einen Beitrag zu einem Literaturverständnis, das gebärdete Texte einschließt. Lesegewohnheiten gehen darin über den gedruckten Text hinaus und schließen bewegte digitale Formate ein. In einem Übersetzungslabor des Center for Literature wird zudem gerade die Erzählung »Judenbuche« in DGS sowie in weitere Lautsprachen übersetzt. Zwei jüdische Autor*innen, Linda Rachel Sabiers und Ron Segal, befassen sich außerdem kritisch mit dem Text und machen ihn zum Bezugspunkt für eigene Arbeiten bei einer Lese- und Gesprächstour durch Westfalen.