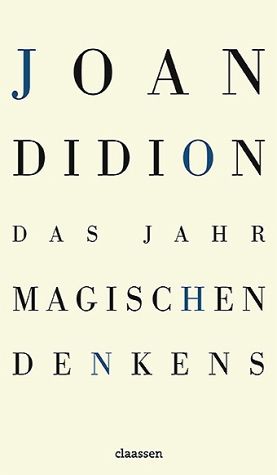Ein Ehepaar ist bei den Vorbereitungen zum Abendessen. Der Tisch ist gedeckt, die Ehefrau noch beschäftigt, der Ehemann sitzt bereits. Sie haben ihre schwerkranke Tochter im Hospital besucht, sie reden, er sagt etwas. Dann sagt er nichts mehr. Als die Frau sich umdreht, ist der Mann zusammengesackt. Als sie ihn vom Tisch wegrückt, fällt er zu Boden. Die Frau ruft den Notdienst, der Mann kommt ins Krankenhaus. Die Frau wartet dort. Ein Sozialarbeiter erscheint, ein Arzt. Ihr Mann ist tot. Herzinfarkt.
Die Frau nimmt die Plastiktüte entgegen, in der seine Sachen sind, sie sagt, sie braucht keine Hilfe. Sie nimmt ein Taxi und fährt nach Hause. Zuhause schreibt sie in ihren Computer: »Das Leben ändert sich in einem Augenblick. Man setzt sich zum Abendessen, und das Leben, das man kennt, hört auf.«
Die Frau ist Schriftstellerin, Journalistin, Essayistin: Joan Didion. Auch ihr Mann war Schriftsteller: John Gregory Dunne. Sie leben in New York und sind wer in der Szene. Sie ist es gewohnt zu beobachten, gewohnt, das Chaos der Gefühle und die Kontingenz des Lebens in die logische Abfolge von Worten zu übersetzen. Also schreibt sie ein Buch über das »Ereignis«: Was passiert ist (aber das ist und bleibt immer nur das Eine). Wie sie es wahrgenommen hat, was mit ihr vorgeht danach. Ein Jahr später schließt sie das Buch ab. Und ist immer noch nicht weiter. Dass ihr Mann, mit dem sie vierzig Jahre zusammen lebte, tot ist, weiß sie. Aber sie begreift es nicht. Sie, eine Intellektuelle, ertappt sich immer wieder bei dem, was sie magisches Denken nennt: beim Versuch, die Kette von Ursache und Wirkung durch Gedanken und symbolische Handlungen zerreißen zu wollen. So wünscht sie die Obduktion, weil ja dann sicher herauskommt, dass die Sache eine kleine Ursache hatte, die man leicht wird beheben können. Sie wehrt sich gegen einen Nachruf, weil sie damit anderen erlauben würde zu denken, dass John tot ist. Sie bemerkt Unstimmigkeiten in ihrer Erinnerung, die sie zu dem Schluss verleiten, der Ablauf könnte in Wahrheit ganz anders gewesen sein, mit anderem Ergebnis. Dass sie durch etwas den Tod hätte verhindern können, etwas was sie aber versäumt hat, würde zwar Schuld nach sich ziehen, aber auch eine Rückkehr bedeuten auf den Boden des Beherrschbaren. Also sucht sie nach solchen Möglichkeiten. Monatelang.
Lange ist die sterbenskranke Tochter wie vergessen; dann rückt sie in den Fokus. Aber um sie zu bangen, scheint weniger schlimm als Johns Totsein zu ertragen. (Die Tochter stirbt fünf Monate nach Erscheinen des Buchs.) Dieses Buch ist ein Bericht gemeinsamen Lebens, eine Reportage unmäßigen Leids, ein Rapport der Verwirrung. Die Sprache aber ist ohne Emotion, so wie Emotionen nicht ihr Gegenstand sind. Didion liest medizinische, sozial- und psychotherapeutische Literatur. Stolpernd analysiert sie ihr Stolpern. Sie hat ein gewisses intellektuelles Vergnügen an ihren Fehlleistungen, die Folge dieses Todes sind, der in ihrer Wahrnehmung wie aus blauem Himmel kam, aber in Wahrheit zu erwarten war: John hatte seit zwei Jahrzehnten starke Herzprobleme, war 71. Das alles folgerichtig kam, wird der Ich-Erzählerin (Didion selbst?) nicht einmal auf der Metaebene der Reflexion bewusst (Johns Alter erwähnt sie nie). Die Erzählerin bemerkt nicht, dass Reflexion auch eine Form magischen Denkens ist. Mit der Methode sprachlicher Lakonie heilt man kein Leid, ersetzt man das Trauern nicht.
Man sollte versuchen, das Buch wie einen Roman zu lesen. Dann wären der Tod des Mannes und die Krankheit der Tochter die biografischen Staubteilchen, an denen jede Erzählung zu kondensieren beginnt. Dann würden all die Namen von Freunden, Kollegen und Lebensstationen, die Didion ausbreitet, nicht wie Geklingel klingen, sondern wie die Melodien einer fragmenthaften Geschichte. Es wie einen Roman zu lesen, würde auch ermöglichen, allerlei andere Unstimmigkeiten hinzunehmen. Und schließlich: Ist nicht das Konstruieren von Kausalitäten, Herstellen von (Todes-)Vorbedeutungen, das natürliche Handwerk des Schriftstellers? Als Roman ist »Das Jahr magischen Denkens« so etwas wie ein modernes Tibetanisches Totenbuch. Das man nur zur Hand nehmen sollte, wenn man wirklich wissen will, was tot heißt. Wenn man 250 Seiten weniger magisches als manisches Denken aushalten will. Denken, dem man eines Tages selbst verfallen wird. Wenn… //
Joan Didion: »Das Jahr magischen Denkens«; aus dem Amerikanischen von Antje Rávic Strubel; Claassen Verlag Berlin 2006, 255 S., 18,- €