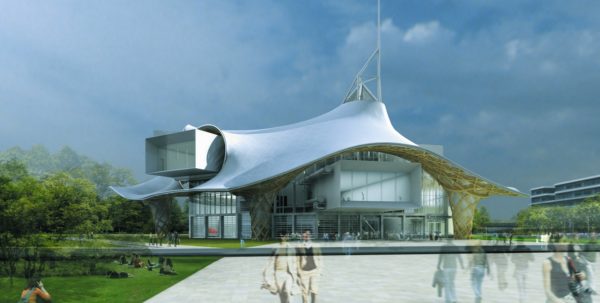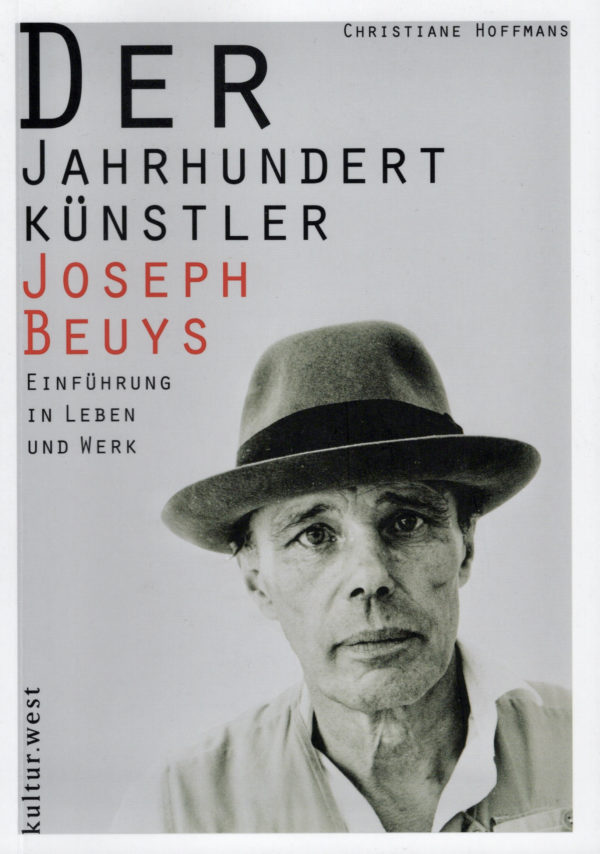Gesichter zeigt er verbeult und mit verzerrten Zügen, schiefen Augen, einem riesigen Ohr. Messdiener und Metzgerjungen getränkt in glutrote Farbe. Er malt aufgewühlte Landschaften, wo spitze Winkel und wirbelnde Linien aufeinandertreffen. Häuser und Bäume, die scheinbar den Hang hinabrutschen. Man könnte vielleicht an Ludwig Meidner denken und sicher an Francis Bacon. Vor allem mit Blick auf Knochen, Fleisch und Eingeweide: Komplette Rinderhälften breitet Soutine aus vor den Augen, ganz nah, als seien sie direkt auf die Leinwand gespannt.
Doch in seinem Umfeld stand er allein da. Während die Kollegen den Kubismus ausformulieren, die Abstraktion feiern, den Surrealismus erfinden, arbeitet sich der junge Mann aus Belarus seit 1915 in Paris an den akademischen Gattungen ab. »Gegen den Strom«, diesen Titel trägt die Soutine-Ausstellung im Düsseldorfer K20. Das klingt vielleicht etwas beliebig. Doch passt er gut zu dieser Malerei und auch zu dem Menschen dahinter. Soutine taugt für keine Schublade. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass sich Museen und Markt, zumindest hierzulande, lange schwer getan haben mit dem Künstler.
Die letzte Soutine-Retrospektive in einem deutschen Museum liegt mehr als 40 Jahre zurück, sie fand 1981 in Münster statt. Und nur wenige Häuser hier besitzen vereinzelte Gemälde. Dazu zählt die Kunstsammlung NRW, deren damaliger Direktor Armin Zweite 1997 Soutines »Stillleben mit Fasan« erwarb. In der Landes-Sammlung ist es bei dem einen Gemälde geblieben, das aber als Anstoß für eine große Ausstellung reichte, die Düsseldorf gemeinsam mit dem Louisiana Museum of Modern Art und dem Kunstmuseum Bern realisiert. Und die den Blick immer wieder auf den Außenseiter, den Emigranten, den heimatlosen Soutine lenkt. Ein Thema, das sich sehr prägend durch Leben und Werk zieht.
Absprung nach Paris
Geboren 1893 als zehntes von elf Kindern eines jüdisch-orthodoxen Flickschusters auf dem Lande im heutigen Belarus, durchlebt Soutine eine Kindheit in Armut und eine Jugend als künstlerisch begabter Sonderling. Mit 14 schon nimmt er Malunterricht in Minsk, mit 17 zieht er zum Studium nach Vilnius und schafft drei Jahre später den Absprung nach Paris. Hier befreit Soutine sich von den alten Wurzeln, ohne allerdings neue zu schlagen. Als scheu wird der Ankömmling beschrieben, als schüchterner Einzelgänger, der kaum Französisch spricht und nur wenigen Menschen vertraut.
In die Kunstmetropole ist er vorgedrungen, doch die Armut bleibt, zunächst. Und der Hunger. In der Ausstellung fällt der Blick auf drei kleine gemalte Heringe, deren tote Augen uns vom Teller aus entgegenglotzen. Daneben zwei Gabeln zum Teilen des kargen Mahls. Wen hätte Soutine wohl zum Essen eingeladen? Kumpels zählte er kaum in seiner Wahlheimat. Statt gemeinsame Sache zu machen mit den vielen avantgardistischen Kolleg*innen und Künstlergruppen in der Metropole, verzieht Soutine sich allein in den Louvre – bewunderte Werke von Chardin etwa, von Courbet oder Corot. Und begeistert sich besonders für Rembrandts Malerei.
Die seinerzeit überkommenen Gattungen, Porträt, Landschaft, Stillleben, fasst Soutine neu in seine eigene Sprache – extrem, expressiv, zuweilen radikal. Im Spiel ist dabei viel Farbe, die der Maler mitunter auch direkt aus der Tube auf die Leinwand drückt. Mit dicken knallroten Lippen und leuchtend blauer Jacke sieht man ihn im Selbstporträt von 1918 neben der Staffelei sitzen.
Die Ausstellung folgt Soutine ein Jahr später in die Pyrenäen nach Céret, wo er bis 1922 eher unglücklich und allein haust, seine Kunst aber in rund 200 Gemälden auf neue Höhen treibt. »Er steht um drei Uhr morgens auf und läuft mit Leinwand und Farben 20 Kilometer weit, bis er einen Platz findet, der ihm gefällt«, so beschreibt der Kunsthändler Léopold Zborowski Soutins Tagesablauf in dem Bergdorf. »Abends kehrt er dann zum Schlafen in seinen Saustall zurück und vergisst völlig, dass er noch nichts gegessen hat.« In Céret und Umgebung entstehen viele seiner aufgewühlten Landschaften, wie im Orkan gekrümmt, zerwühlt, verbogen.
Unter den Stillleben, die der Künstler hier schafft, ist auch das Düsseldorfer Exemplar »mit Fasan«: Am oberen Rand scheint das titelgebende Geflügel befestigt, hängt mitten im Bild herab und streckt seine orange leuchtende Brust hervor. Über einer Schüssel, die wahrscheinlich zum Ausnehmen bereitsteht. Daneben liegen einige reife rotgelbe Äpfel, die bald wohl anstelle der Eingeweide den Leib füllen werden.
Obst, Gemüse und tote Tiere besorgt sich der Künstler auf dem Markt – denn Fotos oder Zeichnungen reichen ihm nie. Ohne das unmittelbare, reale Vorbild geht bei Soutine gar nichts. Auch bei den Bildnissen. Für die sucht sich der Maler in Céret oft Nachbarn oder einfach Leute von der Straße als Modelle: Kinder, alte, junge und auch psychisch kranke Menschen. Sie alle lassen anscheinend gleichmütig alle möglichen malerischen Deformationen über sich ergehen und setzen sich noch dazu Soutines Launen aus: »Ich knirsche mit den Zähnen, und manchmal fange ich an zu schreien«, so berichtet der von den Porträtsitzungen. Am Ende habe er Stunden gebraucht, um sich zu erholen und nach dem Malen wieder zu sprechen.

In der Schau sind einige Ergebnisse solcher Torturen zu bewundern: Isoliert zeigt Soutine seine Modelle in einer kaum definierten Umgebung – allein sind sie wie er selbst und anonym, allenfalls durch ihre Berufskleidung näher definiert. So auch der »Pâtissier«. Dieses Schicksalswerk ist in Düsseldorf nicht zugegen, sei aber erwähnt. Denn immerhin hat der kleine Konditor mit dem Riesenohr Soutines Leben verändert.
Ausnahmsweise sind in diesem Bildnis, vor allem im charakteristisch gestrichelten Konditorenkittel, Anklänge an den französischen Impressionismus unverkennbar, die offenbar das Interesse des Industriellen und Sammlers Albert C. Barnes weckten. Der reiche Amerikaner ersteht 1922 nicht nur den »Pâtissier«, sondern dazu noch über 50 weitere Soutine-Gemälde und macht den bettelarmen, belarussisch-jüdischen Immigranten über Nacht zum Star der Pariser Kunstszene.
Beflügelt vom Erfolg, malt Soutine weiter Köche und Konditoren. Kellner und Kammerdiener bezeugen, dass sich der Künstler nun in besseren Kreisen bewegt. Pagen, Portiers, Metzger, Messdiener und Damen in knallroten Kleidern belegen darüber hinaus, dass ihn nicht nur das Motiv interessiert. Sondern ganz besonders auch die Farben – allen voran rot. Es leuchtet einem aus den Porträts entgegen, und schockt mit Blick auf blutig rohes Rindfleisch.
Diesmal ist es Rembrandts »Geschlachteter Ochse« aus dem Louvre, der Pate steht. Fasziniert vom Sujet, holt Soutine sich seinerseits einen Ochsen aus dem Schlachthaus ins Atelier. Man erzählt die Geschichte, dass er sich beim abmalen zu viel Zeit lässt, bis das Tier schließlich schwarz wird und fürchterlich zu stinken beginnt. Weil der Künstler sich aber keinen zweiten leisten will, ersteht er beim Metzger ein paar Liter frisches Blut, die er über das verwesende Tier gießt – um nach blutrotem Vorbild weitermalen zu können.
Francis Bacon konnte sich ein Beispiel an ihm nehmen. Und nicht nur er. Vor allem unter Künstler*innen hat Soutine allerhand Bewunderer. Heute wie damals. Als der Maler 1943 auf der Flucht vor den Nazis an einem Magendurchbruch stirbt, stehen auf dem Friedhof Montparnasse unter den wenigen Trauergästen auch Jean Cocteau und Pablo Picasso am Grab, um den großen Kollegen zu betrauern.
Kunstsammlung NRW, K20, Düsseldorf
2. September bis 14. Januar 2024