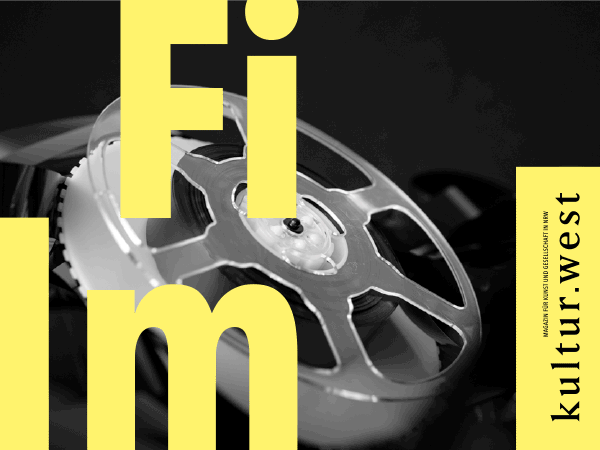TEXT: ANDREAS WILINK
Es ist, als müsse die Natur das Ihre dazu tun, um menschliche Schwierigkeiten, Unzulänglichkeiten, Unausweichlichkeiten auszugleichen: Wolken am Himmel, die Ruhe einer Landschaft, Windräder, ein einsamer Baum, eine grüne Wiese, der stille Ozean. Und irgendwo scheint durch eine graue Nebelwand ein Regenbogen. Der »Horizont« – Leitmotto der Dokumentarfilmwoche Duisburg 2010 – öffnet sich. Der Blick der mehr inhaltlich gravierenden als formal originellen Wettbewerbsbeiträge sucht die Totale. Auch wenn sich die Wahrnehmung danach wieder verengt auf einen Ausschnitt – eine Kleinstadt bei Köln, Halden im Ruhrgebiet oder die Lebensgewohnheiten des Passer domesticus, des Hausspatzen.
Kubaner sitzen am Meer, lachend, heiter – frei? »Soy libre« heißt der Film von Andrea Roggon über das Lebensgefühl in einem Land, dessen permanente Revolution in die Resigna-tion geführt hat. Bilder und Sprache fallen auseinander: alltägliche Beobachtungen und die Äußerungen der Leute, deren Gedanken frei sind, solange sie im Innern verschlossen bleiben und das ideologische Gebot nicht brechen. Es ist das Porträt einer von Beschränkung mürbe gewordenen Gesellschaft. Apathie und Trauer betreiben Raubbau am Menschen. Umso bewundernswerter jemand wie die junge Yoani Sanchez, die mit ihrem Blog Generación Y Fidels Projekt herausfordert. Das Bittere dieser von individuellen Äußerungen getragenen System-Analyse ist die Diskrepanz zwischen trotzig heiterer Gemütsverfassung und dem Druck des Regimes.
Ein trauriges Volkslied singt vom Aufbruch nach Norden, während ein Güterzug über die Schienen dieselbe Richtung nimmt. Zu den vier Himmelsrichtungen kommt noch eine hinzu: Sie liegt dort, wo hinter Mexiko die USA beginnen. Fridolin Schönwieses depri-mierender Report »Die fünf Himmelsrichtungen« berichtet von zwei Illegalen, Maria Esther und Miguel, die ihre Heimat Tres Valles in Veracruz verlassen haben, um in Kansas City Geld zu verdienen. Sie halten sich mit lausigen Jobs über Wasser, Miguel telefoniert täglich mit seiner Familie und riskiert alle paar Jahre einen Besuch bei gefährlichem Grenzübertritt, Maria Esther hat nur Kontakt zu ihrem früheren Priester, der ihr Videobotschaften sendet, sonst aber alle Brücken abgebrochen, außer dass sie nostalgische Feiern für mexikanische Immigran-tenfamilien ausrichtet. Überschuldet, nicht in der Lage, die Miete ihrer schäbigen Unterkünfte zu zahlen, sinken sie stetig ins Elend ab. Fremde im Dickicht der Städte, Randexistenzen, die über das Heute nicht mehr hinausschauen, weil jede Perspektive Illusion wäre.
Was für eine Geschichte: Ein Fußballer aus Lagos, Torschützenkönig der Bundesliga, macht 2001 Schlagzeilen, als eine sich in seinem Eigentum befindliche Fähre Jungen und Mädchen für den Kinderhandel befördert hat. Die Karriere von Jonathan Akpoborie in Europa ist erst mal beendet: »Eine Lüge und alle schlagen dich ans Kreuz«, sagt er, und der Manager des VfL Wolfsburg: »Sein Marktwert war weg«, auch wenn er von dem Transport selbst nichts gewusst hatte. In »Das Schiff des Torjägers« befragt Heidi Specogna auch einige der damals von Benin, Mali und Togo nach Gabun zum Zweck der Ausbeutung verbrachten, von ihren Eltern aus Not weggegebenen Kinder, die von ihren Torturen berichten, aber dank internationaler Hilfsorganisationen gerettet wurden. Das Schiff, die Etireno, hatte Jonathan, das einstige Gettokind, nach seiner Mutter benannt. Die da unterwegs nach Gabun waren, hatten ebenfalls Hoffnung auf eine Zukunft, wie sie sich Jonathan Akpoborie geboten hat. Nur zu leicht kann die Balance des Glücks und des Unglücks brechen.
Philip Scheffner nimmt die Vogelperspektive ein und betrachtet zwei Ereignisse, die am selben Tag stattfinden, ohne miteinander zu tun zu haben: Am 14. November 2005 wird ein Spatz im niederländischen Leeuwarden erschossen, der sich in ein Fernsehstudio verirrt hatte und dort in einer Kettenreaktion die für eine Show vorbereiteten 23.000 Dominostei-ne und damit fast die Sendung selbst zu Fall brachte. Weltweite Proteste folgten. Gleich-zeitig stirbt in Afghanistan ein deutscher Soldat bei einem Selbstmordanschlag. »Der Tag des Spatzen« – »ein politischer Naturfilm«, so die Jury des Hamburger Klaus-Wildenhahn-Preises – setzt beide Ereignisse in Beziehung und zieht aus der Asymmetrie Analogien.
In einer offenen essayistischen Form, deren subtile Botschaften an Alexander Kluges Methode erinnert, Geschichtsbewusstsein zu schärfen und Gesellschaftskunde zu vermitteln, misst Scheffner das Klima in Deutschland – in ruhigen Bildern, mit scheinbar sachlicher Kommentierung und mit einem Schockmoment zu Beginn, wenn ein Spatz wieder und wieder gegen eine Glassscheibe knallt. Das Tier kann den Widerstand nicht erkennen, es scheitert am Faktischen. So geht es auch in dem Film um das Sichtbare und das Verborgene. Die Kamera schwebt in die Wolken – es sind Vögel in der Luft, aber auch Flugzeuge; hier das Idyll in sattem Grün, dort die Spuren militärischer Aktivitäten; hier ein Vogelschutzgebiet an der Ostsee, dort ein Truppenübungsplatz in der Eifel, von wo aus ein Bombergeschwader den Einsatz in Afghanistan vorbereitet, den ein Soldat als »zweites Vietnam« bezeichnet. Die Versuche des Regisseurs, mit der Bundeswehr in Kontakt zu treten und für seine Produktion Drehgenehmigungen und Gesprächspartner zu erhalten, werden abschlägig beschieden und finden als Making-Of Eingang in den fertigen Film. Scheffners sanft bohrender ornithologischer Blick durchdringt ein Deutschland im heimlichen Kriegszustand. Man könnte ihn einen Augur nennen.
Methodisch schließt Erwin Michelbergers »Lus« an, zumal das Kameraauge ebenfalls in die Höhe strebt. Der Tod stellt die brennende Frage nach dem Leben – dem irdischen und dem ewigen. Zuvörderst beschäftigt sich »Lus« mit der Sepulkralkultur: Ein jüdischer Toter wird gewaschen, gereinigt und verhüllt. Eine christliche Beisetzung findet statt; im islamischen Ritus wird jemand zu Grabe getragen. Erde zu Erde. Auf dem Boden des Heiligen Landes lässt sich gut sprechen über letzte Dinge, und es zeigt sich, dass die Heimstatt des Herrn kein Ort menschlichen Friedens ist. Gemäß dem Wort Jesu »Lasset die Kindlein zu mir kommen« tauschen sich neben schwäbischen Totengräbern und nahöstlichen Leichendienern auch Jungen und Mädchen über Gottes- und Jenseits-Vorstellungen aus, über paradiesische Zustände, höllische Strafen, irdische Güter, religiöse Ideale und politische Realitäten, bevor die präparierten Leichen des Gunther von Hagens als Anatomie menschlicher Profanisierung einen Kontrapunkt setzen. Dass die Gesichter der Diskutanten vor einem blauen leeren Himmel erfasst werden, so dass alle in einem imaginären Dialog und weit gefassten Symposion vereint scheinen, ist mehr als nur schönes Detail. Grundiert von autobiografischen Erinnerungen, die das Samenkorn für diese reife Reflexion legen, bleibt der Filmautor immer auch auf der Spur des eigenen »Werde, der du bist«.
Ein Horrorfilm aus der rheinischen Provinz. Ortstermin: Heinsberg. »Achtung Kinderschänder! Karl D 400 m – rechts« steht auf einem Schild auf einer Gänsewiese. »Die Sex-Bestie« heißt ihn der Volksmund auch; und bei einem Aufmarsch skandieren Rechtsradikale unter Applaus »Ausrotten«. Der Sexualstraftäter Karl D., wegen Missbrauchs von drei Mädchen 1985 und 1995 insgesamt zu mehr als 20 Jahren Haft verurteilt, ist nach der Entlassung zu seinem Bruder, der an das Verbrechen nicht glauben kann, dessen Frau und Sohn gezogen. Die Bevölkerung geht auf die Straße und belagert das Haus, die Bewohner schotten sich ab, die Polizei hält Wacht. »Auf Teufel komm raus« von Mareille Klein und Julie Kreuzer schildert eine gespenstische Szene. Sympathien für irgendwen aufzubringen, fällt schwer. Ebenso, nicht seine eigenen Vorurteile gegenüber einem Kleinbürgertum, das hart gegen die Unterschicht tendiert, bestätigt zu sehen. Verhaltensstörungen auf allen Seiten. Eine unangenehme Gemengelage aus berechtig-ter Sorge, Sensationsgier, Tratsch im Vorgarten, dumpfen Lynchimpulsen, verquerer Angstlust und schlimmen Erinnerungen tut sich dar. Protest mit Grillparty. Karl D., augenscheinlich ein Hundefreund, ruhig und sehr manierlich, plaudert beim Kaffee mit einigen Frauen aus der Nachbarschaft über das Geschehene und beschreibt sein Empfinden beim Prozess: »Irgendwas hat da nicht gepasst.« Bruder Helmut erleidet eine Herzattacke und wird wegziehen. Am Ende, nachdem Karlsruhe den Antrag auf Sicherheitsverwahrung abgelehnt hat, spaziert Karl D. durchs Städtchen. Die Straßen sind sauber gefegt.
Jedes Haus hat sein Geheimnis, so wie jede Familie. Die Brüder Fosco und Donatello Dubini sind penible Rechercheure. Sie decken gern auf, was versiegelt und verschwunden war: zum Beispiel die Mysterien der Diva Hedy Lamarr, von Ludwig II. und Jean Seberg. »Die große Erbschaft« ist ihnen gewissermaßen in den Schoß gefallen – aber die Ursache für ihre Dokumentation größer, als das filmische Resultat. Das Haus des Großvaters im Tessin fiel einem Brandstifter zum Opfer. Das meiste ist zerstört, Bagger reißen das Gemäuer ein. Drinnen sucht die Familie nach genealogischen Spuren sowie nach Gold – und wird sogar fündig. Der wahre Schatz aber könnten die Erinnerungsreste der italienisch-schweizerisch-deutschen Familiengeschichte sein, die sich aber weder zum Sittenbild noch recht zum Zeitdokument fügen will. Es bleibt anekdo-tisch. Das behauptete »Pathos der Dinge« will seine Wirkung nicht entfalten.
Im Revier schon eher. »Zwei, drei Standorte« schreitet Martina Müller mit einem traurigen Repräsentanten des Strukturwandels ab, dessen Tatkraft, Optimismus und strategisches Planen mitsamt dem von Kommunen und Land versickert und versandet sind. Der Aufschwung hängt durch. »Stätten der Niederlage« statt blühender Landschaften, wo einst Zechen standen: kein Gewerbegebiet, kein Hotel, kein Design-Büro – Brachen. Selbst der Grundstein, der irgendwo in Waltrop mal in Anwesenheit von Minister Clement gelegt wurde, bleibt unauffindbar. Stoff für eine Farce, wenn’s nicht bitter wahr wäre.
Gleiches gilt für »A Road not taken« der Schweizer Christina Hemauer und Roman Kel-ler. Ihr Road Movie ist ein Energiereport. Jimmy Carter hatte 1979 in einem symbolischen Akt 32 Sonnenkollektoren auf dem Dach des Weißen Hauses installieren lassen, die sein martialisch-charmanter Nachfolger demontierte. Ausran-giert, landeten sie an einem College in Maine. Die Filmemacher bringen in einem coup de résistance zwei davon über Land nach Washington und Georgia: Museumsstücke. Ölkrise, Konflikte im Mittleren Osten, Antiatomkraftbewegung und das Konzept erneuerbarer Energiegewinnung verlangten nach einer Politik, die der amerikanischen Mentalität widersprach, so dass die Bürger ihren nervenden guten Menschen aus dem White House nach vier Jahren abwählten und Ronald Reagan kürten. Die Gleichgültigkeit unter der Sonne hat ihren Preis.
Ansichten einer Straße, von Veranden, Fassaden, Passanten, spielenden Kindern. Ein Ausschnitt der Welt: der einzige für Janis Sawyer, von ihr mit einer Spy Cam fixiert, die die eigene Bewegung ersetzt. Von Seaside, dem schönen Ferienort an der US-Küste, sieht sie sonst nichts. Die Querschnittsgelähmte ist seit 20 Jahren an Ort und Stelle in ihrem Haus, das sei »ziemlich bizarr«, sagt sie selbst. Ihr Freund, Danny (»der glänzende Penny, den ich gefunden habe«) hat ihr damals, auf Droge und schizophren, das Genick gebrochen. Aber ihre Lebenseinstellung, die gewissermaßen eine Quintessenz des Kinos ist und Florian Riegels beklemmendes Porträt »Holding Still« abschließt, lautet: »Wenn man lange genug still hält, kommt alles zu dir.«
1.–7. November 2010, Filmforum am Dellplatz; www.duisburger-filmwoche.de