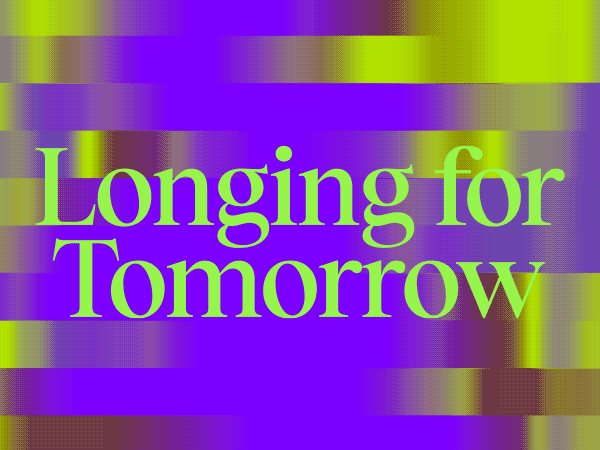Deutschland hat ein Rassismusproblem. Das behauptet die in Duisburg lebende Islamwissenschaftlerin und Religionspädagogin Lamya Kaddor in ihrem neuen Buch »Die Zerreißprobe«. Kaddor gehört zu den profiliertesten Stimmen des liberalen Islam in Deutschland. Geboren wurde sie in Ahlen, ihre Eltern stammen aus Syrien. In ihren Büchern hat sie Kindern und Erwachsenen den Islam erklärt und ergründet, warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen. In »Die Zerreißprobe« will sie zeigen, welche Konsequenzen die Angst vor dem Fremden für die Demokratie hat. Ein Gespräch aus gegebenem Anlass.
k.west: Frau Kaddor, die »Alternative für Deutschland« ist mittlerweile in zehn Landesparlamenten vertreten. Bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat sie sogar die CDU überholt. Lässt sich daran die Stimmung in Deutschland ablesen?
Kaddor: Die Erfolge der AfD bestätigen, dass nun seit anderthalb Jahren die wachsende Islamfeindlichkeit in Deutschland auch zu politischen Erfolgen führt. Das Problem an sich begleitet uns ja spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Und bedingt durch die aktuelle Einwanderung spitzt sich diese Stimmung in Deutschland spürbar zu.
k.west: Sehen Sie die Gefahr, dass sich die anderen Parteien mit diesem Virus der Fremdenfeindlichkeit infizieren?
Kaddor: Wir erleben doch schon rechte Überholmanöver. Teile der Parteien der politischen Mitte haben sich nicht nur Inhalte und Forderungen der AfD zu eigen gemacht, sondern auch deren Rhetorik. Mittlerweile behaupten selbst seriöse Politiker, die Einwanderung von Muslimen wäre eine Bedrohung für diese Gesellschaft. Das formuliert die AfD kaum anders.
k.west: Zurzeit wird viel darüber diskutiert, wie man mit den Anhägern von AfD, Pegida und Co. umgeht – diskutieren oder missachten. Ihre Empfehlung?
Kaddor: Mit ideologisch motivierten Radikalen lässt sich schlecht diskutieren. Das gilt für Rechtspopulisten genauso wie für Islamisten, mit denen ich nicht über die Auslegung des Korans streiten kann. Grundsätzlich halte ich Dialog und Empathie aber für unverzichtbar. Wenn Menschen Ängste vor »Überfremdung« haben und solche Ängste vernünftig zur Sprache bringen, muss man das ernst nehmen. Nur wer ernsthaft diskutieren will, dem kann man auch Argumente entgegenhalten. Zum Beispiel, dass sogenannte Gastarbeiter einen Anteil am Wohlstand dieses Landes haben oder dass Deutschland de facto immer schon ein Einwanderungsland gewesen ist.
k.west: Sie stellen in Ihrem Buch eine grassierende »Deutschomanie« fest. Was genau verstehen Sie darunter?
Kaddor: Mit dem Begriff »Deutschomanie« möchte ich eine Art von Rechtspopulismus beschreiben, der sich einen bürgerlichen Anstrich gibt. Nach außen geben sich die Deutschomanen als verfassungstreue Demokraten, tatsächlich aber diskriminieren sie aus völkischem Denken heraus Minderheiten und sprechen ihnen elementare Rechte ab. Ihre Positionen kann man nicht rechtsradikal im klassischen Sinne nennen, viele sind nicht gewaltbereit, antisemitisch, denken aber in Kategorien wie höherwertige und minderwertige Menschen.
Welche Rolle spielt dabei die Islamkritik?
Kaddor: Forderungen wie »Burka weg!«, »keine Moschee!«, »kein islamischer Religionsunterricht!« sind bloß eine Chiffre für den alten Schlachtruf: »Ausländer raus!«. Schlicht fremdenfeindliches Potenzial wird mit dem Etikett »Islamkritik« kaschiert und so der Gesellschaft verkauft.
Wo verläuft die Grenze zwischen einer berechtigten Diskussion über die Modernisierung des Islam und diskriminierender Islamkritik?
Kaddor: In Deutschland darf und soll jeder jeden und alles kritisieren. Aber Kritik hört auf, wo Diffamierung, Stereotypisierung und pauschale Verdächtigungen beginnen. Wenn ich sage, jede Frau, die ein Kopftuch trägt, sei unemanzipiert und das Kopftuch allein ein Zeichen für Unterdrückung, dann ist das nicht sachbezogen, sondern eine in ihrer Allgemeinheit verunglimpfende, islamfeindliche Aussage.
Sie kritisieren, dass sich Deutschland zu spät als Einwanderungsland definiert habe. In Ländern, die sich, wie die USA oder Frankreich, schon länger als solche verstehen, fällt rechtspopulistische Stimmungsmache gegen Migranten zurzeit auf ähnlich fruchtbaren Boden wie in Deutschland.
Kaddor: Die Selbstdefinition als Einwanderungsland ist auch nur der erste Schritt. Wenn dann keine Integration stattfindet, kommt es zu Verhältnissen wie in Frankreich. Wir hätten aktuell eine nicht weniger fremdenfeindliche Stimmung, wenn Deutschland sich früher als Einwanderungsland verstanden hätte. Aber nichtsdestotrotz halte ich es für sehr wichtig, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass die Geschichte Deutschlands auch eine Geschichte der Einwanderung ist. Damit ist eine grundsätzliche Wertschätzung verbunden, die eben nicht ausreichend vorhanden ist. Auch deshalb fällt es vielen zugewanderten Menschen, ihren Kindern und selbst noch den Enkeln schwer, zu sagen: »Ich bin Deutscher«.
Was verstehen Sie im positiven Sinne als deutsch?
Kaddor: Wenn es etwas gibt, worauf alle in Deutschland lebenden Menschen stolz sein können, dann sicherlich die Verfassung. Sie macht Pluralismus und Freiheit für alle möglich. Ein schönes Spiegelbild des Ganzen ist übrigens die Fußballnationalmannschaft, in der Menschen spielen, deren Familien von überall her kommen. Was Deutschsein aber künftig genau sein soll, darüber muss dringend diskutiert werden. Hilfreich wäre hier, endlich ein Einwanderungsministerium zu schaffen, Kriterien für Einwanderung zu definieren und darüber zu diskutieren, was wir unter erfolgreicher Integration verstehen wollen. Wir können jedenfalls nicht immer nur allein auf die Anpassung der Minderheiten pochen. Auch die Mehrheit muss an sich arbeiten. Hier hat sie eine Bringschuld.
Das Buch: Lamya Kaddor: »Die Zerreißprobe. Wie die Angst vor dem Fremden unsere Demokratie bedroht«, Rowohlt Berlin, Berlin 2016, 240 Seiten, 16,99 Euro