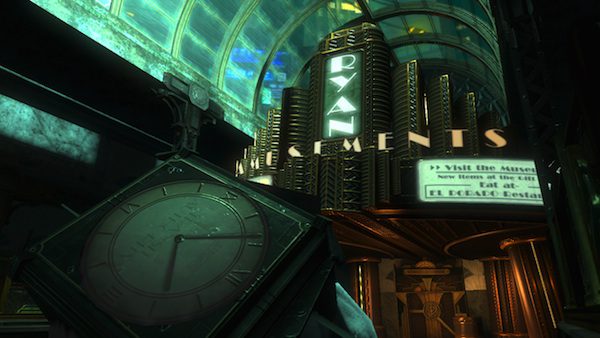TEXT ANDREAS ROSSMANN
Die Büsten lächeln. Nicht alle, aber die meisten von ihnen. Dabei ist nirgends in Köln so viel Tod versammelt und ausgestellt wie hier. Bis hinauf in die Spitzen der Schildbögen stapeln sich Gebeine, in neun Etagen, senkrecht und waagrecht geordnet, sauber sortiert wie ein orthopädisches Ersatzteillager. Sie formen Rauten und Rosetten, Kreuze und Pfeile, Zeichen und Symbole, bilden Buchstaben und ergeben Inschriften. Doch die Büsten lächeln. Genau 64 von ihnen haben hier Platz, auf Sockeln stehen sie, barock dekoriert zwischen goldenen Akanthusrahmenverzierungen oder auf dem Gesims des Altars und blicken, wenn die nicht gerade in der Restaurierung sind, auf Schädel. Der Tod ist Schönheit, künden die Knochen, Schönheit des Himmels, die seinen Schrecken überwindet. Heilserwartung geht von ihnen aus.
Wer die Goldene Kammer, die camera aurea, in der Kirche St. Ursula betritt, steht in einem begehbaren Reliquienschrein und wird zum Zuschauer einer barocken Inszenierung, eines teatrum sacrum. Kein makabrer, schauerlicher Schmuck wird dargeboten, sondern aus den irdischen Überresten der Heiligenscharen eine fromme Knochenornamentik zusammengefügt. Kein Memento mori, kein moralischer Zeigefinger. Keine »Schreckenskammer«, so heißt das Brauhaus nebenan, sondern eine religiöse Schatzkammer. Der Kölner Reichshofrat Johann von Crane hat den Kapellenraum, als die alte Goldene Kammer zu klein und eng geworden war, gestiftet, 1644 wurde der Altar geweiht.
Vier Jahre vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, dessen Kampfhandlungen und Verwüstungen, Hungersnöte und Seuchen ganze Landstriche entvölkerten und den Tod Triumphe feiern ließen. Eine Nachfolgerin der Kunst- und Wunderkammern, wie sie seit dem 14. Jahrhundert in Europa entstanden sind, um Sammlungen von Fürsten und reichen Bürgern aufzunehmen: »In ihrer retrospektiven Architektur und in ihrer Reliquieninszenierung feiert jesuitischer Geist der Gegenreformation die Auferstehung des Mittelalters und die Tradition der Heiltumskultur«, schreibt Anton Legner, der langjährige Direktor des Schnütgen-Museums, in seinem opus magnum »Kölner Heilige und Heiligtümer«.
Die Entwicklung der Kölner Bildhauerkunst in Gotik und Barock, vom Ende des 13. bis ins späte 17. Jahrhundert, lässt sich hier besichtigen. Prächtige Büsten, die als Behälter für die Reliquien hergestellt wurden, paradieren in dem umlaufenden Wandnischenwerk, das rhythmisch in verschieden hohe Gefache unterteilt und mit reich geschnitztem, vergoldetem Schleierwerk versehen ist. In den teils verglasten, teils offenen Rahmungen sind unzählige Häupter angeordnet, Schädel der Heiligen liegen in der Regalkonstruktion, die, fest eingebaut, den gesamten Raum umschließt und den Altaraufsatz einbindet. Schon die alte camera aurea hat Pilger und Reisende in Staunen und Bewunderung versetzt.
Tafeln und Bilder, die aus Schädeln und Gebeinen arrangiert waren, waren aus vielen Knochen- und Schädelkapellen in Europa bekannt, doch hier, »in der Goldenen Kammer«, die in den Winkel zwischen Vorhalle und Südquerschiff gesetzt wurde, sei es, so Legner, »nicht nur gewöhnliches Menschengebein, sondern sogar Gebein von Heiligen, das zum Lobpreis Gottes als ornamenta ecclesiae im barocken Dekorum zum frommen Anschauen und Anrufen zusammengefügt ist«.
Auch Johanna Schopenhauer, die Schriftstellerin, Salonnière und Mutter des Philosophen, die 1828 Köln besuchte, zeigte sich beeindruckt – und befremdet: »Als wir aber, nicht ohne einen kleinen Schauder zu empfinden, die seltsame Verzierung der Wände bemerkten, konnten wir nicht umhin, diese den Atem beklemmende Luft einer anderen Ursache zuzuschreiben. Viele Tausende unendlich zarter menschlicher Gebeine sind hier recht zierlich in verschiedenartigen Mustern dicht aneinandergefügt und bekleiden alle Wände von oben bis unten mit dem seltsamsten, schauerlichsten Mosaik, das sich nur denken lässt. Es sind die Überreste der heiligen Jungfrauenschar, deren auf dem alten ager Ursulanus, auf welchem die Kirche steht, von den frommen Einwohnern von Köln schon vor vielen Jahrhunderten noch eine weit größere Anzahl ausgraben wurde, als hier versammelt ist.«
Die kultische Tradition lässt sich an diesem Ort bis ins 4. Jahrhundert zurückverfolgen. An ihrem Anfang steht die um 400 entstandene Clematius-Inschrift, in der berichtet wird, dass der römische Senator dieses Namens »durch die sehr große Kraft der Majestät des Martyriums der himmlischen Jungfrauen« nach Köln gerufen wurde, um »auf eigene Kosten« ihre Kirche zu erneuern. Die Ursula-Legende bildet sich im 10. Jahrhundert heraus, nachdem das Kanonikerstift »zu den heiligen Jungfrauen« in ein Damenstift umgewandelt und nach der legendären britischen Königstochter benannt worden war.
Als 1106 die Stadt erweitert und auch St. Ursula in sie einbezogen wurde, stießen die Ausschachtungsarbeiten auf zahllose Gebeine, die, obwohl es sich um einen römischen Friedhof handelte, zur Grundlage für die Legende wurden. Aus elf ermordeten Jungfrauen wurden elftausend, und da hier etwa die gleiche Zahl von Männern beerdigt war, wurden sie um genau so viele Beschützer erweitert, die gleichfalls das Martyrium erlitten hatten.
Diese wundersame Reliquienvermehrung hob den Kult dieser Märtyrerinnen und Märtyrer in eine neue Dimension, so dass eine neue Kirche St. Ursula, eine dreischiffige romanische Basilika, gebaut und 1135 geweiht wurde. Die Brüstungen ihrer Emporen sind niedrig, denn sie sollten wohl weniger dem Aufenthalt von Menschen als der Aufbewahrung von Reliquien dienen. Doppelbüsten, wie sie hier stehen, wurden als »Ursula-Büsten« in ganz Europa verkauft und vertrieben, kündeten vom Ruhm der Kölner Goldschmiede- und Bildhauerkunst und mehrten den Reichtum des Stifts. Ihr Export boomte, und doch blieben genügend Gebeine der Heiligen in der Kirche, um einen ganzen Raum zu füllen und auszustatten: die Goldene Kammer. Doch erst im 16. Jahrhundert fanden die elf Flammen, »Tränen« sagen die Kölner, für die elftausend Jungfrauen neben den drei Kronen, die, Hoheitszeichen seit dem 12. Jahrhundert, an die Heiligen Drei Könige erinnern, Aufnahme ins Stadtwappen. Colonia sacra.
Gott und Geld, Glaube und Geschäft: Die Goldene Kammer zeigt auch, wie eng in Köln beides zusammengehört.