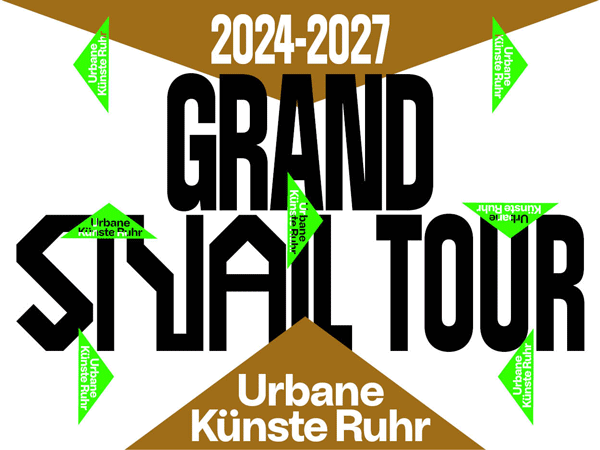Lutz Förster unterrichtete 31 Jahre Tanz an der Folkwang Universität. Zum Ende des Semesters verabschiedet er sich. Ihm und dem 10. Todestag von Pina Bausch ist der Tanzabend der Folkwang Universität gewidmet. Von Bausch, die zwar selbst nie an der Folkwang lehrte, deren Aura die Institution aber bis heute prägt, sind drei Solos aus ihrem Stück von 1998, „Masurca Fogo“, zu sehen. Zentral im Programm, direkt nach der Pause, werden die Choreographien technisch perfekt von Auranne Brunet-Manquat, Julius Olbertz und Etienne Sarti getanzt. Es könnte sein, dass die Kontextlosigkeit dafür verantwortlich ist, dass die drei Tänze merkwürdig wenig berühren. Gerade der schwermütige Mann zu „Nos Tempos Em Que Eu Catava“ von Alfredo Marceneiro, den Julius Olbertz zeigt, rückt hier in der Interpretation nah an die Weinerlichkeit heran. An der Einstudierung kann es nicht liegen: Sie wurde von Professor Stephan Brinkmann, Chrystel Guillebeaud und Dominique Mercy übernommen, die genau wissen, wie es geht. Vielleicht fehlt den jungen Tänzer*innen aber auch einfach noch die unbedingt nötige Reife und eine gewisse Nonchalance, die Bauschs Choreographien brauchen.
Den Auftakt des Abends macht „Tantalus“ von Kuo-Chu Wu. Die im Jahr 2000 uraufgeführte Arbeit beginnt mit einem großartigen und verstörenden Bild: In einem Lichtrechteck stehen die Tänzer*innen seitlich zum Publikum, die Körper beinahe zusammengedrückt von einer unsichtbaren Last, die Rücken buckelig gewölbt, die Knie gebeugt, der Blick aber geht über die Schulter direkt ins Publikum mit großer Ausdruckslosigkeit. Das erinnert an ein expressionistisches Gemälde.
Wu übernahm 2004 das Ballett am Staatstheater Kassel und wurde schnell als die große neue Hoffnung des Tanztheaters gehandelt. Nur zwei Jahre später verstarb er. „Tantalus“, das er zunächst an der Folkwang Universität heraus brachte und ein Jahr später noch einmal mit dem Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan einstudierte, lässt bis auf das Anfangsbild nicht mehr recht nachvollziehen, woher die großen Erwartungen an ihn rührten. Die fast 20 Jahre sind dem Stück sehr deutlich anzumerken. Sowohl im Humor wie in den Leidensposen wirkt es heute überholt.
Am spannendsten sind an diesem Abend die zwei Uraufführungen, die vom dritten und vierten Jahr der Tanzabteilung gezeigt werden. „Tableaux… Going fast does not allow watching the hidden rabbits in the forest“. So kryptisch der Titel von Iñaki Azpillagas Kreation ist, so rätselhaft bleibt auch das Stück. Igor Meneses Sousa dirigiert ein Grinse-Orchester, es werden Piratenwitze erzählt, eine bedrohliche Verfolgung endet nicht wie erwartet im Überfall oder der Vergewaltigung, sondern wird plötzlich zum Flirt auf der Straße. Als Kaleidoskop und Collage menschlicher Beziehungen, wird es im Programm bezeichnet. Das ist ein wenig wohlfeil. Und doch gibt es in diesem Stück großartige Bilder. Ganz zuvorderst jene Szene, in der die Tänzer*innen sich gegenseitig am Arm über die Bühne schleifen, herumwirbeln und -schleudern. Gemeinsam mit der monotonen Musik und dem ununterbrochenen, nur halbverständlichen Reden des am vorderen Bühnenrand liegenden Jan Kollenbach entsteht hier ein unwiderstehlicher Sog.
Schamanistischer Workshop
Den Abend beendet die Uraufführung von „This horse you cannot ride“ von Julio César Iglesias Ungo. Auch wenn es in den ersten Szenen des Stückes noch nicht zu erahnen ist, bezieht sich der Titel offensichtlich auf die Unkontrollierbarkeit von Drogenerfahrungen. Nach einer zauberhaften Pantomime von Marius Ledwig, in der er dramatisch von der Seite beleuchtet einen Vogel freilässt, fügen sich einige Einzelszenen nicht recht zu einem Bild. Hier hätte eine ordentliche Dramaturgie sicher geholfen.
Dann aber nimmt das Stück an Fahrt auf. Angetrieben durch die Musik von J-Lawton – hinter dem Pseudonym verbirgt sich der Choreograph, der offensichtlich eine Zweitkarriere als DJ und Produzent führt – geraten wir mitten hinein in einen schamanistischen Workshop. Während sich Ledwig seitlich am Bühnenrand am Mikrofon in Vokalartistik im Stile von Diamanda Galas ergeht – und das gar nicht schlecht macht – tanzt er auf der Bühne zu einer Musik, die irgendwo zwischen Goa, Industrial und Ethno-Techno in den 90ern stecken geblieben ist. Das gruppendynamische Drogenexperiment müsste eigentlich auf direktem Weg in die Schwitzhütte führen. Die bleibt dem Zuschauer gerade noch erspart. Stattdessen ergeht sich das Ensemble kurz in konvulsivischen Zuckungen, die wiederum durch ein weiteres Gruppenritual eingedämmt werden müssen. Zwischendurch wähnt man sich im Videodreh zu einer beliebigen, drittklassigen Techno-Single, bis sich drei Frauen als Derwische betätigen. Zwei stehen irgendwann im Regen, die dritte bleibt trocken.
Das ist sicherlich alles sehr anstrengend – nicht nur für den Zuschauer – aber es sieht auch aus, als wäre hier mit der Jazztanzgruppe einer örtlichen Tanzschule mal was ganz Verrücktes ausprobiert worden. Das wirklich Schlimme an dieser Arbeit ist, dass Ungo offensichtlich keinerlei Distanz zu dem Gezeigten hat. Seine musikalischen Vorlieben, seine platten tribalistischen Rituale, vielleicht auch seine Erinnerungen an Drogenerfahrungen. Alles wird da eins zu eins ausgestellt, ohne echten künstlerischen Zugriff. Es ist geradezu tragisch, dass der vierte Jahrgang durch diese wirklich erbärmliche Choreographie der raren Möglichkeit beraubt wird, noch einmal während des Studiums mit einem wirklich engagierten und kreativen Choreographen oder einer Choreographin zu arbeiten.