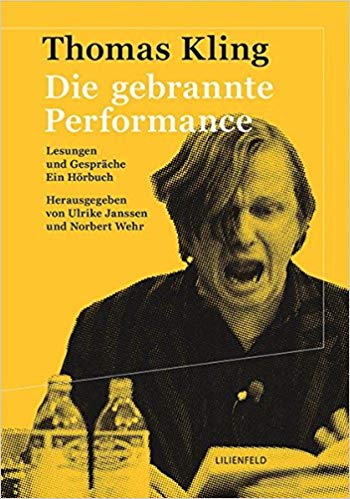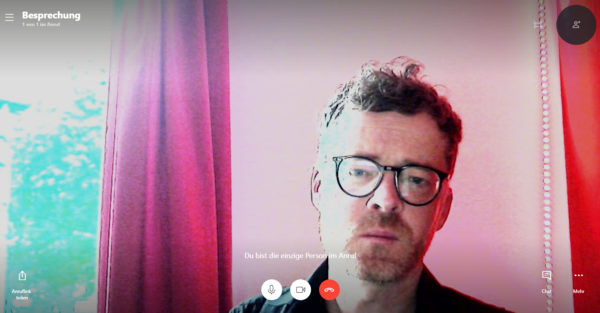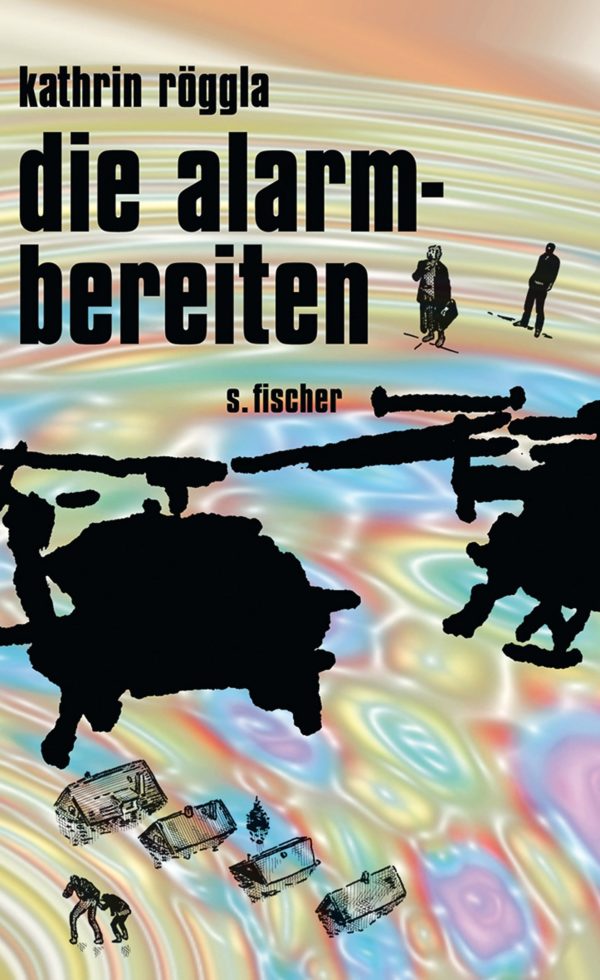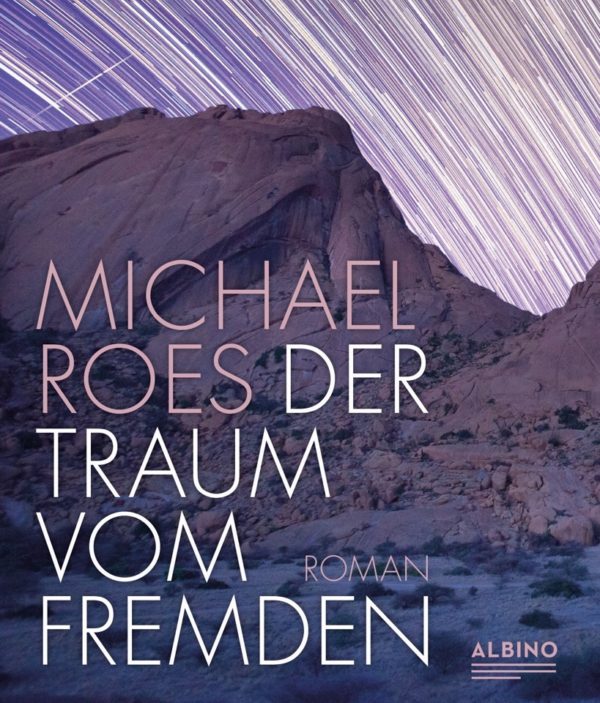Der Whisky-Liebhaber Harry Rowohlt hat die öde Variante der Dichterlesung einmal recht treffend so beschrieben: eine Doppelnamentussi liest vierzig Minuten lang Gedichte, die sich nicht reimen, und trinkt dazu Mineralwasser, das nicht sprudelt. Danach ist Diskussion. Obwohl sich auch die Gedichte Thomas Klings nicht reimen, konnte Rowohlt ihn kaum mit seiner ätzenden Kritik gemeint haben. Nicht allein deshalb, weil Kling, wie sich Marcel Beyer erinnert, bei seinen Auftritten auch schon mal ein Gläschen extra-scharfen Löwensenf auf dem Pult stehen hatte. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man Kling, der auf der Raketenstation Hombroich lebte, als Performer seiner eigenen Gedichte eine Legende nennt. Was viel mit der Überlieferung der Auftritte zu tun hat. An Mitschnitte war bis dato nicht leicht heranzukommen, sodass Klings Fähigkeiten, sich selbst in Szene zu setzen, vor allem vom Hörensagen bekannt sind. So konnte der wie Stefan George in Bingen geborene, in Düsseldorf aufgewachsene Meister des Aufmerksamkeitsmanagements im Rückblick zum »Popstar« der Lyrik werden, obwohl er selbst den Popbegriff diskreditiert sah.
All jene, die Thomas Kling live verpasst haben, bekommen dank des von Ulrike Janssen und Norbert Wehr sorgsam herausgegebenen, Lesungsmitschnitte und zwei Gespräche versammelnden Hörbuchs »Die gebrannte Performance« zumindest eine Ahnung, wie der 2005 im Alter von nur 47 Jahren verstorbene Kling die Lyriklesung in gehobenes Entertainment verwandelt hat. Mit seinen Gedichten operierte er ohnehin an der Schnittstelle zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Er impfte ihnen rheinischen Dialekt, Rotwelsch und Slang ein, um sie gegen den falschen hohen Ton zu immunisieren. Sprache, die geschriebene wie die gesprochene, müsse eine Spur Straßendreck unter den Fingernägeln haben, so hat Kling selbst einmal gesagt. Und so sollte es auch klingen, wenn er seine Texte aufführte, mal flüsternd, mal brüllend, jedem Konsonanten nachschmeckend, jede Sprechpause ein Cliffhanger, das Gesicht expressiv verzerrt, im vollen Bewusstsein seiner Wirkung.
»Kein Genuschel, bitte«, so lautet der erste von Thomas Klings vier Wünschen für den professionellen Vortrag des Gedichts. Keine Mätzchen und keine Didaktik. Und wer zu faul zum Üben ist, der solle doch bitte den Mund halten und Schauspieler engagieren. »Wunderbare Rampensäue« wie Karl Kraus, Klaus Kinski, H.C. Artmann und Ernst Jandl waren Klings Vorbilder. Männer, von denen man lernen konnte, das Sprechen ernst zu nehmen. Seine Auftritte verstand Kling als Notwehr gegen den verdrucksten Befindlichkeits-Mainstream der 70er Jahre-Lyrik. Der bisweilen aggressiv-sinnliche Vortragsstil war eine Vorwärtsverteidigung der Lyrik gegen die sprachvergessenen Alltagsverseschreiber, gegen die »lahme Inhaltlichkeit« und die »sackartig schlackernde Form« ihrer Gedichte.
Zusammen mit dem Musiker Frank Köllges verwandelte Kling Lesungen in »Sprachinstallationen«. Performance wollte er das nicht nennen, weil ihm der Begriff zu abgenutzt schien. Zwischenrufe waren ihm willkommen, damit er sie geistesgegenwärtig parieren konnte. Nachzulesen ist das im Booklet zur »gebrannten Performance«, das neben Texten von Kling und Zeitgenossen auch wunderbare Fotos der Auftritte versammelt. Eines zeigt den Zwölfjährigen, der, vielleicht auf einer Schulbühne, engagiert Richtung Publikum gestikuliert. Die Aufnahme scheint Klings Erinnerung zu bestätigen, dass er ein »ungeheuer unterhaltsames« Kind gewesen sei. Fast überhören kann man in dem Gesprächsmitschnitt den Zusatz, warum er schon in jungen Jahren so reichlich mit Entertainer-Qualitäten ausgestattet gewesen sei: aus Selbstschutz.
Thomas Kling: »Die gebrannte Performance. Lesungen und Gespräche«. Hg. von Ulrike Janssen und Norbert Wehr, Lilienfeld Verlag, Düsseldorf 2015, 4 CDs und Begleitbuch, 24,90 Euro