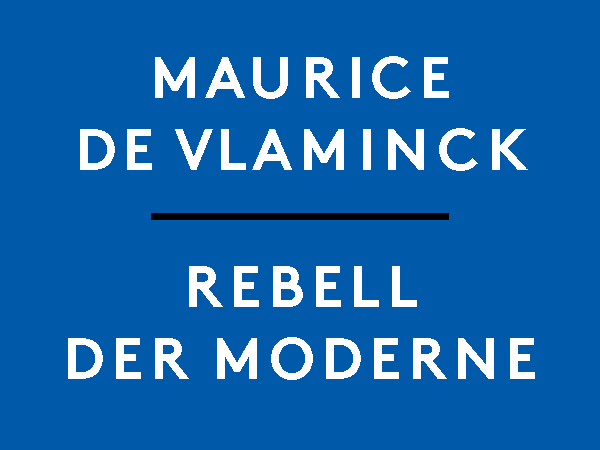TEXT: ANDREAS WILINK
Es muss alles ganz schnell gehen. Romeo Castellucci ist in Eile. Abends steht die Brüsseler Premiere von Glucks / Berlioz’ »Orphée et Eurydice« an; zuvor will auch die New York Times bedient werden, und eine Pressekonferenz wurde vom Théâtre de La Monnaie zudem angesetzt: dem Haus, an dem Gerard Mortier seine europäische Karriere begonnen hat. In dessen künstlerischem Testament, dem Essay-Band »Dramaturgie einer Leidenschaft«, schreibt er: »Das Theater ist eine Religion des Menschlichen«. Was sagt der Italiener Castellucci zu dem Bekenntnis, in dessen Land die Oper mit Monteverdi ihren Anfang nahm? Gewiss. Für sein Theater gelte der Satz ebenso wie für das Theater insgesamt.
Aber es ist eine weltliche Messe. Religion, so Castellucci, erfahre in seiner Sicht keine »mystische Ausdeutung« und habe keinen exklusiven Anspruch. »Es ist nicht gemeint: für Auserwählte. Das Theater ist einer der letzten Orte, die im Sinn des Gemeinschaft-Herstellens und Verbindung-Schaffens religiös sind; ein Ort, an dem man Fragen stellen kann, die aus anderen Bereichen verschwunden sind«. Letzte Fragen. Sie gewähren »Zugang zu eine anderen, nicht fassbaren Dimension«.
Wie in seiner radikal anderen Version des »Orphée«. Eurydice ist bei Castellucci keine mythisch entrückte Kunst-Figur. Der 1960 in Cesena geborene Regisseur holt sich seine Anregung in der Wirklichkeit, beim Gang durch die Welt, in der Beobachtung des Alltags. Aber dann folgt ein enormer Transformationsprozess. Abbildung planer Realität ist seine Sache nicht.
Eurydice heißt hier »Els« und ist eine 28-jährige Koma-Patientin mit dem Locked-in-Syndrom, Mutter zweier Söhne, gelähmt bis auf die Reaktion, die sie mit Augen und Lidern – auch zur Verständigung – ausführen kann. Sie hört, sie sieht, sie riecht, sie fühlt. Aber ist vollkommen bewegungs- und hilflos.
»Was sucht ihr die Lebende unter den Toten?«, kann man mit Jesus von Nazareth fragen.
Castelluccis extremes Performance-Theater, das bei der Triennale vor zwei Jahren mit »Folk« zu erleben war und nun mit zwei Produktionen wiederkehrt – einem besonderen »Sacre du Printemps« und Morton Feldmans »Neither« – mischt die Formen seit Gründung des 1981 mit seiner Schwester Claudia etablierten Kollektivs »Socìetas Raffaello Sanzio«: Bilderstürme aus Theater, Musik, Bildender Kunst, Body-Art, multimedialen Elementen.
Eine Bezugsgröße liegt nahe: Antonin Artaud. Oder? Castellucci bejaht vehement. Artaud (1896–1948) brachte das Theater heim zu seinen kultischen Wurzeln. Ziel des »Theaters der Grausamkeit« ist es, existentielle Grenzerfahrungen zu schaffen, »das Leben zu ergreifen« und jedem einzelnen Betrachter »Traumniederschläge« zu ermöglichen und diese nach außen zu projizieren. Voilà. Besser kann man Castellucis Methode kaum beschreiben. Für ihn ist Artaud nicht nur Autor und Dichter, sondern ein Revolutionär, dessen bedeutende Tat darin bestand, »den Körper auf die Bühne zurückkehren zu lassen«. »Man kann nicht hinter Artaud zurück. So wenig wie hinter Galileo. Eine Tür wurde geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Seit Artaud ist das Theater keine Filiale der Literatur mehr.« Für Castellucci ist eine »ontologische Beziehung« gestiftet.
Zugleich sei die Bühne befreit worden vom »Subjekt«. Doch gleich schränkt er ein bzw. widerspricht, ergänzt und erklärt: vom »Objekt«. Das Ich wird in Castelluccis Theater nicht als psychologisch durchschaubare Größe dem Nutzen zugeführt. Wenn, wird es Bild. Aber das Bild ist unseres. »Es sind nicht meine Bilder. Das ist nicht wichtig.« Auch wenn sie große pathetische Monumente setzen. »Bedeutung hat das dritte Bild, das man nicht sieht. Es liegt ganz in der Betrachtung und Wahrnehmung des Zuschauers.« Das Dritte in der Mitte zwischen den Bildern, die er auf dem Theater kreiert, als Impuls und Initial.
»Mein Theater ist symptomatisch. Ich zeige, was ich vorfinde. Öffne mich für Chiffren.« Therapie und Interpretation wird vermieden. Interpretieren tun die anderen. »Es gibt eine begrenzte Anzahl von Bildern, aber unendliche Kombinationen. Was auf der Bühne passiert, kann der Zuschauer erst später entziffern.« Für sich allein.
Anleitung auch für den »Orphée«. Eurydice wird zu unserem Spiegel. Sie »ruft nach dem Zuschauer«, dekretiert Castellucci. Wir folgen. Folgen dem Gang in die Unterwelt, von wo Orpheus die Geliebte zurückholen will. Eine Kamera begibt sich – jeden Abend live, deren Aufnahmen sich auf die Bühnen-Leinwand projizieren – auf den Weg zu der Patientin. Castelluccis Hades-Fraktur zerlegt die Reise in verwischte Bilder, deren Unschärfe an Gerhard Richters Realitäts-Konstruktion erinnern. Im Klinikflur scheint uns ein schwarzer Tunnel zu schlucken. Oder ist es das schwarze Quadrat des Malewitsch? Lichtflecken erscheinen wie das Hell-Dunkel eines Röntgenbilds. Dann die bestürzende Begegnung mit Els: eine zarte Hand, eine Strähne Haars, der Kopfhörer, der ihr die Oper live überträgt, das Gesicht wie ein Vermeer-Bildnis. Die Kamera streift diskret Erinnerungsgegenstände und -Fotos an den Wänden des Zimmers, gleitet über das fast skulpturale weiche Weiß der Laken. Wie hineinkomponiert in das stationäre Panorama wirkt die singende Eurydice-Darstellerin auf der Opernbühne.
Wir sind auf uns geworfen. Und entwickeln unseren eigenen biografischen Film. Castellucci arbeitet mit christlichem Vokabular. Etwa in seinem als Skandal empfundenem »On the Concept of the Face, Regarding the Son of God« (Über das Konzept des Angesichts bei Gottes Sohn) in Paris: Zum Finale der Szenenfolge über das Demenz-Martyrium eines von seinem Sohn versorgten inkontinenten Vaters, treffen Granaten-Attrappen eine Christus-Ikone und zerstören das Bild des Erlösers nach einem Gemälde von Antonello da Messina. Für den Kunsthistoriker Castellucci, der kurz und bündig sagt: »Das Wort Provokation ist mir nicht bekannt«, ist das Katholische Teil seiner Kultur, von Herkunft und Erziehung und darin hoch komplex. Es gebe auch eine »Körper-Auffassung, die mit dieser Prägung zu tun. Und die Figur Jesu fasziniert mich. Aber die Bewunderung für den Mann aus Nazareth vertieft meinen Konflikt mit der katholischen Amtskirche. Wer mit Liebe die Evangelien liest, kann die Kirche nicht lieben.«
Indes, zu Pier Paolo Pasolini, dem katholischen Kommunisten, Mythologen des Subproletariats und der Raggazzi, hat er keinen Zugang. Schroffe Ablehnung: »Nein, Ich bin weit weg von Pasolini. Er lässt keine Freiheit und Eigenverantwortung. Ich mag das nicht – die Botschaft, Intention, pädagogische Absicht.«
Auf der »Orphée«Bühne im Monnaie steht ein blinkender Computer-Block, ein Lebenserhaltungs-Apparat. Das Mechanische, die Maschine ist in Castelluccis Theater zentral. Auch in seinem Strawinsky-»Sacre«, dieser Inkunabel der Kunst der Moderne, die 1913 mit der Uraufführung durch Nijinskij ein Zeitalter eröffnete. Bei Castellucci tanzen nicht Menschen, sondern Knochenstaub-Partikel. Als würden die Tänzer transformiert (auch der Gedanke des Ahnenkults steckt darin). Die Staubkörner werden von 40 Roboter-Maschinen, die an der Decke hängen, in bestimmtem musikalischen Rhythmus in die Luft gesprüht. Gleichwohl: »Die Idee von Choreografie bleibt erhalten«. Das Material, die Materie, benutzt etwa als Düngemittel und industrieller Rohstoff, symbolisiert die Entfremdung des Menschen von der Natur.
Doch wird nicht der Einzelne, das Mädchen des Ur-»Sacre«, zum Opfer. Castellucci entindividualisiert, auch wenn im Knochenstaub ein »humaner Restbestand« bleibt. Es wird Metapher. So wie bei Eurydice die Krankheit, das Sterben zur Metapher wird. Und Reflexion über den Verfall und das Mysterium des Lebensendes. Und der »Sacre« vielleicht zur Elegie über die Selbstvernichtung der Gattung Mensch, eine Respektbezeugung für die Idee der Natur und ein Fanal gegen die Banalität unserer Zeit.
Konzeptuell Ähnliches geschieht vermutlich in Morton Feldmans Oper »Neither« (Keiner / Weder) nach einem Gedicht von Samuel Beckett? Wiederum ist das Thema die Entfremdung: des Menschen zu sich selbst. Ein paar Zeilen von Becketts kurzem Poem: »von undurchdringbarem selbst zum undurchdringbarem nicht selbst auf dem Weg von keinem« / »wie zwischen zwei hellen Zufluchten, deren Türen einmal angenähert sachte schließen, einmal abgewendet sachte wieder öffnen« Die Schwierigkeit, sein Ich und auch den Anderen zu finden, nennt Romeo Castellucci die »existentielle Falle«. In sie gerät sein Hamlet, sein Orest, Orpheus und Eurydice, der wirbelnde Staub, das poröse Ich in »Neither«. Da mag wohl Gottfried Benn passen: »Es gibt nur zwei Dinge: die Leere und das gezeichnete Ich.«
»Le Sacre du Printemps« 15. bis 17. und 19. bis 24. August 2014, Gebläsehalle, Landschaftspark Duisburg-Nord, Music Aeterna unter Teodor Currentzis.
»Neither« 6., 7., 12., 14., 19. und 20. September 2014, Jahrhunderthalle Bochum; Duisburger Philharmoniker, Eir Inderhaug (Sopran), musikalische Leitung: Emilio Pomàrico. www.ruhrtriennale.de