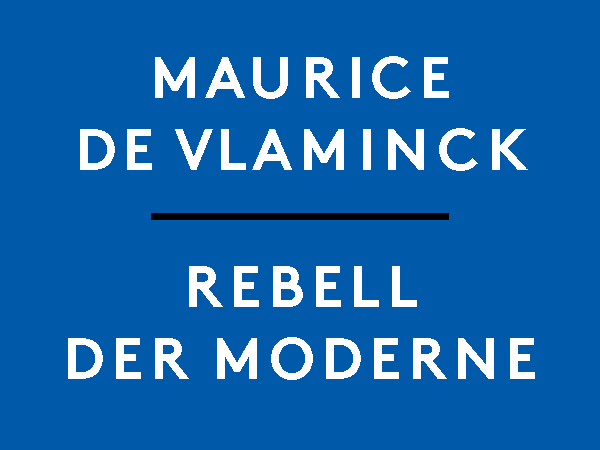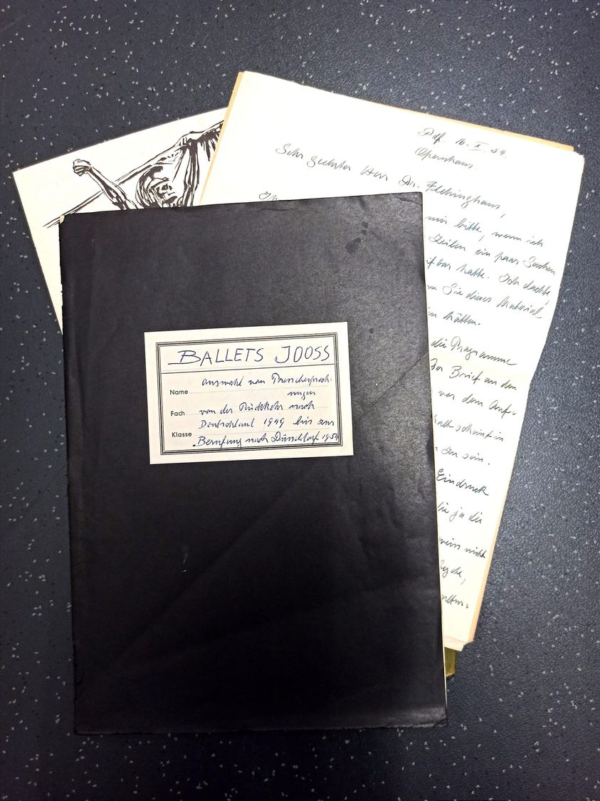Einmal tief ausatmen. Die Hektik hinter sich lassen, die reizüberfluteten Sinne beruhigen. Dann sind wir im Tanzraum von Raimund Hoghe angekommen, einem Raum der Ruhe und Achtsamkeit. Hier gibt es keine einzige überflüssige Geste. Hier herrscht radikale Reduktion – Raimund Hoghe, ein Meister des Minimalismus. Rund 35 Stücke hat er geschaffen, seit er mit Anfang 40 beschloss, auf die Bühne zu gehen. Eine Tanzausbildung? Hat er nicht. Einen Tänzerkörper? Auch nicht. Hoghe tanzt trotzdem, tut es noch immer mit über 71 Jahren und revolutioniert ganz nebenbei Körpernormen, konventionelle Ästhetiken, die Idee vom politischen Tanztheater. Dafür bekommt er nun den »Deutschen Tanzpreis 2020« verliehen. Hoghe kommt gerade aus Montpellier von Proben zur Neukreation seines Stücks »Moments of Young People« zurück. Er hat mehrere Winter-Impfungen hinter sich, ist erschöpft. Ein persönliches Treffen ist nicht möglich, was bedauerlich ist, denn Hoghe hat ein angenehmes Charisma, freundlich, entspannt. Also ein Gespräch am Telefon.
kultur.west: Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Tanzpreis. Wie sehr schätzen Sie das Wort »deutsch« in der Auszeichnung?
HOGHE: Es ist eine Ehrung in Deutschland, darüber freue ich mich sehr, auch weil die Choreografin Gret Palucca die erste Preisträgerin war. Ich habe sie am Ende ihres Lebens getroffen. Das war eine unvergessliche Begegnung für mich, weil sie mit weit über 80 Jahren so lebendig und beweglich im Denken geblieben ist. Aber »deutsch«? Ich habe nie mit Tänzern aus Deutschland gearbeitet, mich interessieren andere Kulturen einfach mehr.
kultur.west: Mit Ihrer Rezeption in Deutschland waren Sie oft nicht zufrieden, in Frankreich war die Anerkennung Ihrer Arbeit größer, da haben Sie letztes Jahr schon den »Ordre des Arts et des Lettres« bekommen.
HOGHE: In meiner Arbeit geht es immer um Schönheit – ein Thema, mit dem sich die Franzosen einfach generell leichter tun, sie gehen angstfreier damit um.
kultur.west: Um welche Idee von Schönheit geht es Ihnen?
HOGHE: Um eine Schönheit, die aus dem Kontrast zur Realität entsteht. Schönheit ist überlebenswichtig für den Menschen, eine positive Kraft. Auf meiner Bühne gibt es schöne Tänzer, schöne Musik, zärtliche Bewegungen. Aber es gibt eben auch meinen Körper, der als nicht-schön empfunden wird. Durch ihn werden die Stücke nie kitschig. Mein Körper ist der Bruch.
kultur.west: Darf ich jetzt sagen: Weil Sie einen Buckel haben?
HOGHE: Natürlich dürfen Sie das. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn ich dann nur noch »der Bucklige« bin und auch noch »kleinwüchsig« genannt werde. Das bin ich nicht. Ich habe eine Rückgratverkrümmung, durch die mein Oberkörper etwa zehn Zentimeter kleiner ist, als er sonst wäre.
Raimund Hoghe wird 1949 in Wuppertal geboren. Eine Kindheit in den 1950er Jahren. Die Rückgratverkrümmung zeichnet sich schon früh ab. Die Ärzte verordnen Kuren für die Lunge, nachts ein Gipsbett und ein Korsett, das scheuert, so dass Raimund Hoghe es bald wieder ablegt. »Lieber ein krummer Rücken als diese Schmerzen«, beschließt das Kind, und Hoghe wird es nicht bereuen. Auch später habe er nie mit seinem Buckel gehadert, sagt er.
HOGHE: Ich habe als Kind keine Ausgrenzung erfahren. Man sagt immer die »spießigen, engen 1950er Jahre«. Aber manchmal denke ich, was den Umgang mit Behinderten angeht, war man damals fast entspannter. Ein Problem war eher, dass ich unehelich war. Eine Schande, damit galt ich als »Bastard«. Deshalb habe ich auf die Frage nach meinem Vater immer gesagt, der sei früh gestorben.

kultur.west: Woher kam das Selbstbewusstsein auf die Bühne zu gehen?
HOGHE: Meine Mutter hat immer an mich geglaubt. Sie war eine starke Frau – wie die Elisabeth in Ödön von Horváths Stück »Glaube, Liebe, Hoffnung«, die sagt: »Ich lasse den Kopf nicht hängen«. Schon als Jugendlicher war ich im Wuppertaler Theater Statist auf der Bühne. Zuerst noch – klischeegemäß besetzt – als buckliger Schneider in Shakespeares »Komödie der Irrungen«. Aber später bekam ich dieselben Rollen wie alle anderen Statisten.
kultur.west: Daher die Liebe zum Theater?
HOGHE: Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war Schneiderin und hat zu Hause für die Frauen aus der Nachbarschaft genäht. Sie war alleinerziehend, der Kontakt zu meinem Vater beschränkte sich auf eine monatliche Überweisung. Mein Großvater wohnte bei uns, ein großer Kinofan. Und meine Mutter hatte ein Abonnement im Theater Wuppertal. Wir haben französische Chansons gehört, meine Schwester »Rhapsody in Blue«, was wir nicht so gern mochten. Aber es gab einfach schon immer diese Sehnsucht nach Kunst bei uns.
Starke Frauen – die Faszination für sie lebt in Hoghes Kunst fort. Die viel zu jung zum Star gereifte Schauspielerin Judy Garland würdigt er in einem Stück, ebenso die Opernsängerin Maria Callas. Dafür schlüpft er selbst in Pumps, Röcke und Kleider, legt Schleier und Handtasche um, markiert mit sparsamen Bewegungen typische Posen der Diven. Er zeigt Glamour-Gesten und selbstzerstörerischen Schmerz. Das Gesicht aber bleibt ungeschminkt. Das blasse, sensible Hoghe-Gesicht.
HOGHE: Ich möchte keinesfalls Travestie machen. Kennen Sie den Butoh-Tänzer Kazuo Ohno? Er hat mich sehr berührt, er konnte Kind oder Greis sein, Mann oder Frau. Ich habe ihn in den 1970er Jahren das erste Mal gesehen.

kultur.west: Ein Vorbild?
HOGHE: Ja, wenn ich drei Künstler nennen müsste, die meine Arbeit prägen, dann sind das: Kazuo Ohno, der Regisseur Pier Paolo Pasolini und Hervé Guibert, ein französischer Autor. Es gibt ein filmisches Selbstporträt von ihm. Da zeigt er seinen ausgemergelten, von Aids gezeichneten, nackten Körper wie er ins Wasser steigt. So etwas hat mir Mut gemacht, auch meinen eigenen Körper zu zeigen.
kultur.west: Jetzt haben Sie bei den prägenden Einflüssen einen Namen nicht genannt.
HOGHE (lacht): Pina Bausch.

kultur.west: Sie waren zehn Jahre lang Pina Bauschs Dramaturg.
HOGHE: Ich habe ihre Kunst sehr gemocht, fand vor allem die starken Tänzerpersönlichkeiten toll. Aber ich arbeite ganz anders als sie, zum Beispiel was den Umgang mit Musik angeht. Bei Pina wurde die Musik meist erst am Ende festgelegt. Bei mir ist die Musik Ausgangspunkt in den Proben. Sie hat nie ein Stück von mir gesehen und ich hatte später keinen Kontakt zu ihr, weil es für sie schwierig war, wenn Mitarbeiter weggegangen sind.
kultur.west: Sie war dann beleidigt?
HOGHE: Vielleicht war es für sie ein Liebesentzug. Es fällt schon auf, dass nur sehr wenige ihrer Künstler eine eigenständige Karriere gemacht haben. Im Gegenteil: Tänzer, die vor 30 Jahren ihren Abschied vom Tanztheater gefeiert haben, sind heute immer noch da. Ich ging in einer Phase, in der sie kein neues Stück machte, das war Ende der 1980er Jahre nach dem Film «Die Klage der Kaiserin«. Bei den Wiederaufnahmen alter Stücke gab es für mich keine Arbeit und ich fing an, Stücke für andere Tänzer zu entwickeln – habe also im Grunde das fortgesetzt, was ich als Journalist bei der Wochenzeitung Die Zeit vor meiner Zeit bei Pina Bausch gemacht habe: Porträts schreiben.
Choreografieren heißt Porträtieren – das Credo gilt bis heute für Raimund Hoghe, das ist schon mit seinem ersten Erfolgsstück klar: »Meinwärts«, eine Hommage an den jüdischen Tenorsänger Joseph Schmidt, der 1933 vor den Nazis aus Deutschland fliehen musste. Damals inszeniert Hoghe das erste Mal seine einzigartige Wirbelsäule, hängt nackt, mit dem Rücken zum Publikum an einer Stange. Verstörend, dieser Buckel, dieser zarte versehrte Körper. Dazu eine irritierend ambivalente Haltung zur Vergangenheit in seinen Stücken: Da ist der Schmelz nostalgischer Musik, so gefühlsgeladen und ohrwurm-verdächtig, dass andere Choreografen sich vor ihr fürchten: Chansons und Schlager der 1950er, 60er Jahre, Charles Aznavour, George Gershwin, Jacques Brel, romantische Walzer. Und zugleich: Immer wieder die dunkelste Phase der deutschen Geschichte. Später ist es die Ausgrenzung von Aidskranken, die Hoghe umtreibt. Und schon vor über 20 Jahren: die Situation von Geflüchteten, das Versagen Europas. Beispiel: Sein Stück »Lettere Amorose« von 1999, das er 2017 neu einstudiert und das jetzt beim Internationalen Solotanzfestival in Bonn zu sehen ist.
kultur.west: Warum die Form des Solos?
HOGHE: Weil es um meine politischen Überzeugungen geht, die kann ich niemandem überstülpen. Ich lese darin etwa einen Brief von zwei afrikanischen Jungen vor, die auf dem Weg nach Europa im Fahrwerk eines Flugzeugs sterben. Der Brief, den man bei ihnen fand, ist aus dem Jahr 1999.

kultur.west: Erschreckt es Sie, wenn Ihre Stücke so aktuell bleiben?
HOGHE: Ich finde es schlimm, dass wir das Schicksal der Flüchtlinge so an uns abprallen lassen. Das geht seit viel zu vielen Jahren so. Das macht mich wütend, traurig, müde.
kultur.west: Trotzdem gehen Sie auch mit 71 Jahren noch auf die Bühne.
HOGHE: Im Moment habe ich noch das Bedürfnis, mit meinem Körper etwas auszudrücken, und vielleicht denkt ja der eine oder andere: Och, wenn der das kann, sollte ich mich auch besser akzeptieren.
kultur.west: Sie sind ein Role Model?
HOGHE: Mir haben auch andere Menschen Mut gemacht, egal ob es Frau Klessa ist, die bei mir um die Ecke noch mit 92 Jahren in ihrem Düsseldorfer Kiosk stand oder Künstler. Wie ich schon früh mit Pasolini gesagt habe: Es gilt den Körper in den Kampf zu werfen. Immer wieder.
Nächste Auftritte von Raimund Hoghe:
17. Oktober: Auszug aus »Canzone per Ornella« bei der Gala zur Tanzpreisverleihung im Aalto Theater Essen, http://www.deutschertanzpreis.de/home/
25. Oktober, «Lettere amorose, 1999-2020« beim Internationalen Solotanzfestival, Schauspielhaus Bonn