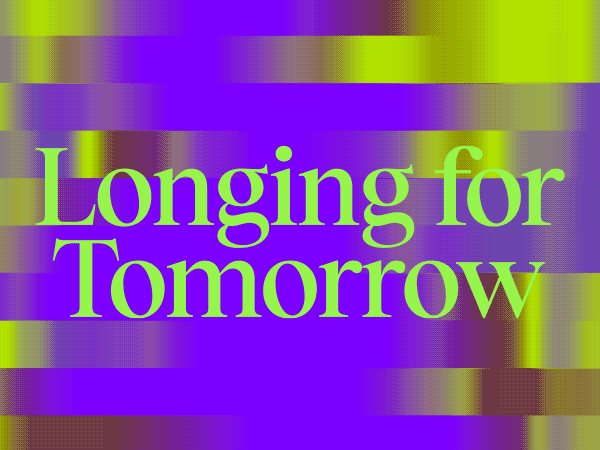Wie kommt die Kunst in den öffentlichen Raum? Welche Rolle spielt sie dort – früher, heute und in Zukunft? Ein Gespräch mit dem Kunsthistoriker Jacques Heinrich Toussaint und Denkmalpfleger André Kölsch, die sich um diese besondere Form in Dortmund kümmern.
kultur.west: Sie haben kürzlich in Dortmund ein Symposium zu der Frage organisiert, welche Rolle Kunst im öffentlichen Raum in Deutschland spielt – was kam dabei heraus?
TOUSSAINT: In den 1980er und 1990er Jahren hat vor allem der Ankauf oder die Produktion von Kunstwerken im Stadtraum im Vordergrund gestanden. Heute stehen die Kommunen eher vor der Herausforderung, sich um die Erhaltung, Kontextualisierung und Reaktivierung des Bestandes zu kümmern – und dies unter schwierigeren Haushaltsbedingungen als in der Vergangenheit. Obwohl einige Städte wie Düsseldorf, Stuttgart oder München kommunale Modelle für einen zeitgemäßen Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum entwickelt haben, scheinen die Bedingungen für Künstler insgesamt ungünstiger zu werden.
kultur.west: Woran liegt das?
KÖLSCH: Das liegt an mangelnden personellen und finanziellen Ressourcen auf Seiten der Verwaltung, aber auch an der zunehmenden Verknappung und Kommerzialisierung des städtischen Raums sowie an Entwicklungsprozessen, in denen das Kunstwerk als bloße Dekoration betrachtet wird.
TOUSSAINT: Dass mit künstlerischen Mitteln im Stadtraum dennoch produktive Irritationen erzeugt werden können, zeigen zum Beispiel Künstler wie Mischa Kuball, der zuletzt etwa einen Gedenkort für die Düsseldorfer Synagoge geschaffen hat. Zu den Entwicklungen, die wir im Rahmen des Symposiums identifiziert haben, gehören auch die Etablierung von Institutionen und Programmen, die auf überkommunaler Ebene agieren, wie Urbane Künste Ruhr oder das Förderprogramm Stadtbesetzung, aber auch kollaborative Konstellationen. Ein Beispiel hierfür ist die Initiative Neue Auftraggeber, die Kunst im Bürgerauftrag initiiert.
kultur.west: In den Städten ist unterschiedlich geregelt, wo die Kunst im öffentlichen Raum verwaltet wird. Die Herausforderungen sind allerdings ähnlich – die Werke müssen überall dokumentiert und gepflegt werden und das kostet zunächst einmal Geld. Gibt es da überhaupt Ressourcen, neue Werke in Auftrag zu geben?
KÖLSCH: In der Tat stehen heute weniger Mittel zur Verfügung als noch vor einigen Jahren und man könnte vielleicht etwas überspitzt behaupten, dass sich nur jene Städte temporäre Kunstprogramme leisten oder neue, anspruchsvolle Kunst realisieren können, die Kunst im öffentlichen Raum mit einem festen Prozentsatz des öffentlichen Baubudgets finanzieren. Häufig werden Kunstwerke im Stadtraum aufgestellt, die nicht angekauft wurden, sondern Leihgaben oder gar Schenkungen von Privatpersonen oder Vereinen sind. Gerade hier sind öffentliche Körperschaften und Unternehmen gefordert, professionell und unabhängig zu agieren, damit der öffentliche Raum nicht zur Spielwiese einiger weniger Akteure wird, die den eigenen Geschmack der Öffentlichkeit oktroyieren.

kultur.west: In Köln hat kürzlich der Beirat für Kunst im öffentlichen Raum seine Arbeit frustriert niedergelegt, weil seine Empfehlungen kaum berücksichtigt würden – was können solche Gremien überhaupt leisten?
TOUSSAINT: Ein unabhängiges und vielfältig besetztes Gremium ist aus meiner Sicht notwendiger denn je, um Politik und Verwaltung zu beraten, aber auch, um ein aktuelles Bild davon zu bekommen, was die Kunstschaffenden im Stadtraum gerade interessiert.
In der repräsentativen Demokratie kann es vorkommen, dass die Entscheidungsträger den Empfehlungen eines Beirats nicht folgen, das ist bei Kunst im öffentlichen Raum nicht anders als bei anderen Themen. Gerade deshalb haben fortschrittlichere oder progressivere Beiräte oder Kommissionen auch ein auf Handlungsfähigkeit ausgerichtetes Statut mit Entscheidungskompetenzen und finanziellen Ressourcen. Das ist auch unser Ziel für Dortmund.
kultur.west: Es gibt in NRW immer wieder interessante Projekte, die Kunst kurzzeitig in die Stadt bringt, etwa von Markus Ambach, der schon einige Projekte in der Düsseldorfer Innenstadt umgesetzt hat. Was ist der Reiz des Temporären? Viele Eingriffe ins Stadtbild verschwinden schließlich ja wieder.
TOUSSAINT: Kunstausstellungen oder temporäre Projekte ermöglichen es, den städtischen Raum neu oder aus einer anderen Perspektive zu sehen und gleichzeitig der Logik zu entgehen, dass man nach einer gewissen Zeit nicht mehr wahrnimmt, was man tagtäglich vor Augen hat. Allerdings muss man sich davor hüten, sich unkritisch an einer Festivalisierung der Stadtpolitik zu beteiligen. Die Projekte von Markus Ambach entziehen sich dieser Logik, sowohl was das Format als auch die präsentierten Inhalte betrifft. Besonders interessant finde ich es, wenn temporäre Arbeiten, die sich bewährt haben, verstetigt werden, wie es in einigen Fällen nach den Ausgaben der Skulptur Projekte Münster geschehen ist oder wie es mit den Arbeiten geschehen ist, die jetzt den Emscherkunstweg bilden.
kultur.west: Herr Kölsch, wir leben in einer Welt der Krisen – welche Rolle spielen da Denkmäler?
KÖLSCH: Das Interesse an Denkmälern ist heute sehr groß und es scheint ein Bedürfnis zu existieren, durch sie aktuelle Sachverhalte sichtbar zu machen, auch zu denjenigen, die vielleicht früher zu wenig beachtet wurden. In Dortmund arbeiten wir gerade zum Beispiel an einem Denkmal für die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in der Stadt.
Inwiefern sind die Dortmunder Bürger*innen an dem Denkmal beteiligt?
KÖLSCH: Sie können bei einem Vermittlungsprogramm ihre Wünsche, Ideen, Vorschläge und Gedanken äußern. Die Ergebnisse wurden bereits jetzt von den Beiratsmitgliedern für die Entwicklung des Ausschreibungstextes des aktuell laufenden Kunstwettbewerbs genutzt.
kultur.west: Denkmäler stehen für bestimmte Zeiten und Werte. In Gelsenkirchen und Wuppertal gibt es Überlegungen, Denkmäler oder Kunstwerke, die an die NS-Zeit erinnern, künstlerisch umzugestalten. Was halten Sie von solchen Vorhaben?
KÖLSCH: Es ist wichtig, dass wir uns mit der Vergangenheit Deutschlands auseinandersetzen und diese Objekte als Zeitzeugen be- und hinterfragen. Daher ist die künstlerische Kommentierung oder Umgestaltung dieser Objekte aus meiner Sicht durchaus begrüßenswert, da sie den Denkmälern und Kunstwerken eine neue Sichtbarkeit verschafft und hierdurch die öffentliche Diskussion weiter anregt.

Dr. Jacques Heinrich Toussaint hat Kunstgeschichte in Münster und Paris studiert und über Kunst im öffentlichen Raum in Deutschland und Frankreich promoviert. Seit 2022 leitet er das Ressort Kunst im öffentlichen Raum am Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund.

André Kölsch hat Kunstgeschichte, Musikwissenschaft und Denkmalpflege in Bonn und Bamberg studiert. Seit 2023 ist er Volontär am Ressort Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Dortmund.
2025 erscheint ein Buch über die Kunst im öffentlichen Raum in Dortmund im K-West Verlag.