Irrtum. Er ist kein Kölsche Jung. Aber wurde es und fühlte sich auch als solcher, obwohl er ebenso Hamburger, Berliner, Wahl-Italiener (mit Wohnsitz in Umbrien) und Weltbürger war. Die Erinnerungen von Jürgen Flimm, der im Nachkriegs-Köln aufwuchs, das Kölner Schauspielhaus glänzend geleitet und viel später die Ruhrtriennale von Gerard Mortier geerbt und am Kulturhauptstadtjahr im Revier mitgewirkt hat, mussten einfach in einem Kölner Verlag erscheinen. Ein Jahr nach seinem Tod hat Kiepenheuer & Witsch »Mit Herz und Mund und Tat und Leben« veröffentlicht.
Der Text der den Titel gebenden Kantate spricht vom Bekenntnis des Glaubens, vom Zeugnis-Ablegen »ohne Furcht und Heuchelei«. Glauben an was? An die Wirklichkeit der Kunst. Sie verspürt der 1941 in Gießen geborene Arztsohn, wenn er in der Aula der Albertus-Magnus-Universität in Lindenthal (der Konzertsaal ist noch nicht wiedererbaut) Bachs Matthäus-Passion hört, besonders die Choräle: »Ich will hier bei Dir stehen …« Ein Treuegelöbnis.
Der Protestant, der im heiligen Köln und im katholischen Salzburg sowie im evangelischen Hamburg (Thalia Theater) und Berlin (Staatsoper Unter den Linden) Intendant sein wird, weiß das. Jürgen Flimm sagt es mit universalem Anspruch: »Herz und Mund und Tat und Leben«. Die vita activa kommt in der Formel mehr zum Ausdruck als das Reflektierende der Innenbeschau. Man könnte es auch Geschäftigkeit nennen. Boy Gobert, einer seiner frühen Förderer, rät dem aufstrebenden Regisseur: »Jürgen, tummel dich.« Der folgt der Aufforderung.
Was Flimm beschreibt, sind Verwandlungen. »Im Theater passiert alles zum ersten Mal« (die Einsicht schenkt ihm ein früherer Direktor des Burgtheaters) – immer wieder. Die Wandlungen beginnen in Köln bei Günter Wand und dem Gürzenich Orchester, um sich sehr viel später zu den Bach-Deutungen von Nikolaus Harnoncourt, dem Freund, zu entwickeln. Überhaupt, fragt sich der Leser nicht selten, ob Flimms Favoritin nicht eher die Oper ist, hinter der die Schauspielkunst zurücksteht.
Der Knirps betreibt sein eigenes Puppentheater, spielt das Hänneschen für die Familie und Bekannte. Der Student der Germanistik, Theaterwissenschaft und Soziologie, der »hochinfizierte« Zeitgenosse besucht parallel eine private Schauspielschule, beginnt schon zu spielen und zu inszenieren, bevor er in München Assistent bei August Everding und Hans Schweikart wird. Start für einen Marathon.
Guiness-Buch fürs Theater
Moralisch beruft er sich auf die Exilierten und auf seinen Schullehrer, der ihm Paul Celan, Brecht und die Neue Musik nahegebracht habe und freies Denken in der restaurativen Adenauer-Republik. Wie die gesamte Generation ist Flimm hungrig nach der vorenthaltenen geistigen Nahrung. Er inhaliert die Avantgarden der sechziger Jahre – Stockhausen, Bernd Alois Zimmermann und Klaus Doldinger, Dieter Wellershoff und die Valente und wer sich sonst beim WDR die Klinke in die Hand gab. Er hört den anderen Klang, die neue Sprache und »tobende Unordnung« der Welt in Bild und Ton. Erkundet die Kunstszene mit Fluxus, Beuys, Nam June Paik… Und das Kino der Nouvelle Vague, des italienischen Neorealismus, des amerikanischen Gegen-Hollywoods.
Mit Fassbinders »Bremer Freiheit« an Boy Goberts Thalia Theater 1971 beginnt der Erfolg. Manchmal drängen sich auf einer Buchseite 20 und mehr Namen. Die Fülle ist beeindruckender als das Einzelne. Das Resümee hat auch etwas von einem Gotha und Guinness-Buch fürs Theater (leider fehlt ein Register am Ende des Bandes). Ganz nebenbei erfahren wir, dass Flimm mehrfacher Vater ist, en passant erwähnt er seine »Eitelkeit«, bleibt aber im Persönlichen schmallippig. Allein im Epilog legt er die Wunde offen, den Riss in seinem Leben: den Tod des Neugeborenen Benjamin im Jahr 1973. Da treffen sich Anfang und Ende im Bild des Kindes und wohl auch im Empfinden einer schuldlosen Schuld.
Der 68er und Jungsozialist in Lederjacke nährt auf der symbolischen Ebene in sich den Vatermörder, um selbst zum Patron zu werden. Die Revolte war nicht anarchisch gesonnen, sie war auf In-Besitznahme der Throne aus. Flimm hat ein halbes Jahrhundert später zum Millennium-Wechsel in Bayreuth Wagners »Ring« inszeniert, der davon erzählt, dass Macht und Liebe sich ausschließen. Wenn das die Alternativen sind, scheinen sie im Theaterbetrieb auch zur Symbiose geraten zu können. Flimm wurde ein Souverän im Theater-Imperium, der unter anderem in Zürich, an der New Yorker Met und sogar in Peking (»Woyzeck«) inszeniert, die Ruhrtriennale von ihrem Gründer Gerard Mortier erbt, Salzburg managt, Kulturpolitik etwa als Präsident des Bühnenvereins mitsteuert und der Toskana-Fraktion der SPD ein Genosse ist.
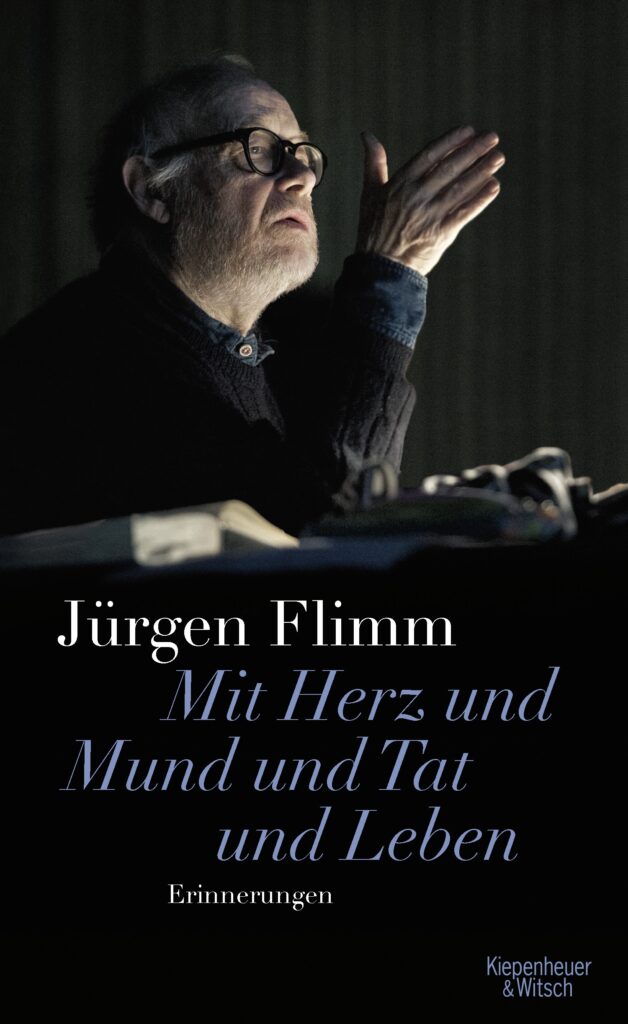
Köln ist seine erste glückhafte Intendanz. Das Schauspielhaus am Offenbachplatz öffnet er ganz weit in die Stadt hinein, initiiert das »Theater der Welt«-Festival mit Ivan Nagel und richtet die erste große Pina-Bausch-Werkschau aus. Er engagiert Luc Bondy, Jürgen Gosch, George Tabori und schon Bob Wilson und findet sein herrliches Ensemble, darunter Ingrid Andree und Hans Christian Rudolph, um nur zwei von so vielen zu nennen. Unvergessen, wie er Jerôme Savary für ein Spektakel in die Metropole des rheinischen Karnevals holt, ein Zelt zum Spielen aufschlagen lässt. Wie er Willy Millowitsch verpflichtet (und ihm einen wunderbaren Nachruf widmen wird), den »Filmdose«-Antistar Walter Bockmayer in die Hochkultur hievt und nebenbei das Stollwerck-Fabrikgelände gegen Stadt und Geschäftsinteressen ‚besetzt’.
Die darauf folgenden 15 Jahre an der Alster, die er mit beseligter Wehmut betrachtet, steigern noch das Hochgefühl. Eine seiner Tugenden als Intendant war es, Regisseure zu verpflichten, die ihn, wenn nicht in den Schatten stellten, so doch in ihrer Strahlkraft überboten. Und weil sich niemand gern selbst dem Zwielicht preisgibt, schminkt Flimm auch mancherlei schön – so seine Rollen an der Ruhr und an der Salzach. Dass er ganze acht Seiten dem fast gestrauchelten Welterfolg des »Black Rider« von Burroughs, Waits und Wilson widmet, zeigt, wie er aus dem Beinahe-Scheitern noch das triumphale Gelingen hervorholt.
Ein Lebensbericht als Langlauf im Schnelldurchlauf: Flimm zieht die Asse aus dem Ärmel, lässt es schwirren, macht kleine und große Sprünge und markiert Bezüge, wenn beispielsweise die frühe Erfahrung mit Zimmermann und Jakob Michael Lenz fruchtbar bleibt, bis er als Chef der Ruhrtriennale von 2005 bis 2008 »Die Soldaten« mit Wucht in die Bochumer Jahrhunderthalle bringt, mit Regisseur David Pountney. Seinen Spielplan an der Berliner Staatsoper wiederum bestückt er mit einer stattlichen Zahl an Komponisten der Moderne und Zeitgenossen.
Erzählen kann er, aber verplaudert sich auch. Tiefenschärfe kommt etwas zu kurz. Umso schöner, wenn er in die Herzkammer eines Stücks vordringt, eine Bühnenbild-Phantasie vor uns errichtet, Personen mit wenigen Strichen zeichnet, eine Stimmung aufruft. Jürgen Flimm, leutselig, gewieft und gesellig, war mehr Bejaher als Verneiner, ein Genie der Freundschaft und ein Genussmensch, womit er nahezu ins Römisch-Katholische konvertiert – was auch sonst im Schatten des Doms. Die Kunst ist ihm ein Glück und ein Vergnügen, das Leben ein Fest gewesen.
Jürgen Flimm, »Mit Herz und Mund und Tat und Leben«, Erinnerungen, Vorwort von Sven Eric Bechtolf, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024, geb., 349 S., 26 Euro.












































