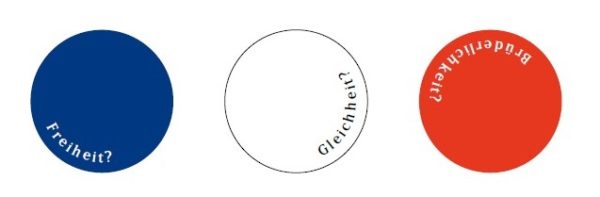Von weither, dem Endpunkt des Dramas, holt sich die Bochumer Fassung (Übersetzung: Miroslava Svolikova), in der Johan Simons den »King Lear« inszeniert, ihren knappen Prolog. Nicht mit der herrischen Reichsteilung, vielmehr mit dem Eingeständnis der Schwäche setzt die Aufführung an: »Bitte, lacht nicht über mich: / ich bin ein alberner und altersschwacher alter Mann. Und wohlmöglich auch nicht ganz bei Sinnen.« Aber ein heller Wahn ist um Pierre Bokma, Überlegung, Besinnung und Besonnenheit ihm nicht fremd, eher schon zu fühlbar nahe. Dieser Lear – von einem Atemzug zum nächsten ganz da und diesseits und ganz in sich versunken, kaltblütig beherrscht, selbstreflektiert und außer sich – erfährt seine Selbstwerdung im Angesicht des Todes als dem Moment absoluter Negation.
So kann dann mit der Gütertrennung an die Töchter, die Lear mit klarem Feuerkopf vornimmt, das Blutspiel um Krone und Vormacht beginnen und nach drei Stunden enden: als Leichenbeschau hingestreckter Leiber. Doch auch für den letzten Überlebenden gilt: Es ist »eine Frage nur von Fristen«, wie der brave Gloster-Sohn Edgar sagt.
Lichtwechsel verwandeln Johannes Schütz’ Bühne in strukturierte Räumlichkeit. Hinter einem aufgeschütteten Erd- und Grabhügel zieht sich eine hölzerne Wand mit sechs eingeschnittenen Öffnungen hoch. Durch sie schauen wir auf eine büromäßige Teeküche, die eine Kamera observiert und für uns Zuschauer gegenläufig projiziert. Überhaupt hat sich das feudale Drama protestantisch verbürgerlicht. Selbst der abgefeimte Bastard Edmund (Patrick Berg), der böse Mund der Wirklichkeit von gestern und heute, trägt seinen höfischen Hut wie ein ironisches Accessoire. Ansonsten ist er Mittelstand. Moderat rabiat. So wie die anderen, Angestellte im Unternehmen England, betrachtet aus der Perspektive der Republik, die ihre Tücken auch haben kann. Dazu ein Soundtrack, dessen Brausen weniger Windstärken als die PS von Autobahngeräuschen zu sammeln scheint.
Auf der Heide tosen auch nicht die Elemente. Die Natur hat sich eingehegt ins Innere des Menschen. Der Sturm bleibt Sprechakt. Das Drama ist Diskurs. Auf einen Schlag färbt sich die Welt schwarz-weiß, wir sehen sie so mit dem nun geblendeten Gloster. Der großartige Steven Scharf, der die politische Kultur einer Großen Koalition bis hin zur schneidenden Sachlichkeit verkörpert, findet in sich die Qual der Kreatur. Schmerz reicht immer zurück ins Archaische und Archetypische. Aus dieser Traumzeit hat sich Glosters verstoßener Sohn Edgar (Konstantin Bühler) seine Camouflage als nackter und bloßer »Armer Tom« herübergeholt und sie zu seinem zweiten und wohl gar eigentlichen Wesen gemacht.
Die schwarz-weiß gemaserte Welt jedoch ist reicher, als die vorherige buntere, in der Anna Drexler ein aufmüpfiges, hüpfendes und türenknallendes Public-School-Girl Cordelia war, die nach dem Alten mit einer Handvoll Mutterboden schmeißt, und zugleich als Narr hibbelig und kiebig irrwischte. Die Schattenmänner Lear und Gloster leuchten in diesem Dunkel in ihrem noblen Leid. Was während Simons’ Regie-Radikalkur passiert, geschieht indirekt: auf Abstand. Wenig mehr kann derart harsch sein wie dieses Distanz-Einziehen, das beißend herbe, theatral sich aushungernde, epische und statische Leben zum Tode. Jeder stirbt für sich allein.
8. und 9. Oktober, Schauspielhaus Bochum, www.schauspielhausbochum.de