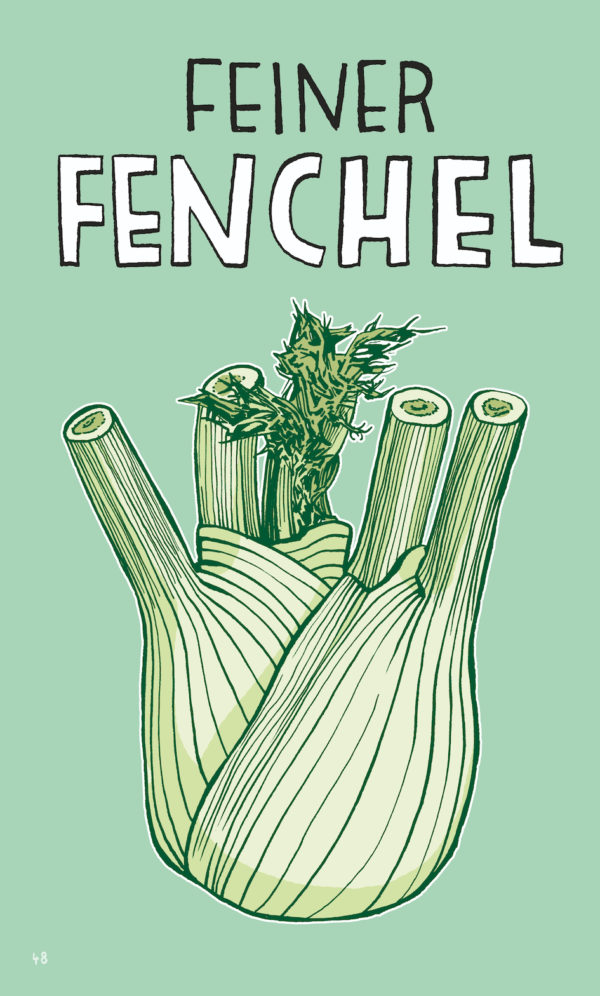TEXT: ANDREAS WILINK
Christian Petzold verbindet mit Helmut Käutner eine widerspenstige Haarlocke. Es ist das zarteste Band, das sich denken lässt. Die in die Stirn fallende Haarsträhne gehört Hannelore Schroth; der, der sie ihr sacht wegpustet, ist Carl Raddatz. Die Szene, eine der glücklichsten im deutschen Kino, hat Helmut Käutner gedreht für »Unter den Brücken«. Gerade auch für diese Schiffer-Romanze von 1944, die nichts von Durchhalten oder Untergehen, von Hurra, Heil oder »Hoppla, was kostet die Welt« wissen wollte, sondern sich an den kleinen Dingen, dem Innigen dreier Menschen gut tut, ihrer Freundschaft und Liebe, wurde Käutner mit dem Prädikat »Poetischer Realist« ausgezeichnet. Die lyrisch weiche Stimmung schafft ein Idyll (aber kein falsches) und weist ins Utopische als dem Vorschein einer möglichen Zukunft.
Petzold, der am 22. März den mit 10.000 Euro dotierten Helmut-Käutner-Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf erhält, kann wunderbar erzählen von diesem Film. Öffentlich tat er es schon in Michael Althens & Hans Helmut Prinzlers Filmgeschichts-Dokumentation »Auge in Auge«. Die Jury erkennt in Petzold dank seiner »Kunst, unbestechlichen Realismus mit psychologischer Tiefenschärfe zu verschmelzen«, einen »herausragenden Erben« Käutners. Es waren dessen »Desertationsfilme«, neben »Unter den Brücken« noch »Romanze im Moll«, die Petzold sah, als er selbst in Berlin angekommen war, dieser »grauenhaften Stadt in ihrer Tristesse Anfang der achtziger Jahre«, und in einem Hinterhof wohnte, mit einer Zigarettenreklame gegenüber vom Fenster.
Seit dem Jahr 2000 mit dem Kinofilm-Debüt »Die innere Sicherheit« hat Petzold neben Fernsehproduktionen fünf Spielfilme – einer besser als der andere – gedreht: »Wolfsburg«, »Gespenster«, »Yella«, »Jerichow« und 2012 den Silbernen-Bären-Gewinner »Barbara«. Er verlange von seinem Metier, sagt Petzold, »dass man Filme macht, die etwas gesehen haben, was hier stattfindet. Filme zu machen, wie Alexander Kluge über Deutschland schreibt«. Wobei Petzold, ähnlich wie Kluge, seine Sätze gern mit kurzem »ja« beendet – halb insistierend, halb freimütig Zustimmung oder Widerspruch herausfordernd.
»Eine Erzählung braucht die Krise«, weiß er, bedingt durch äußere Umstände oder innere Zustände. Sublim verbinden seine Filme das eine mit dem anderen. Musterhaftes Vorbild dafür, zusätzlich spannungsgeladen durch die persönliche Beziehung des Regisseurs und seines Stars, sind für ihn Roberto Rossellinis und Ingrid Bergmans »Stromboli« und »Viaggio in Italia«. »In diesen beiden Filmen ist das ganze Kino enthalten.«
HEIMATFILME IN GEIWSSER WEISE
Petzold hat Gespür für Nuancen, Genauigkeit, Stimmigkeit. Etwas, das so oft fehlt bei uns. Jede Krise verlange eine andere Sprache und Form, ihr eigenes Tempo, bestimmten Rhythmus, bringe eine andere Körperlichkeit hervor, sagt Petzold. »Wie liebt man sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort, was bewirken Region, Abstammung, Klasse, historische Situierung?« Für »Barbara« hätten sie sich etwa Bogart und Bacall in »To Have and Have Not« von Howard Hawks angeschaut und entdeckt, wie dieses Paar seinen eigenen Code kreiert und zu neuen Subjekten erwacht.
Über Petzolds Filmen steht emblematisch: D wie Deutschland. In gewisser Weise sind es Heimatfilme, westdeutsche, ostdeutsche, gesamtdeutsche, gedreht in »Respektdistanz«, aber nicht ohne »von den Figuren infiziert« zu werden. Da bleibt die Spur des Dokumentarischen lesbar – Petzold war Assistent von Harun Farocki und Hartmut Bitomsky –, auch in der filmischen clarté. »Hinter der Klarheit ist Komplexität, ohne dass die Kamera sich unbedingt wild bewegt und komplex geben muss, während sie gleichwohl Ordnung schafft«.
Wo in dem Epochefilm »Deutschland im Herbst« von 1978 Esso-Fahnen und Mercedes-Sterne über Stuttgarts Staatsakt für Schleyer hängen und die Kamera am Chrom der Karossen entlang läuft, steht bei Petzold – eine Generation später – unsere Flagge vor grauem Himmel und Mercedes-Limousinen werden auf dem Laster transportiert. Petzold ist ein Geisterbeschwörer der Gegenwart. In keinem seiner lupenreinen, kondensierten, offenen Filme (»Man muss Reste lassen«) verdienen die Figuren den Namen Gespenster mehr als in »Yella«, der ganz aus Phantomschmerz gemacht scheint. Yella kommt nach einem Unfall in einem anderen Leben an, das sich wattig anfühlt. Momente der Irritation, als stünde die Welt still oder liege vakuumverschlossen – menschenleer, lautlos, unwirklich. Nur das Rauschen der Blätter, das Krächzen von Vögeln tönt wie Botschaft. Die Buchhalterin aus Wittenberge trifft in Hannover den Kredit-Finanzier Philipp, der sie anheuert, um als Bilanz-Expertin lukrative Konditionen für Darlehen auszuhandeln. Ein Zocker-Paar und Erfolgs-Team: Nina Hoss und Devid Striesow schlagen Feuer aus der Sprödigkeit und Kargheit ihrer Charaktere, die Schutzwände um sich errichten, zögerlich Deckung aufgeben, Risse in der Oberfläche erkennen lassen.
Fassbinders Generalthema, dass sich Geld, Glück und Gefühl ausschließen, bekommt bei Petzold zeitbedingte Qualität. Seine Filme sind Untersuchungen über die größer gewordene Bundesrepublik – wie zuvor die des Regisseurs von »Martha« über »Maria Braun« bis »Veronika Voss«. Petzold selbst zieht die Parallele zu RWF. Dass zwei seiner Filme schlicht den Namen einer Frau im Titel führen, unterstreicht es noch.
DIE INNERE SICHERHEIT
Petzolds »Die innere Sicherheit« über die Spätfolgen des RAF-Terrorismus erzählt davon, dass das Gespenst der Freiheit ein Vampir ist. Eine Studie darüber, wie man zu dem wird, was man selbst bekämpft – noch ein Fassbinder-Motiv. Ausübung von Kontrolle, die Mechanik der Gewalt und familiärer Autorität im Dreieck von Mutter (Barbara Auer), Vater (Richy Müller) und Tochter (Julia Hummer), die ein eigenes Leben will jenseits von Angst und Verstecken-Müssen. Für Petzold meint Autorität »Verfestigung und Macht, und wenn das Kino die Krise als Thema hat, dann die Krisen der Macht und der Verhältnisse«. Wieder zieht sich eine Linie zu Käutner, dem Regisseur des »Hauptmanns von Köpenick«.
Die Eltern Petzold kamen Ende der 50er Jahre als Flüchtlinge von »drüben«. Der Sohn wurde in Hilden geboren, wuchs auf in Haan – im »Reihenhaus-Wahnsinn« – und bekam auch dort Abgrenzung der Eingesessenen zu spüren. 1981 zog er zum Studium nach Berlin. Bei ihm leuchtet der Westen nicht. Obschon er weiß, dass für seine Eltern die Bundesrepublik eine Zeitlang die Farbe Orange bedeutete – das Orange der SPD und der Olympischen Spiele 1972. Sohn Christian schickt versehrte Männer und Frauen wie Yella, Laura und Leyla in die Welt, lässt sie in Berlin, Stuttgart, Wolfsburg sein, aber kaum zuhause sein: außer in »Körperland«, wie er sagt. Im deutschen Film des kurzen tausendjähriges Reichs und seiner anschließender Kontinuität sah man »kein Licht und keine Sinnlichkeit«. Bei Käutner indes konnte man »fühlen und schmecken«.
»Wir können die alten Lieder nicht mehr singen«, sagt Petzold mit einem Titel von Franz-Josef Degenhardt. »Es gibt keine Unschuld und Leichtigkeit mehr« nach der Bruchstelle 1933/1945. Vorher schon. Petzold erwähnt den Weimar-Touch-Film »Menschen am Sonntag«. Davon etwas wiederzufinden, sei nur in einem ganz kleinen Raum, einer Blase möglich. Intimität und »Regionalisierung«. Sein neuer Film wird, in Berlin zur Stunde Null, von einem befreiten KZ-Häftling (Nina Hoss) erzählen, und dem Versuch, die verlorene Heimat zur rekonstruieren.
Ökonomie der Mittel, makellose Bildsprache und szenische Komposition finden ideale Korrespondenz in Nina Hoss’ reserviertem Spiel. Sie gehe »durch die Filme wie durch ein Exil«, hat Petzold über seine bisher fünfmalige Heldin gesagt. »Sie erarbeitet sich die Fremdheit einer Figur. Und genießt diese Fremdheit. Genießt es, aus der Reihe getanzt zu haben.« Wie Barbara, die gegen das Armselige der bereits zerfallenden DDR-Verhältnisse ein ästhetisches, moralisches, soziales und politisches Veto setzt. Sie stemmt sich gegen das System und sein Kollektiv, aber auch gegen den Talmiglanz des Westens mit seinen Rollenbildern – wie gegen den beständig wehenden Ostsee-Wind beim Fahrradfahren.
Systeme zum Einsturz oder wenigstens zum Tanzen bringen, gefällt Petzold, der als Simenon-Leser findet, dass das Gefühl von »Trostlosigkeit eine gute Haltung« sei. Für dessen Romane wie für Petzolds Filme gilt: »Das Geschehen läuft ohne einen ab, aber man ist Teil davon und nimmt Einfluss darauf. Spürbar bleibt die eigene Anwesenheit.«
BARBARA
Da ist die Schönheit der Prignitz. Als wehrte sich die Landschaft gegen ihre sozialistische Kultivierung. Dass der Gefühlsraum hüben wir drüben leer sein kann, Hoffnungen nicht nach Grenzen verlaufen, davon erzählt Petzold, der Sammler von Partikeln, Variablen, Möglichkeiten. So kann auch Ostdeutschland, neun Jahre vor dem Mauerfall wie in »Barbara«, Freiraum schaffen. »Hier kann man nicht glücklich sein«, sagt Barbara zunächst. Das betrifft alle Petzold-Figuren – überall. Bis zu »Barbara«. Die Kinderärztin hatte einen Ausreiseantrag gestellt, der mit Haft und Versetzung von der Berliner Charité nach Mecklenburg-Vorpommern geahndet wird. Während sie dem Dienst am Menschen nachgeht und funktioniert, verschließt sie sich gegenüber ihrer Umgebung und der Atmosphäre aus Überwachung und demütigender Kontrolle. In ihrem Klinikchef André (Ronald Zehrfeld) trifft sie jemanden, der in seiner herzlichen Offenheit Vertrauen rechtfertigen könnte, Respekt, Zuneigung und Liebe.
Bei einem Schriftsteller würde man von Poeta doctus sprechen. Petzold ist ein sehr belesener Künstler, der mit Adorno und Proust, Simenon oder Tschechow, Murnau, Rossellini, Hawks und vielen mehr (wir lassen ungerechtfertigt Musik und Bildende Kunst unerwähnt) in lebendigem Austausch steht. Ihre Werke sind ihm Partner für ein unendliches Gespräch. Aber, berichtet er lachend über seine langen Film-Vorbereitungsphasen im Team: »Wir haben auch eine Menge Spaß ohne das Gelesene in der Bibliothek«, als die er sein Büro im selben Haus in Kreuzberg eingerichtet hat, wo er auch mit der Familie wohnt.
Ein reflektierter Regisseur, kein naiver. Wohl kennt er die Sehnsucht danach, die er mit Kleists »Marionettentheater« beantwortet: Dass man einmal um die Welt müsse, um einen zweiten Zugang zum Paradies der Unschuld zu finden. Überhaupt: »Das Reisen ist eine tiefe Bewegung des Kinos.« Seine Filme sind auch Road Movies, gedreht von jemandem, der mit dem Rauschen der A 46 von Düsseldorf nach Wuppertal aufwuchs: Wir sehen Kreuzungen, Landstraßen, Autobahnen, Verkehrswege, Zugstrecken. Einst ein romantisches Motiv, zeigt das Unterwegs-Sein von Benno Fürmann in »Wolfsburg« und »Jerichow« oder von Philipp und Yella, dass sie sich an einem Punkt befinden, an dem sich die Richtung ändern könnte. Lebensentscheidend.
Sie sind Reisende durch eine Gegenwart, deren Natur einen zur Tränen rühren kann und deren Asphaltdschungel aus Beton, Stein und Glas in Kälte klirrt. Da ist das Expo-Gelände in Hannover, ist Wolfsburg als Metapher, sind seltsame grüne Ränder der Metropole Berlin mit ihren neuen künstlichen Zentren wie dem Potsdamer Platz und »Übergängen wie in einem Traumreich«.
Die Welt draußen, Natur und urbane Natur, changiert in Petzolds Filmen ambivalent. Und ist überall anders. Das Rheinland und Ruhrgebiet seien sehr verschieden von Berlin, wo ab irgendeiner Station gar keine Stadt mehr existiere. Wie eine Insel in einem anderen Umraum. Die Partitur der Naturstimmen ergibt bei Petzold einen besonderen Sound: eine Pastoral-Sinfonie. »Die Natur macht Angst, bis man sie lernt zu lesen. Wenn Menschen deuten können, werden sie frei.« Petzold zitiert dann einen Zwischentitel aus Murnaus »Nosferatu«: »Er ging über die Brücke und ihm kamen die Gespenster entgegen«. Da ist alles drin und möglich: Freiheit oder Untergang, Aufbruch und Sicherheitsverlust. »Diese Schwelle interessiert mich immer.«