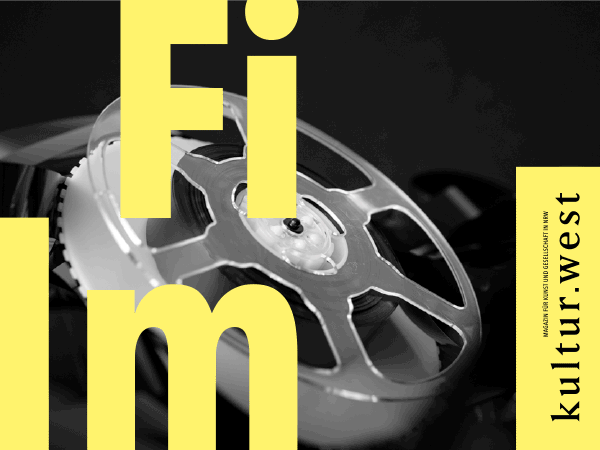TEXT: KATJA BEHRENS
Eine rote Socke, sechs Maiskolben, eine Frau mit Handtuchturban, lachend, ein Blatt, ein Autoreifen, eine Kamera, ein Unterwäschemodell. Alltäglicher könnten die abgebildeten Dinge kaum sein. Die Fotografien selbst sind gestochen scharf, die Objekte meist freigestellt, vor neutralem Grund. Man kann jede Pore sehen.
Alles deutet darauf hin, dass Christopher Williams mit seiner sachlich-distanzierten Fotografie Objektivität behaupten möchte, beziehungsweise auf ebendieses Bemühen des dokumentarischen Stils hinweist. Die perfekten Inszenierungen bedienen sich der Bildsprache der Werbung aus den 1960er und 70er Jahren.
Doch nicht nur in seiner Ästhetik bezieht sich der amerikanische Konzeptkünstler auf die vorgebliche Objektivität dokumentarischer Fotografie. Auch die irritierend langen und ausführlichen Bildlegenden, die zu jedem seiner Bilder dazu gehören, verweisen auf jene vermeintliche Neutralität. Sie nennen das Arbeitsgerät, die fotografierte Person oder das Objekt, Technik, Papier, Größe, Ort und Datum, klären die Bildrechte – den Künstler selbst aber nennen sie nicht. Manchmal erwähnen sie das Fotostudio, in dem gearbeitet wurde, oder die Serie, zu der das Bild gehört. Durch die langen Titel, voll mit scheinbar irrelevanten Informationen, scheinen die Fotografien überfrachtet und über die Maßen definiert zu werden. Was hat es damit auf sich? Welche Beziehungen werden hier abgebildet?
Als konzeptueller Künstler betrachtet Christopher Williams – geboren 1956 in Los Angeles – Fotografie nicht allein als eine Technik, sondern vor allem als kulturelles Feld, er selbst sei schließlich auch nicht alleiniger Autor, der Moment des Fotografierens letztlich lange vorbereitet.
Wer denke schon an den Ingenieur, der die Kamera entwickelt, den Designer, der sie entwirft, an die Chemiker und Physiker, die sich um den Film und seine Entwicklung kümmern? Die gesamte Fotoindustrie hänge mit drin, warum also nicht den Fotografen-Autor dekonstru-ieren? »Wir sind schließlich Teil eines größeren Programms.«
Christopher Williams weiß genau, was er macht. Er erzählt, dass er sich schon seit seiner Akademiezeit in Südkalifornien, wo er Mitte der 1970er bei John Baldessari studierte, für die europäische Pop Art interessiert. Der »Kapitalistische Realismus« mit Konrad Lueg, Gerhard Richter, Sigmar Polke hat eine große Anziehungskraft. Die Typologien der Industriebauten von Hilla und Bernd Becher tauchen schon damals in vielen internationalen Ausstellungen auf, »sie waren sehr sichtbar«. Überhaupt sei die deutsche Kultur der 70er Jahre wichtig für sein Denken gewesen. Auch das neue deutsche Kino war damals in Kalifornien angesagt. Er nennt Wenders, Herzog, Schlöndorff, Fassbinder, Kluge. Und David Bowie war auf einmal begeistert von neuer deutscher Musik wie Kraftwerk.
Umso geschmeichelter fühlte Williams sich, als er die Einladung nach Düsseldorf erhielt. Es sei aber natürlich eine besondere Herausforderung gewesen, den Lehrstuhl für Fotografie zu übernehmen, den Bernd Becher über so eine lange Zeit geprägt hat. Wieder fängt Williams an, über seine Arbeit zu sprechen, engagiert und gut gelaunt erzählt er, wie er irgendwann Konrad Klapheck in New York kennen lernt und begeistert ist von dessen Bild eines Autoreifens. Das Motiv haben aber auch Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg und John Cage verwendet, es scheint ein richtiges Pop-Motiv gewesen zu sein, das seinen Weg nach Europa fand. Was hat es mit der Ikonografie des Reifens auf sich? Dann zeigt er ein Foto einer Paprika von Edward Weston, weist auf die wunderbaren Schatten hin. Etwas Ähnliches habe er bei seinem Bild eines auf der Seite liegenden Renault Dauphine auch gewollt. Das Foto des französischen Oldtimers aus den 60er Jahren ist der Einstieg in die weite Reise, auf die uns der Reifen mitnehmen soll.
Sein Plan, so Williams, sei gewesen, den Reifen mit all seinen verborgenen kulturellen, ökonomischen und politischen Einschreibungen zum Sprechen zu bringen. Die Erinnerungen an die aus Autoreifen errichteten Barrikaden in Paris 1968 allein sind ihm etwas zu politisch, also versucht er, die verschiedenen Bildsprachen zu mischen: ein bisschen Politik, ein bisschen Werbung, ein bisschen Wissenschaft. Aber wer weiß eigentlich, dass bei den in Paris fahrenden Autos ein großer Anteil des für die Autoreifen verwendeten Gummis aus Plantagen in Vietnam kommt? Dass dann wohl auch damals mit den Reifen Gummi aus der ehemals französischen Kolonie brannte, also die Menschen in Paris ein Stück ihrer eigenen unseligen Geschichte eingeatmet haben könnten …
Ein anderes wunderbares Beispiel der verschachtelten Komplexität des einzelnen Bildes bei Christopher Williams ist die aus drei Fotos bestehende Ansicht einer Kamera: Die »Kiev 88« wird in der Manufaktur ARSENAL in der Ukraine hergestellt und repräsentiert in Williams Serie über die Zeit des Kalten Krieges ›Russland‹. Wenn er in seinem Werk die europäische Rezeption der Pop Art untersuche, interessiere ihn gleichzeitig ja die Restrukturierung des kulturellen Lebens in der Nachkriegszeit, die auch eine Epoche der Amerikanisierung Europas war. Die Fotografien haben auch hier einen Bezug zur Geschichte und ihrer Codes, in dem Fall zu den Implikationen des Kalten Krieges und seiner fotografischen Kultur. Darüber hinaus seien die Bilder aber auch ein Nachdenken über die Veränderungen des sozialen Lebens und des kulturellen Klimas, speziell in der Bush-Ära und nach 9/11. Für Christopher Williams sind die Bilder und ihre vielen Ablagerungen schließlich »ein indirekter Weg, über die Gegenwart zu reden«. In welchen Objekten, Gebrauchsgegenständen, Routinen aber lassen sich Furcht und politisches Verstummen nachweisen und kenntlich machen? Was hat der Kalte Krieg für Folgen? Wo und in welchen Bildern, Images, Objekten, Gesten oder Handlungen manifestiert sich diese Epoche?
Die Kiev 88 ist, so erläutert der Fotograf, aufgeladen und übervoll mit verschiedenen Bedeutungssträngen. Erst einmal habe er sie als ein Beispiel osteuropäischen Cargo-Kultes angesehen, als ein Fake, das zum Kultobjekt wurde. Die »Kiev« ist ja selbst eine Aneignung des weltberühmten Hasselblad-Designs, wobei auch dessen Herkunft umstritten ist: Ist die Kamera eine schwedische Entwicklung oder eine ursprünglich deutsche, die irgendwann kopiert wurde oder sonst wie ihren Weg nach Skandinavien fand?
Die russische Fabrik ARSENAL jedenfalls war früher eine Munitionsfabrik, die 1918, während der Russischen Revolution, bestreikt und anschließend einer zivilen Nutzung zugeführt wurde. Ein Jahrzehnt später drehte der ukrainische Regisseur und Schriftsteller Oleksandr Dowschenko einen Film über das Innere dieser Fabrik. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann eignete die Sowjetunion sich Kamera-Technologie von verschiedenen deutschen Firmen an und begann in der Fabrik, Kameras und Objektive herzustellen, unter anderen eben auch die Kiev 88.
Die Fabrikarbeiter, die ursprünglich Kriegsmaterial herstellten, kümmerten sich nun um Kameratechnik und -design. So ist dem Bild von Williams politische Geschichte eingeschrieben, die sich bis heute niederschlägt und verfolgen lässt: die Russische Revolution, ein Film, der über deren Stellung in der Geschichte nachdenkt, die Aneignung und Verlagerung von Herstellungstechniken, sozialer Wandel, der KGB und nicht zuletzt die Idee, dass die Kamera heute ein Konsumprodukt für jedermann ist. Als falsche Hasselblad partizipiert die Kiev 88 zusätzlich auch an deren Kult-Status. Ein dicht gefülltes Werk, dessen Konzept sich in den vielen historischen Schichten indes nicht erschöpft, denn jedes Bild handelt ja immer auch von sich selbst, die Fotografie des Fotoapparates von den Bedingungen und Umständen der eigenen Herstellung und Verwendung.
Bevor er Ende der 1980er Jahre begann, mit Berufsfotografen zu arbeiten, hat Christopher Williams Bildmaterial aus Archiven von Agenturen, Museen, Zeitschriften oder aus Bibliotheken genutzt. Der Künstler, der in Köln und Amsterdam lebt und in Düsseldorf arbeitet, bezeichnet sich immer noch als Fotografen, auch wenn er heute vornehmlich Bildmaterial arrangiert und ordnet. Andere drücken für ihn den Auslöser. »Ich stehe am liebsten neben der Kamera«, bekennt er, »man sieht dann mehr.« Ihn treibe der Wunsch, von den beiden kritischen Diskursen wegzukommen, in denen traditionellerweise über Fotografie nachgedacht wird: die Idee des Fotografen als Autor und die Wichtigkeit des ›richtigen Augenblicks‹. »Unsere Aufgabe ist es, bereit zu sein und zu warten, dass das Objekt mit der Kamera performt.«
4. Dez. 2011 bis 12. Febr. 2012. Tel.: 0214/85556-0. www.museum-morsbroich.de