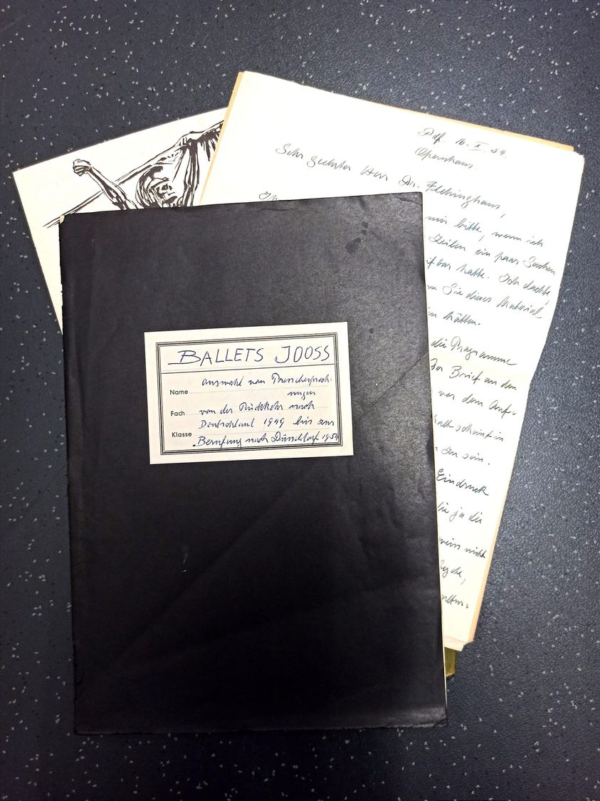Vom 1. bis 24. Oktober 2004 finden in Düsseldorf, Essen und Wuppertal »Drei Wochen mit Pina Bausch« statt, ein Tanzfestival, das die Wuppertaler Choreografin ausgerichtet und zu dem sie Compagnien aus Japan, Belgien, Indien, England, Korea, Frankreich und Deutschland eingeladen hat. Das Tanztheater Wuppertal selbst zeigt elf eigene Produktionen.
Ein Interview mit Pina Bausch ist eine Rarität – nach nur vier Wochen geduldigen Antichambrierens ist es K.WEST gelungen, eine Stunde lang mit der scheuen Choreografin in ihrem Büro zu sprechen. Ihr Arbeitsraum in der Wuppertaler Innenstadt zeigt sich ausgesprochen nüchtern: lange Tische mit Papieren und Computern, Rigipswände, an denen hier und da ein Plakat hängt. Nichts von der suggestiven Atmosphäre, die ihre Stücke auf der Bühne vermitteln, nirgendwo Schönheit.
Pina Bausch trägt über ihrem schwarzen Yamamoto-Anzug eine strahlend blaue Jacke und trinkt »Kinderkaffee«, wie sie sagt, mit viel Wasser verdünnt. Sie bewegt sich sehr langsam und wirkt entrückt, so wie man sie von der Bühne her kennt – zugleich aber strahlt sie eine schüchterne, ergebene Freundlichkeit aus. Manche Fragen quittiert sie, bevor sie spricht, mit einem großen, beinah verwunderten Blick, als seien ihr so etwas Seltsames wie diese Worte noch nie begegnet. Pina Bausch ist 64, aber im Laufe des Gesprächs begreift man, dass sie in sich eine ungewöhnliche, unbegreifliche Kindlichkeit bewahrt hat. Vor ihr liegt auf dem Tisch ein Blatt Papier mit ihrer Schrift – es ist die Handschrift eines kleinen Mädchens.
K.WEST: Als Sie 1997 den Berliner Theaterpreis erhielten, sprach Ihr Laudator Peter Esterhazy davon, ein neues Wort sei in der Welt: bauschen. Sind Sie schon einmal morgens aufgewacht und haben gedacht: Ich bin eine Klassikerin?
BAUSCH: Ich weiß ja nicht, was Sie sich vorstellen, aber wenn ich morgens aufwache, denke ich, was ich jetzt alles tun muss und wie ich das bewältige. Ob ich eine Klassikerin bin, habe ich mich noch nie gefragt.
K.WEST: Erfolg ist kein Thema für Sie?
BAUSCH: Ich habe keinen Gesprächsstoff, außer Arbeit. Und die besteht daraus, dass Tanztheater Live-Aufführungen sind. Das ist das Schwere oder das Schöne. Selbst wenn es ein wunderbar gemeinsamer Abend war, er ist einmalig und lässt sich nicht wiederholen. Meine Arbeit besteht aus dieser Lebendigkeit. Und dass wir so viele Stücke spielen – nun auch auf diesem Tanzfest mit elf abendfüllenden Produktionen, die alle vorbereitet werden müssen. Das ist unser Alltag, dazu unsere vielen Reisen. Wir probieren dieses und jenes Stück – ein ziemliches Geschachtele. Alles setzt sich aus unzähligen Kleinigkeiten zusammen, diese Details müssen gepflegt werden, damit das richtige Gefühl da ist. Darauf lässt sich nicht ausruhen. Realität ist: Mal ist der, mal jener verletzt, Sachen müssen umstudiert werden. Das braucht viel Kraft und viel Lust. Ich fürchte mich, bin aufgeregt und kann mich manchmal freuen, dass etwas schön geworden ist – und dann mal ausatmen, am ehesten unmittelbar nach einer Vorstellung oder bei einer Probe.
K.WEST: Sie sind einmal angetreten gegen massive Widerstande, die haben sich über die Jahre hin gänzlich aufgelöst. Es ist zu einer Umarmung gekommen, in der und mit der ganzen Welt. Löst diese Umarmung nicht auch ein erdrückendes Gefühl aus?
BAUSCH: Klar ist ein gewisser Druck da. Ich empfinde ihn aber anders, als Sie denken. Durch unsere vielen wunderbaren, beglückenden Reisen, durch all das, was wir an Geschenken bekommen haben, durch die entstandenen Freundschaften fühle ich mich so, dass ich etwas wiedergeben möchte für das, was ich empfangen habe. Das ist aber nie ausreichend. Ist nur ein Bruchteilchen von dem, was ich mir wünschen würde, sagen zu können. Das ist der Druck.
K.WEST: Was passiert bei diesen dreiwöchigen Gastaufenthalten der Compagnie, ob in Japan, Brasilien, Portugal oder der Türkei? Wie entwickelt sich aus diesen Begegnungen Energie, die sich dann niederschlägt in den Tanzabenden?
BAUSCH: Es sind immer Orte gewesen, wo wir auch schon vorher gespielt haben. Man war sich begegnet bei den Vorstellungen. Zum ersten Mal haben wir das in Rom gemacht, damals ist »Viktor« entstanden, 1986. Als man mich fragte, ob ich ein Stück über Rom machen würde, war ich zunächst erschrocken. Ich kann ja kein Stück über Rom machen, über die Geschichte und all das. Am Ende ist daraus geworden, uns beeinflussen zu lassen: der Ort als Basis, aber alles andere ist auch da. Man ist angewiesen auf viele, viele Leute, die einem eine Stadt nahe bringen. Nicht im touristischen Sinn. Leute, die sich wünschen, dass man auch die Schwierigkeiten kennt oder Dinge, die keiner sonst weiß. Wir laufen auch nicht als Gruppe zusammen dahin oder dorthin. Meistens geht jeder woanders hin und kommt mit seinen Ideen, hat Beziehungen geknüpft. Und ich stelle dann halt die entsprechenden Fragen. Man hat zunächst ein Riesenmaterial. Hier in Wuppertal geht es weiter. Aus der Materialsammlung suche ich dann kleine Dinge heraus. Ein langer, langer Prozess. Und dann ist es aufregend, zur Premiere an den Ort zu fahren und zeigen zu müssen, was herausgekommen ist. Das führt zu mehr als nur individuellen Freundschaften in all den Städten, es entsteht ein ganz anderes Verständnis für viele Dinge, so dass man sich anders nahe fühlt. Und so ein Stück bleibt dann auch in unserem Repertoire. Es ist wie ein Stück der Familie geworden. Es passieren Liebesgeschichten mit einer Stadt.
K.WEST: Wo kommen bei so viel Freude noch die Zumutungen her, die Schmerzen? Sie machen ja keine Unterhaltungsabende.
BAUSCH: Das größte Vertrauen besteht doch darin, einander schwierige Sachen zu zeigen. Ich kann kein Gebäude vertanzen, Sehenswürdigkeiten helfen einem nicht. Ich kann nur Stücke machen, indem ich Menschen kennen lerne. Ich möchte immer an Orte gehen, wo Leute sind und sich treffen, normale Leute. Darauf bin ich sehr angewiesen. Das dauert manchmal, bis man das findet. Und spürt, wie ähnlich Menschen fühlen, gerührt sind, lachen, weinen, erschrecken. Da ist auf der ganzen Welt kein Unterschied.
K.WEST: Sind Sie süchtig nach Menschen?
BAUSCH: Eigentlich nicht. Normalerweise flüchte ich immer. Aber ich möchte gern unsere Arbeit zeigen. Durch die kann ich mich am besten zeigen. Es ist ein Teil von mir. Und etwas Gemeinsames mit dem Publikum.
K.WEST: Wenn man Sie erlebt wie wir jetzt, spürt man Ihre große Kraft, sich zu freuen, eine kindliche Freude. Ist die unvergleichliche Form der Repräsentation, die Sie in drei Jahrzehnten erreicht haben, nicht manchmal hinderlich für das unmittelbare Erleben? Nimmt ihnen diese Position nicht auch Freiheit?
BAUSCH: Ich vergesse das total. Es stimmt schon, aber ich kann ja nur wie ein Kind wagen, an all diese Sachen heranzugehen. Ich kann nur an einen Ort fahren und staunen und etwas damit machen, Diese Naivität ist wichtig. Das bin ich einfach. Ich kann mich begeistern, Ich kann auch genauso schnell betrübt sein. Ich bin vielleicht …
(Pina Bausch dreht den Kopf einmal hierhin, einmal dorthin, als suche sie etwas. Blickt schließlich mit weit offenen Augen lange ins Nirgendwo. Es entsteht eine große Stille im Raum.)
Ich weiß nicht, was ich bin – offen. Ich habe ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Das ist ein Wahnsinn, eigentlich. Ich habe kein Buch, kein Dingsbums, nichts. Da ist die Compagnie und da ist das Leben und mein Vertrauen, es zu versuchen und dass es gelingt.
K.WEST: Gibt es so etwas wie – wahrscheinlich ist das jetzt ein falsches Wort – Technik, mit der Sie bei den Proben bestimmte Prozesse anregen, sich herantasten an Eigenarten der Tänzer und ihre Erfahrungen, eine Technik, mit der sich Dinge hervorlocken lassen?
BAUSCH: Technik hab’ ich gar keine. Wenn ich einen besseren Weg wüsste, meine Stücke zu machen, würde ich ihn einschlagen. Das ist kein Prinzip. Wichtig ist eine Vertrauensbasis. Ich habe so viele Fragen im Laufe meiner Arbeit gestellt – wobei mir keine einzige einfällt, wenn Sie jetzt eine hören wollten. Die Tänzer müssen Vertrauen haben, zu antworten, was sie empfinden – innerhalb der Gruppe, vor allen. Und sie müssen das Vertrauen haben, dass ich damit gut umgehe, dass ich mir leisten kann, sie alles zu fragen.
Jeder hat da dieselben Chancen, plötzlich wird der wichtiger, in einem anderen Stück ein anderer, das kristallisiert sich heraus. Ich habe ja kein Solistenensemble. Und wenn einer was blöd gemacht hat, lachen wir alle. Wir lachen sowieso ganz viel. Am Ende geht es darum, die richtigen Dingelchen gefunden zu haben. Es kommt auch die Zeit, dass die Tänzer wahnsinnig viel Geduld mit mir haben müssen, wenn ich versuche, mit den Extrakten etwas zu machen. Da bin ich penetrant oder penibel und mache die allerdümmsten Sachen, probiere alles Mögliche und finde nicht, wie es sein muss. Ich glaube nicht, was ich gedacht habe, ich glaube nur, was ich gesehen habe. So einfach ist das. Manchmal denke ich auch, ich stelle die ganze Zeit die falschen Fragen. Irgendwie weiß ich, wo es hin will, das lässt sich gar nicht genau benennen. Wenn man dann dafür eine Form findet, weiß man, das gehört dazu.
K.WEST: Der mit Ihrem Tanztheater vertraute Zuschauer erkennt Veränderungen. Es gibt die Altgedienten, Dominique Mercy, Helena Pikon und so weiter. Dann gibt es die Jüngeren, die sich viel mehr über das Tanzen ausdrücken, weniger über Worte und kleine Geschichten.
BAUSCH: Das Bedürfnis, sich zu bewegen, ist sicher größer geworden. Aber diese Arten der Bewegung sind auch aus Fragen entstanden und nicht einfach so. Sind ganz andere komplizierte Bewegungsformen, die hätten die anderen damals gar nicht machen können. Das ist noch mal ein anderer Weg, der kann sich auch wieder ändern. Dadurch, dass wir diese vielen Stücke immer wieder spielen, ist es zum einen schwer, immer wieder einen anderen Weg zu gehen; aber ich finde es auch gut und gesund, woanders hin zu gehen, weil wir ja die alten Stücke regelmäßig aufnehmen. Es gibt Choreografen, die nehmen ihre schönen Stellen raus und tun sie ins nächste Stück. Das fällt bei uns weg, weil wir ja immer alles spielen. Wenn jemand fragt: »Warum machst du nicht noch mal so was wie »Sacre«, sage ich: Aber wir haben doch »Sacre«.
K.WEST: Nehmen sie eigentlich etwas wahr von der kulturellen Szene Ihrer Umgebung hier in NRW?
BAUSCH: Ich nehme sehr wenig wahr, nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich keine Zeit habe. Nicht nur, weil ich auf Reisen bin – wir sind ja auch viel hier. Aber da ist die Organisation, die Planung des nächsten Jahres – und die ganzen Proben, morgens und von sechs bis zehn. Ich kann gar nicht weg. Gut, es gibt ein paar Leute, die übernehmen das manchmal, wie Dominique Mercy. Aber der unterrichtet auch lieber in Essen.
K.WEST: Warum sind Sie immer noch in Wuppertal – haben nicht längst ein eigenes Haus in New York oder Paris?
BAUSCH: Das mit dem Woanders-Sein ist so eine Sache. Ich habe so viele Jahre auf Koffern gesessen – nicht wirklich, vom Gefühl her, und gedacht, ich bin immer nur ein Jahr hier, habe immer nur einen Ein-Jahres-Vertrag geschlossen. Aber nun muss man doch realisieren, Wuppertal ist unsere Mutterstadt. 30 Jahre, ein Wahnsinn. Ich kann auch gar nicht begreifen, wie schnell das gegangen ist. Ich kann auch nicht aus meiner Wohnung ausziehen, ich würde auch gern mal was Netteres, Größeres haben. Ich komm’ zu gar nichts, außer meine Kraft und Zeit in die Arbeit zu stecken. Es gab mehrmals Ansätze, woanders hin zu gehen. Einmal, da war ich sehr perplex, das ist schon sehr lange her, da stand zur Debatte, nach Paris zu gehen. Wir haben das mit der Compagnie besprochen, und ich dachte, die wollen bestimmt alle weg, immer so viel Regen hier und grau und freudlos. Aber alle wollten in Wuppertal bleiben.
K.WEST: Warum ist das so?
BAUSCH: Für mich ist egal, wo ich hingehe – ich muss nicht hier sein, darum geht es nicht. Aber was ich schön finde an Wuppertal und auch wichtig für unsere Arbeit ist, das ist zu fühlen, ich lebe in einem Alltag. Es gibt Städte, die sind wie Sonntagsstädte. Ich finde aber wichtig, konfrontiert zu sein mit der Wirklichkeit, weil man ohnehin so wenig draußen ist. Wenn ich zu unserem Probenraum gehe, zwischen Peepshow und Spielautomaten, ist da eine Bushaltestelle, und da stehen diese traurigen Leute. Das ist unser Eingang. – Man muss mit seiner Arbeit zaubern. Im Moment ignorieren wir die Umstände hier, mit dem geschlossenen Opernhaus, dem Umbau, der Finanzlage, aber wie lange das geht, weiß ich nicht.
K.WEST: Um auf die »Drei Wochen mit Pina Bausch« zu kommen: Mit Verwunderung stellt man fest, dass sich selbst eine Gruppe wie Dumb Type auf Pina Bausch bezieht, viel jüngere Leute, aus Japan! Sie sind eine Art Übermutter für zwei, drei Generationen von Tänzern und Choreografen. Wird das Fest eine Art erweitertes Familientreffen?
BAUSCH: Die Familie ist sehr groß. – Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Es gibt so unterschiedliche Sachen, die ganz anders sind als meine Arbeiten, aber genau so wichtig. Ich finde zum Beispiel die Zusammensetzung von Dumb Type – Architekten, Techniker, Musiker und Tänzer – eine Sensation. Oder Wim Vandekeybus oder Sasha Waltz mit »Körper« – wichtige Leute. Bei denen habe ich das Gefühl, es wird weitergehen, nicht nur so zwei Jahre, und weg ist es.
K.WEST: Sie betonen den eigenen Weg, den die anderen gegangen sind. Trotzdem gibt es womöglich einen Ausgangspunkt. Wo ist diese Positionsmarkierung, die Ihre Arbeit gesetzt hat, von der aus andere weitergehen konnten?
BAUSCH: Ich kann das für andere nicht beurteilen. Ich kann nur für mich selber sagen, dass ich etwas ausdrücken wollte, dass ich mit Worten gar nicht ausdrücken kann. Was ich unbedingt sagen muss, aber nicht verbal. Es sind Gefühle. Oder Fragen – ich habe nie eine Antwort. Ich gehe mit etwas um, was wir alle empfinden, was uns alle beschäftigt, in einer ähnlichen Sprache. Ich bin ja auch der Zuschauer. Und möchte gern etwas fühlen, bei dem, was ich sehe, und im Bezug zur Musik. Ich kann nur von meinem eigenen Instinkt ausgehen. Wenn ich auf mein Gefühl wirklich vertraue, glaube ich nicht, dass es nur meines ist. Das teile ich mit anderen.
K.WEST: Wenn man Sie in der Öffentlichkeit erlebt, ja auch hier, dann vermitteln Sie so etwas wie eine milde Strenge. Eine Aura von Unberührbarkeit…
BAUSCH: Vielleicht bilden Sie sich das ein.
K.WEST: Ja, vielleicht. Aber vielleicht hat dieser Eindruck damit zu tun, dass Sie sich einer Vereinnahmung erwehren müssen? Alle Welt nennt Sie Pina. Gleichwohl käme man nicht auf die Idee, die Distanz zu Ihnen überwinden zu wollen. Davor steht der Respekt. Wissen Sie um diese Ambivalenz in der öffentlichen Wahrnehmung?
BAUSCH: Sie wollen mir meine Naivität nehmen! Jetzt denke ich darüber nach und werde mich beim nächsten Mal komisch fühlen, bis ich mich davon wieder befreit habe.
K.WEST: Wenn Sie inmitten der Compagnie nach einer Premiere zum Applaus auf die Bühne kommen, wirken sie fast erschöpft.
BAUSCH: Nicht erschöpft, erleichtert! Danach habe ich Hunger.