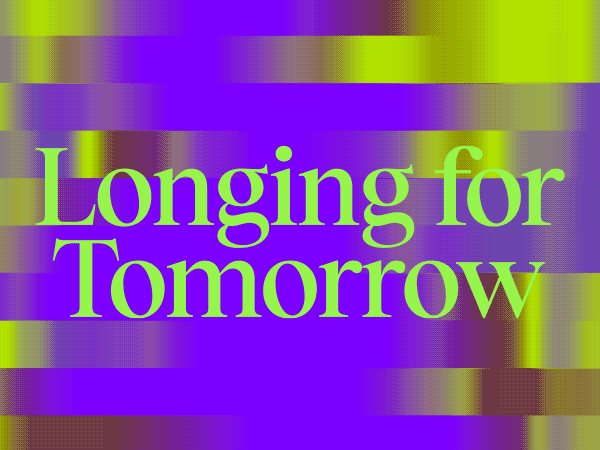Großer Auftritt in einer kleinen Rolle: Wenn Elena Sancho Pereg die Szene als Fiakermilli in Richard Strauss’ »Arabella« betritt, zieht sie alle Blicke auf sich. Die zerbrechlich-zarte Sopranistin trägt ein knappes, mintgrünes Pailletten-Bustier, darüber ein blaues Samtjäckchen, einen gelben Tüll-Minirock zu Netzstrümpfen, auf dem Kopf einen riesigen Zylinder und in der Hand eine Schampus-Flasche. Silke Wilretts schräge Kostüm-Kombination für die Rheinoper ist wie geschaffen für die junge Spanierin, deren Ausstrahlung auffallend anders ist. Erster Eindruck: Das ist eine Schauspielerin!
Wenn man Elena Sancho Pereg auf der Opernbühne erlebt, vergisst man unwillkürlich, dass sie singt. Obwohl die Fiakermilli kein stimmlicher Spaziergang ist und die glitzernden Zerbinetta-Koloraturen in Strauss‘ »Ariadne auf Naxos« (ihr Debüt an der Rheinoper) alles andere als zu überhören sind. Dennoch, man folgt zuerst gebannt ihrem Spiel und der faszinierenden Erscheinung, bevor man die Qualität dieser Stimme registriert. Es gibt viele Talente, aber nur sehr wenige Ausnahmetalente. Die Theaterwelt spricht dann vom »Bühnentier« – der seltsame Begriff bezeichnet treffend das Unmittelbare der Überwältigung. Elena Sancho Pereg gehört zu dieser raren Spezies. Der zierliche Wirbelwind singt nicht nur formidabel, sondern verleiht der Zerbinetta einen schillernden Charakter zwischen ausgelassenem Charme und der kaputten Traurigkeit eines Junkie-Girls. Auch ihre Fiakermilli ist eine exzessive, strahlende Figur, die zugleich stark gefährdet und brüchig wirkt.
Und die Stimme? Sie funkelt verführerisch, springt federleicht in Höhen-Regionen und meistert die schwierigsten Koloraturen in quecksilbriger Beweglichkeit und makelloser Spurführung. Ihr scheint alles leicht zu fallen. Tatsächlich verlief ihr Weg scheinbar geradlinig: Nach Studien in Madrid und an der Guildhall School of Music and Drama London erarbeitete sie sich Partien wie Musetta aus Puccinis »La Bohème« und Norina aus Donizettis »Don Pasquale«. Als Mozarts Donna Anna in »Don Giovanni« gab sie ihr Deutschland-Debüt am Theater Krefeld-Mönchengladbach, dessen Operndirektor Andreas Wendholz sie entdeckte und direkt engagierte. Er habe Elena erstmals als Gilda beim Sommerfestival im belgischen Alden Biesen 2013 erlebt. »Eine Vollblutkünstlerin. Ihre Offenheit, Warmherzigkeit und der Verzicht auf alles Prätentiöse machen sie für mich zu einer Künstlerin mit ganz besonderer Ausstrahlung.«
Unprätentiös, ja, etwas scheu und ungläubig, wenn man ein Interview anfragt. Als »Schicksal« bezeichnet sie ihren Beruf, sie habe schon als Kind immerzu gesungen. Trotzdem wollte sie »Missionarin oder Schauspielerin« werden. Mit dem Singen fing sie an, »weil ich alles andere nicht mochte: Ballett, Schwimmen … Dass ich Sängerin bin, ist ein Unfall, ich war nicht sehr überzeugt von meinem Talent. Man hat mich überredet, und es war die einzige Möglichkeit, nach Madrid zu kommen.«
Nach ihrem Gesangsstudium befragt, gibt sie entwaffnend zu: »Das Üben, Technik trainieren, Skalen singen habe ich nie geliebt. Ich wache erst auf, wenn ich spielen kann, dann kann ich über die Stimme artikulieren, was in mir ist. Singen ist für mich die perfekte Art, Gefühle zu transportieren, es ist pure Schwingung.« Wer wenig übt, kann auch keine Fehler trainieren. Zumal, wenn die Begabung einfach so da ist. Sie sagt: »Meine Stimme war immer hoch, ich musste mir das nicht erarbeiten. Ich hatte zwar viele Lehrer, aber konnte die meisten schlecht verstehen.«
Inzwischen gehört sie zum Ensemble der Rheinoper. Noch ist ihr Repertoire schmal, sie hat Zeit zu studieren und fühlt sich am Haus als »Teil einer Familie«. Wie erarbeitet sie sich eine Gewalt-Partie wie Zerbinetta? »Ich singe lange Zeit nicht mit der Vollstimme, sondern summe. Schwierige Stellen muss ich dann richtig trainieren, aber soft, ich muss nur meinem Körper zuhören. Und zuallererst übersetze ich mir den Text, denn nur, wenn ich den Sinn ganz und gar verstehe, kann ich den Klang erzeugen.«
Ganz ohne Hürden verlief Elena Sancho Peregs junge Karriere nicht. Nach dem Studium an der Guildhall durchlebte sie eine Krise, hörte auf zu singen und wollte – der Impuls der Missionarin? – die Welt verbessern. Dann aber traf sie einen Coach: »Heute ist das Geheimnis meiner Karriere, dass ich mich um meine emotionale Stabilität kümmere. Überhaupt steht im Zentrum meine innere Entwicklung, mein Wachstum als Mensch. Das Singen ist nur mein Werkzeug.«
Irgendwann würde sie gern Verdis »La Traviata« singen, auch die Königin der Nacht in der »Zauberflöte«. Für einen hohen, koloraturgängigen Sopran bietet sich doch auch parallel die Konzertkarriere an? Sie schüttelt den Kopf. »Ich bin nicht wirklich eine Sängerin. Mein Stimm-Mechanismus ist gekoppelt an das Spiel, ohne das kann ich keine Töne produzieren. Ich bin keine Stimm-Maschine!«