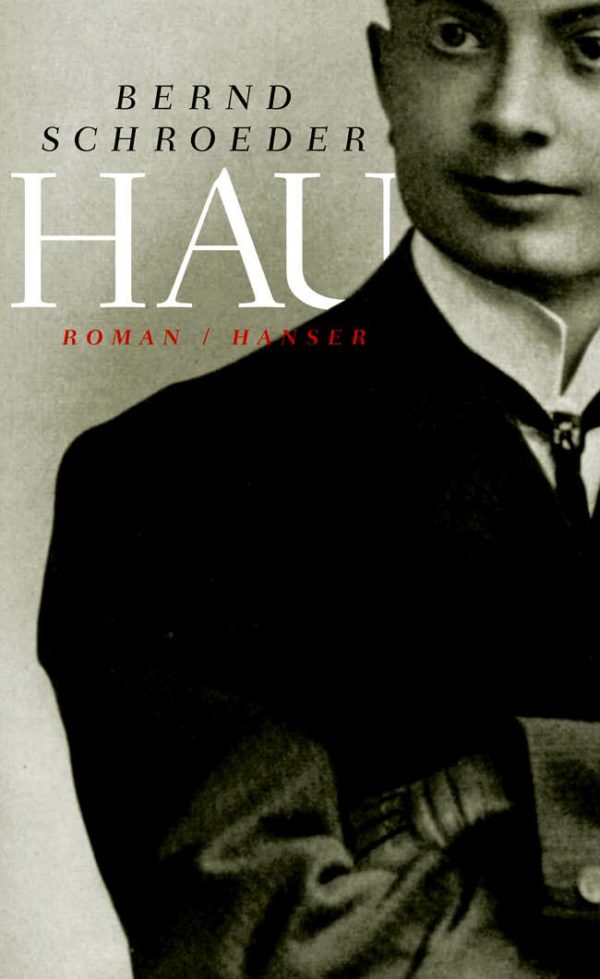Er fällt ein bisschen aus dem Rahmen, dieser junge Mann im Leinenanzug, der – wie »ein Prinz aus den Wellen des Meeres an Land gekommen« – plötzlich am Strand von Ajaccio entlang schlendert. Talent zum großen Auftritt wird man Carl Hau kaum absprechen wollen, doch in moralischen Dingen ist er im Vergleich mit den anderen, denen Bernd Schroeder eine Art autobiografischer Geburtshelfer war, dann doch deutlich weniger solide. Als da wären: Hanns Dieter Hüsch, Reinhard Mey und zuletzt Dieter Hildebrandt. Mit ihnen hat sich Bernd Schroeder über ihr Leben unterhalten, hat die Gespräche und seine eigenen Eindrücke mit ihren Texten arrangiert. Als Ghostwriter, der seiner Arbeit nicht im Verborgenen nachgeht und deshalb auch als Co-Autor auf dem Cover auftaucht. Bei Carl Hau war das ein bisschen anders. Als Schroeder Hau erstmals begegnete, war der bereits 46 Jahre tot. Gestorben im Februar 1926 in Italien, aller Wahrscheinlichkeit nach hat er dabei selbst Hand angelegt. Nachdem er anderthalb Jahre zuvor vorzeitig aus einer bis dato siebzehn Jahre währenden, als lebenslänglich angelegten Haft entlassen worden war.
Nicht ganz doppelt so viele Jahre hat es gedauert, bis der im Süden von Köln lebende Schroeder aus diesem Fall einen dokumentarischen Roman destilliert hat, der zu den aufregenden des diesjährigen Buchherbstes zählt. Er heißt ganz schlicht so wie seine Hauptfigur: »HAU«. 1972 erzählte ihm ein damals 80-jähriger Zeitzeuge in Baden-Baden von Hau, erinnert sich Bernd Schroeder heute. Von dem genialischen
jungen Juristen, der am 6. November 1906 seine Schwiegermutter aus nächster Nähe erschossen haben soll. Ein durchaus charmanter Aufschneider, der eigentlich alles mitbrachte, was es für eine große Karriere braucht: Intelligenz, Ambitionen, Zielstrebigkeit und Egoismus. Allein die nötige Anschubfinanzierung musste die Brautmutter beisteuern. Was nicht heißen soll, dass er nur deshalb seiner Frau herzlich zugeneigt war. Ein fürsorglicher Familienvater sei er gewesen, werden die amerikanischen Zeugen später zu Protokoll geben. Doch Prostituierte hatten es ihm eben auch angetan. Solch ambivalent schillernde Charaktere harmonieren nicht mit dem Weltbild grundsolider badischer Existenzen, das Bernd Schroeder aus eigener Erfahrung gut kennt. Hat er doch selbst zwischen 1970 bis 1987 in Baden-Baden gelebt. Ihn habe nicht die damals so emotional diskutierte Schuldfrage an dem Stoff interessiert. Sondern dass da jemandes Leben berochen wurde, weil er nicht in diese Umgebung passte.
Als Schroeder auf die unter Juristen noch heute bekannte Geschichte stieß, lebt er davon, Hör- und Fernsehspiele zu schreiben. Zusammen mit dem Regisseur Peter Beauvais hätte er aus dem »Fall Hau«, den Carl von Ossietzky seinerzeit zum Anlass nahm, »Schutz vor der Justiz« zu fordern, einen Film machen wollen. Doch in den Redaktionsstuben interessierte man sich in den 70ern eher für Arbeitswelt, Vergangenheitsaufarbeitung und Milieustudien. Nicht für einen historischen Skandalprozess, an dessen Ende der vermeintliche Täter Carl Hau wegen Mordes an der Medizinalratswitwe Josefine Molitor zum Tode verurteilt und später begnadigt wurde. Aufgrund einer zweifelhaften Beweislage, schuldig gesprochen von ausschließlich männlichen Geschworenen, von denen einige während des Prozesses eingeschlafen waren.
Also schloss Schroeder das Dossier »Hau« und ging weiter daran, Drehbücher zu schreiben, häufig zusammen mit seiner Frau Elke Heidenreich. Für »Der eiserne Weg« in der Regie von Wolfgang Staudte und Hans-Werner Schmidt erhielt er 1985 den Adolf-Grimme-Preis. Am Abend der Preisverleihung sagte ihm der Redakteur, man könne froh sein, den Preis bekommen zu haben, denn so etwas werde man in Zukunft nicht mehr produzieren. Schroeder machte weiter, nur dass er jetzt nicht mehr für Regisseure wie Wolfgang Petersen, Michael Haneke oder Michael Verhoeven schrieb, sondern meist selbst Regie führte. Auch der Hau-Stoff wurde wieder hervorgeholt, doch scheiterte das Projekt erneut; diesmal am plötzlichen Tod Peter Beauvais’, der just an dem Tag, als Bernd Schroeder sich mit ihm über das endgültige Exposé hatte abstimmen wollen, an einem Herzinfarkt starb. Diese traurige Vorgeschichte ist als Widmung dem Roman vorangestellt, in jener andeutend auslassenden Kürze, die charakteristisch für das Schreiben Schroeders ist: »Für Peter Beauvais (1916 – 1986). Es sollte ein Film werden – jetzt ist es ein Roman«. Es ist nach »Versunkenes Land«, »Unter Brüdern« und »Die Madonnina« der vierte von Bernd Schroeder. Hinzu kommen die längere Erzählung »Mutter & Sohn« und einige Kurzgeschichten, die Erinnerungen von Freunden und ferneren Bekannten in Gesprächsform – und ein Buch über das »Handwerken«, das in der Reihe »Kleine Philosophie der Passionen« erschienen ist. »Handwerken, ohne selbst Handwerker zu sein, das ist die Leidenschaft vom Umgang mit guten Materialien und perfektem Werkzeug, vom Konstruieren und Bauen, vom Gestalten und Erfinden. Nicht Nutzen und Sinn des Gebauten sind wichtig, sondern die Lust am Bauen.« So bewirbt der Verlag Schroeders kleines Bastlerbuch, eine Gelegenheitsarbeit, wie andere seiner Veröffentlichungen auch. Doch bräuchte es nur ein paar Handgriffe, um aus diesem Klappentext etwas Passendes für seine literarischen Werke zurecht zu schnitzen. Denn Schroeder zeigt sich darin als bemerkenswert souveräner Konstrukteur, als Veredler selbst schwierigster Roh-Stoffe, der auffallend uneitel über sich und sein Gewerbe, das Schreiben, spricht.
Wie entscheidend dabei der richtige Bauplan ist, hat Schroeder nicht erst mit »HAU« bewiesen, in dem er das dokumentarische Material derart kunstvoll auf drei verschiedenen Zeitebenen ineinander schachtelt, dass es nur weniger zusätzlicher Verzierungen des »Gestalters« bedurfte, um ein lebendiges Sittengemälde der Kaiserzeit zu zeichnen. In »Die Madonnina«, seinem dritten, 2001 erschienen Roman, erzählt er sinnlich lakonisch von Massimo und seiner Frau Severina, die schweigt, seitdem ihr Mann sie betrogen und verlassen hat. Eine alte Geschichte von Treulosigkeit und Vergebung, angesiedelt in den italienischen Bergen, wohin die Netze der Mobilfunkanbieter mittlerweile zwar reichen, die Zeit aber nicht vorgedrungen ist. So etwas gerät schnell als altmodisch in die Kritik. Doch ist der Roman auf eine Weise gebaut, die auf einen »Handwerker mit perfektem Werkzeug« schließen lässt. In Rückblenden wird von einer Liebe und ihrer Enttäuschung erzählt, eingebettet in die Beschreibung des langsamen Aufstiegs Massimos zum Berghof, in dem die Verstummte lebt. Während also Massimo dem Wiedersehen entgegen schreitet, was nicht weniger als die Hälfte des Romans lang dauert, hebt der Erzähler erst langsam den Graben aus, der die beiden trennt, spannt dabei den Spannungsbogen bis zum Äußersten, ohne dadurch den Kunstgriff zu überdehnen. Durch seine Tätigkeit als Drehbuchschreiber habe er ein Gefühl für Dramaturgie bekommen, sagt Schroeder, gefragt nach dem Verhältnis von Fernseharbeiten und Literatur. »Kollegen haben oft wunderbare Stoffe, aber Probleme, diese dramaturgisch aufzuarbeiten. Solche Schwierigkeiten kenne ich nicht.« Für den Film »Pizza Colonia« mit Mario Adorf hat ihm sein dramaturgisches Können 1992 den Bundesfilmpreis eingebracht. Am 2. Juni, am Tag der Preisverleihung, auf dem Höhepunkt seiner TV-Karriere, habe er dann entschieden, mit der »Lohnschreiberei« aufzuhören und seinen ersten Roman anzugehen. Da war Bernd Schroeder, der in einem böhmischen Auffanglanger 1944 zu Welt gekommen ist, in einem Alter, in dem andere sich darauf vorbereiten, langsam die Jahre bis zur Frühpensionierung herunterzuzählen. Ein Jahr später schon verfolgte er dann mit dem episodisch angelegten Roman »Versunkenes Land« die Geschichte einer Bauernfamilie von der Nachkriegszeit bis zu ihrer Auflösung in den 70ern. Auch in den anderen Romanen sind es meist familiäre Bindungen, an deren Auslotung oder gar Auflösung sich Schroeder macht. Vielleicht auch deshalb, weil sich wohl kaum eine andere zwischenmenschliche Konstellationen denken lässt, bei der man zugleich reduzierte wie abgründige Dialoge zu Papier bringen kann. Oder es ist die Sexualität als entscheidendes Ferment, das im ersten Roman Bewegung in die Szenen auf dem katholischen Lande bringt. Eine Region und Mentalität, die Schroeder aus seiner eigenen Kindheit und Jugend vertraut ist. Wuchs er doch selbst in einem oberbayerischen Dorf bei Freising heran, bis er dann Mitte der 60er nach München ging, um Theatergeschichte, Germanistik und Volkskunde zu studieren.
Er schreibe immer am eigenen Leben entlang, sagt Schroeder. Doch kann man durchaus den Eindruck haben, dass er zwischen dem distanzierten Blick und der Obsession sehr wohl zu unterscheiden versteht. »Man sagt ja gerne, schreiben erspare einem den Therapeuten«, ruft er auf die Frage, ob seine Arbeit auch eine existentielle Bedeutung für ihn habe, dem Besucher in Erinnerung. Um zu erklären, dass das bei ihm sicherlich nicht so extrem sei. »Aber eine gewisse Auseinandersetzung mit mir selbst spielt dabei sicherlich eine Rolle.« Nach der Auseinandersetzung müssen die Teile dann ja wieder zusammengebaut werden. Froh kann dann sein, wer einen guten Handwerker im Haus hat.
Bernd Schroeder, HAU, Hanser, München 2006, 368 Seiten, 21,50 Euro