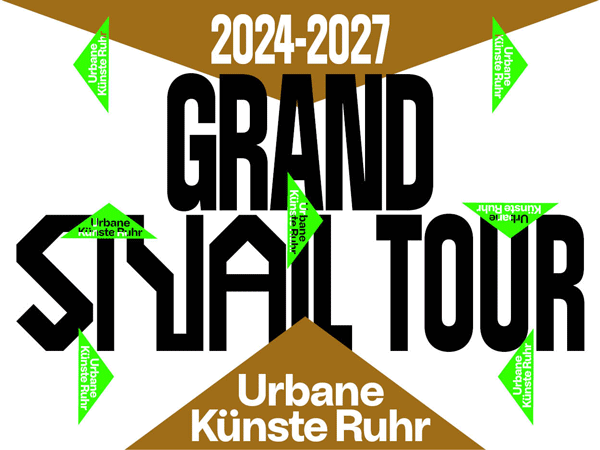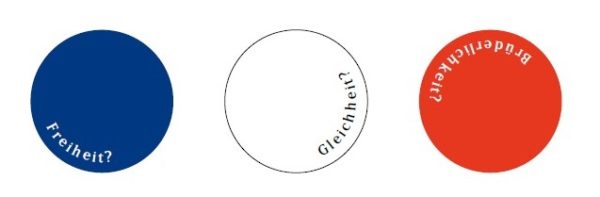Jens Harzer birgt sich in sich. Das heißt nicht: er verbirgt sich (vielleicht auch). Sondern er sorgt für Geborgenheit in sich selbst, wie er die Arme um sich legt oder zwischen seine Knie nimmt, wie er sich anfasst, einigelt in seinem Körper, ohne sich zu verkleinern. Vielleicht ist es Scheu, aber wohl mehr ein Sich-Spüren-Wollen. Über den Tastsinn den Kontakt zu sich halten.
Vor 35 Jahren nahm er sich als Mittelstreckenläufer die 1500 Meter vor: »Das hat mit meiner Person in der prägenden Phase zwischen 12 und 18 viel gemacht. Sich mit dem Körper zu beschäftigen, ist schon Thema meines Lebens.« Worum ging es ihm dabei: sich einem Extrem auszusetzen, sich selbst zu überprüfen? – »Ganz schön beschrieben. Wenn ich es betrachte, besteht eine Art von Waage zwischen körperlichem Ausagieren, Ausschöpfen und An-Grenzen-Gehen einerseits und gleichzeitig dem Gegenteil, nämlich sich zu bewahren, sich zurückzuziehen, zu verweigern. Wenn die Stücke und Figuren es erlauben, fließt diese Polarität in mich hinein. Beide Positionen halten Balance, manchmal kämpfen sie auch miteinander, bis zum Zerreißen. Viele meiner Rollen haben solch ein Thema, das kann schon sein.«
Es gibt die Bezeichnung des Traumverlorenen. Ihr müsste man den Begriff des Traumauffinders hinzu- und entgegensetzen. Der Schauspieler Jens Harzer ist ein Grenzgänger auf dem Gebiet beider Traumrichtungen: fiebernd, sensitiv und sensorisch, Herz- und Hirnströme fließen lassend. Raum, den er betritt und in dem er sich bewegt, öffnet sich ins Imaginäre hinein – und zu Geheimkammern. Seine Figuren, sagt Harzer, kämen für ihn eher aus einem Schweigen.
»Johan Simons ist ein großer Schweiger. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn er schweigt und grübelt. Gnade Gott, man stört ihn dabei.«
Jens Harzer
Im Januar hat er am Schauspielhaus Bochum Premiere als »Iwanonw«. »Mich interessiert das secret play. Die Amplitude des Spiels erhöht sich, wenn es sich nicht auf der reinen Sprachebene bewegt. Die Wünsche einer Figur, das, was sie eigentlich will, sind oft diametral entgegengesetzt zu dem, was die Dramaturgie erzählt. Während die Figuren reden, transzendieren sie hin zu etwas, was sie gar nicht fassen. Ein großes Thema bei Tschechows Iwanow. Der redet und redet, auch wenn er gar nicht viel reden will. Klage über das verpasste Leben, seine Depression und sich als überflüssiger Mensch zu fühlen, ist vordergründig da. In späteren Stücken hat es Tschechow den Figuren aus ihrem Mund herausgeimpft. Iwanow ist ein Mysterium, auch wenn es so klar daherkommt. Mich beschäftigt seine Lebensscham. Scham hat nur jemand, der Wertvorstellungen besitzt. Bei ihm ist es kein Gekränkt-sein von der Welt, sondern allein vor sich selbst. Das nachzuvollziehen, muss bei mir bleiben. Das darf man nicht mitteilen, nicht offenlegen. ‚Behalte einen großen Rest für Dich’ habe ich mir als Leitspruch gesetzt. Zu schweigen, das verbindet mich sehr mit Johan Simons. Er ist ein großer Schweiger. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn er schweigt und grübelt. Gnade Gott, man stört ihn dabei.«
Ohne Schranken

In Harzers Spiel fallen Schranken: zwischen Einfordern und Hingabe, abwesend scheinender, fast autistischer Teilnahmslosigkeit und schamfreier Inbesitznahme der Bühne, sogar die zwischen Mann und Frau, wie in der »Penthesilea«, wenn Regisseur Johan Simons und die verdichtete Fassung mit dem Ambivalenten spielt – bis hin zur Aufhebung und Umkehrung der geschlechtlichen Vorzeichen zwischen Sandra Hüller und Harzer. »Mir war schnell klar, dass Achill nur zur Hälfte Mann sein möchte. Die männliche Machtdemonstration wäre hier nicht interessant gewesen. Je näher Penthesilea und Achill sich gegenüberstehen, desto mehr verwandelt sich der Mann auch in das andere Geschlecht.«
Dass dieses ABC der Liebe im Spiel auf Verabredung beruhen muss, verbindet Simons’ Inszenierung mit Jürgen Gosch, dem Entblender von Schein auf dem Theater, um eben genau durch diesen Vorgang die Illusion neu zu formen und zu durchdringen. Ein Erkenntnismoment für Harzer, der ihm die Freiheit gab, die Verschluss-Kapsel, die Sprache durchaus sein kann, zu sprengen und knospend hervorzuspringen.
»Bei Jürgen Gosch fielen viele Kilos von meiner Schulter. Ich fühlte mich bei ihm entbunden von einer bestimmten Art der Verantwortung.«
Jens Harzer
»Man war bei Gosch in einer Theaterwelt, die, obwohl sie mich und uns einem Extrem aussetzt, gleichzeitig beruhigt. Alle spielten unzensiert. Ich spürte, dass Gosch Recht hatte und er mich befriedet; in der gleichen Sekunde spürte man, dass dieses Theater niemals altbacken ist. Gosch war sich seiner Zeichen so sicher, wo die Dinge zu sein und ihren Platz haben, die schauspielerischen Entäußerungen plus die ästhetischen Zurüstungen etc. Ich fühlte mich bei ihm entbunden von einer bestimmten Art der Verantwortung auf der Szene und für den Regisseur. Manches war egal, aber keinesfalls im Sinn vom beliebig oder ‚Macht mal’. Das Konkrete einer Situation – darum ging es. Das war für mich wie eine Seelenmassage. Beglückend. Erlösend. Mir fielen viele Kilos von meiner Schulter. Das kannte ich nicht, nicht von Peter Zadek, erst recht nicht von Dieter Dorn und Andrea Breth.«
Und dann ist da dieser Schnurrbart, den er trägt als Astrow in Tschechows »Onkel Wanja« am Deutschen Theater Berlin, für den Harzer 2008 zum Schauspieler des Jahres gewählt wurde. Haarsträubend buschig, breit über der Lippe wie ein in die Waagerechte verlegtes Ausrufezeichen, als soll es anzeigen, dass sich jemand von sich selbst entfernt und fremd werden, sich anders kennenlernen will. Ein weltwunder Mensch ist sein Astrow, dessen Aberwitz aus dem wissenden Einverständnis kommt, dass Leben sich nicht zwingen lässt, gelebt zu werden.
Der wahnsinnige Schnurbart von Astrow
»So kann man es sehen, aber es hatte auch praktische Gründe. Das Stück beginnt mit ‚Dieser Schnurrbart ist doch Wahnsinn.’ Entweder man streicht den Satz oder aber verhält sich dazu. Es musste ja ein großer Schnurrbart sein. Am ersten Probentag sagte Gosch: ‚Bring doch mal jemand einen Schnurrbart’. Darauf war ich vorbereitet und holte tatsächlich einen aus meiner Jackentasche. ‚Meinen Sie so einen, Herr Gosch?’ Da war er sehr überrascht. Ich hatte mich nicht getraut, ihn einfach anzulegen, weil ich dachte, vielleicht findet er es blöd. Nun setzte ich das verunstaltende Riesending auf. Auch typisch Gosch, wir haben in dieser Phase nie mehr darüber nachgedacht, sondern es als richtig empfunden. Ob dahinter etwas steht wie eine Entfremdung gegenüber sich selbst, womöglich. Denn ich merkte, dass der grobe, polternd zupackende Anteil dieses Astrow mir durch den Schnurrbart leicht fiel – ich konnte es mühelos entwickeln. Insofern war es ein beglückender Trick. Wir spielen »Onkel Wanja« seit nunmehr elf Jahren – der Schnurrbart ist das Zugangssignal für mich zu diesem Astrow.«
Mehr als ein Accessoire. Ein Vehikel und Instrument. »Ich bin ja nicht so sehr der Verwandlungs- und Vexier-Schauspieler, wie es etwa der große Gert Voss war, obwohl mich das mehr und mehr interessiert. Ich mache das eher im Kleineren. Ich glaube an so was Verrücktes wie das geheime Requisit einer Figur. Das können Details sein. Es hilft dabei, von sich wegzukommen, indem man Fremdes hinzunimmt. Das muss man im Übrigen nicht unbedingt kommunizieren.«
Bruno Ganz bestimmte ihn als Nachfolger
Dass Harzer 2019 als Iffland-Preisträger Bruno Ganz nachfolgte, der ihn, den bewunderten Bewunderer, testamentarisch als »bedeutendsten und würdigsten Bühnenkünstler des deutschsprachigen Theaters« auf Lebenszeit bestimmte, war zwingend. Wie das Vererben vom Vater auf den Sohn – eine Beziehung, die beide als Odysseus und Telemach in Botho Strauß’ »Ithaka« dargestellt haben. Wie bei Ganz, dem Schweizer, verbinden sich bei Harzer deutsches Wesen, genährt von Kleist und Hölderlin bis Handke, mit französischer Legerness und vollendeter Fechter-Grazie. Der prinzliche Gérard Philipe, der nervöse Truffaut-Held Jean-Pierre Léaud würden in Harzers Künstler-Ahnengalerie passen, der ohnehin ein Faible hat für das französische Kino. Bei Eric Rohmer hätte man ihn sich vorstellen können.
Sein Sprachvermögen teilt und verwaltet er mit Bruno Ganz ebenso, für den Dichter treuhänderisch, aber mutig in der überlegten Entscheidung zur eigenständigen Interpretation. Harzer, der die Trauerrede auf Ganz hielt, sagte, dass der es vermocht habe, »die eigene Sprache gegen die Welt zu halten, als könne man so die Verweildauer der Wörter und Sekunden erhöhen«. Harzers delikates, mitunter vom eigenen Verkosten trunkenes Sprechen, Betonen und Beatmen der Sprache, umfängt wie leichtes Berauscht-Sein.
»Im System Dorn hatte ich mir einen Freiraum schaffen können, den er sonst kaum jemand in meinem Alter gewährte.«
Jens Harzer über die Zeit an Dieter Dorns Kammerspielen
1972 in Wiesbaden geboren und ausgebildet an der Otto-Falckenberg-Schule in München, fand er dort lange Heimat an Dieter Dorns Kammerspielen. »Im System Dorn hatte ich mir einen Freiraum schaffen können, den er sonst kaum jemand in meinem Alter gewährte. Ein Zwischenreich, zu dem ich den Schlüssel fand, als ich andere Möglichkeiten von Theater kennenlernte, für mich zuließ und anerkannte und mich so in ein produktives Spannungsverhältnis zur Kammerspiele-Familie begab.« Die Reihe ‚seiner’ Regisseure setzt sich fort mit Andrea Breth, Luc Bondy, Dimiter Gotscheff und Jürgen Gosch. Und findet durch die Begegnung mit Johan Simons sinnsetzende Zukunft, auch wenn Harzer nicht fest in Bochum, sondern am Hamburger Thalia Theater engagiert bleibt.
Solch einen Achill sah man nie: im schwarzen Trikot und priesterlichen Rock, zart besaitet, wenn er die Arme hoch über den Kopf hebt und in schüchtern weicher Geste »Triumph« ausdrückt, wenn er das leibliche Begehren auskostet und den Duft des eigenen Schweißes schnuppert, abwinkt, wo Lebensgefahr droht, sich nackt darbietet und bloß noch ein Medaillon trägt: seine ganz Rüstung.
Der Tag, der alles veränderte
Dass die Kunst »Nichteinverständniserklärung mit der Welt« sei und dieser etwas entgegen halte, sei eine Binsenweisheit, sagt Harzer. »Der Schauspieler ist Teil davon, für mich eher im Sinn eines Kinderglaubens und nicht einer irgend engagierten Kunst.« Möchte er etwas sagen zu dem Impuls, der ihn zum Theater führte – aus Differenz, Reibung, Sehnsucht oder Versuchung? »Das ist schon sehr privat. Ich erzähle Ihnen etwas, das ist halb privat. In meiner Heimatstadt Wiesbaden auf dem Gymnasium war ich schon zwei Jahre in der Theater AG, ich war zwölf, wir hatten für das Schulsommerfest ein wunderbares Stück von Max Kommerell einstudiert, es hieß ‚Das verlassene Biribi’. Nach der letzten Probe fuhr ich mittags nach Hause; um 17 Uhr würde Premiere sein. Meine Mutter sagte: ‚Deine Großmutter ist gestorben.’ Die aus der Tschechei stammende Mutter meines Vaters. Ich ging ins Kinderzimmer, weinte, dachte nach und fragte dann meine Mutter: ‚Darf ich denn da heute Abend spielen?’ Sie meinte, dass ich das selbst überlegen müsse. Ich entschied für mich: ‚Natürlich spiele ich.’ Ich fuhr mit dem Rad wieder zur Schule im Bewusstsein, etwas spielen zu müssen und zu wollen, meiner Passion nachzugeben, obwohl ein mir sehr geliebter Mensch gestorben war. Das war der erste Widerspruch. Und ich entschied, es niemandem zu erzählen. Das war der zweite. Und ein Geheimnis. Diesen Moment habe ich nie vergessen. Er hat viel mit dem Beruf zu tun und sehr viel mit mir. An diesem Samstag 1984 habe ich mit meinem Beruf angefangen.«
Schauspielhaus Bochum:
»Iwanow« ab 18. Januar 2020
»König Lear« ab 25. April 2020
»Penthesilea« ist weiter im Spielplan