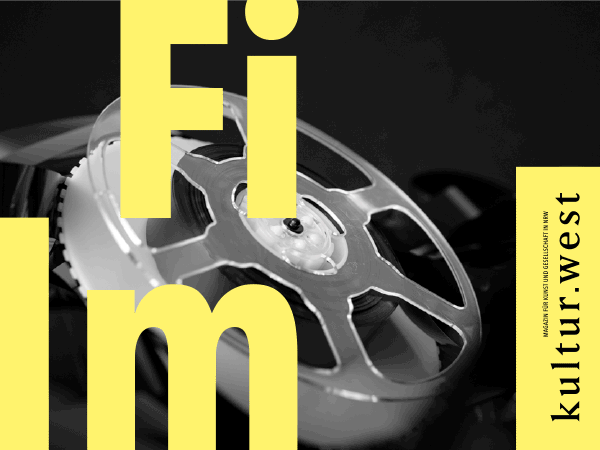TEXT: ULRICH DEUTER
Beginnt am Schauspiel Bochum eine neue Intendanz, wächst ganz von selbst ein Anfangszauber. Das Haus hat Theatergeschichte geschrieben; aus den vielen großen Momenten auf seinen beiden Bühnen ist wohl so etwas wie ein leuchtender Dunst kondensiert, der das Gebäude dauerhaft umschwebt. Jedenfalls kann man sich, die Königsallee zum Besuch des Neustarts überquerend, einer gespannten Hochstimmung nicht entziehen – obwohl man den Mann und seine Art doch kennt, der ab jetzt für die nächsten Jahre das Bochumer Schauspielhaus regiert: Anselm Weber. Fünf Jahre lang hat er sich schließlich am Grillo-Theater kenntlich gemacht.
Doch Essen ist nur Essen, aber Bochum ist Bochum. Acht Premieren an zwei Eröffnungswochenenden warten; damit hat der Aufsteiger die quantitativen Ansprüche der höheren Liga erfüllt. Und auch konzeptionell haben die paar Kilometer von der alten zur neuen Wirkungsstätte den Kreis stark gedehnt: heraus aus der Stadt (Essen), die Webers Regisseure theatralisch erkundeten, in die Weite Europas, dessen Regisseure sich Weber nun hereinholt: Sie kommen aus Holland, Polen, Tunesien, Italien, der Schweiz und Türkei. Ein mutiger Schritt, sind doch deren Namen hierzulande Hekuba und die Ergebnisse ihrer Arbeit ungewiss. Aus dieser kommunal-kontinentalen Kooperation ist »Boropa« als das etwas nach Bohnerwachs riechende Motto des Hauses geworden – die Erfindung einer Düsseldorfer Agentur, die auch sonst beim neuen Corporate Design des Schauspielhauses auf plakatives Retro setzt.
Draußen auf dem Vorplatz schickt ein mobiles Internet-Café des Niederländers Dries Verhoeven Freiwillige per »Life Streaming«-Chat an ein unbekanntes Ende der Welt. Drinnen auf der großen Bühne beginnt Candide seine unfreiwillige Verschickung von Westfalen dito ans Weltende und zurück. Paul Koek, einst Ko-Direktor der Theatergruppe Hollandia, hat Voltaires »Candide oder Der Optimismus« als Beginn einer festen Zusammenarbeit mit Bochum inszeniert. Alles Geschehen führt letztlich zum Guten? Im Gegenteil. Da der Tonfall dieses negativen Entwicklungsromans sarkastisch ist, darf auch Koeks Theatersprache demonstrativ überzeichnen, fast wie im Puppenspiel agieren die Figuren, während sich in einem Guckkasten im Guckkasten plakative Prospekte verschieben. Immer wieder gleiten der alte und der junge Candide (Jürgen Hartmann, Joep van der Geest) aus der Erzählung ins Spiel, doch die Wechsel von der Epik in die Dramatik gelingen schlecht. Auch verengt sich der Rhythmus, in den die Musiker von Koeks Leidener »Veenfabriek« Sprache und Spiel der Schauspieler versetzen, bald zum Korsett. So bleibt die Inszenierung unter ihren Möglichkeiten.
»Il faut cultiver notre jardin«, lautet der berühmte letzte Satz des »Candide«. Zu Deutsch: Man sollte seinen Job machen und den Kreis klein halten. Monika Gintersdorfer hat dies richtig verstanden; David Bösch falsch. Der »leitende Regisseur« am Bochumer Schauspielhaus zwingt Shakespeares »Der Sturm«, wie er es immer tut, auf Comic-Format. Ohne, wie er es immer tut, zu begreifen, dass zur Einfachheit des guten Comics Verdichtung gehört. In seiner Schwundfassung dieses so hoch poetischen wie philosophischen Stücks geht es fast allein um (den Luftgeist) Ariel und (den Erdgeist) Caliban, zwei pubertierende, unablässig – Krrr! Prrr! Tschong! – sich prügelnde Ziehsöhne des grummelig-schlaffen Prospero. Von Shakespeares Sprache bleibt ein weggenuschelter Rest, das meistgebrüllte Wort ist Huaaach! Dafür zeigt sich der schon in Essen heimliche Star des Ensembles, Nicola Mastroberardino, in der Rolle des Ariel auf dem Gipfel seiner Virtuosität – und Hohlheit; als Faxenmacher ohne Seele.
Weber hat wesentliche Teile seines Essener Ensembles mitgenommen; sozial gesehen eine feine Tat, künstlerisch eine Fessel. Denn das, was man in Bochum auch zu schwächeren Zeit immer sicher war zu erleben, ist mit dieser Crew kaum zu erwarten: Schauspielkunst.
Rasch der Blick auf die folgenden drei Premieren:
• »Eleganz ist kein Verbrechen«: Das Regie-Duo Monika Gintersdorfer/Knut Klaßen (s. K.WEST 09.2010) zieht eine Art Sprechtanzdiskurstheater im Keller-»Theater Unten« auf, wuchtig-cool, jungernst-ironisch, in dem es hauptsächlich um einen Tanz- und Musikstil der Elfenbeinküste mit Namen »Coupé-Décalé« geht. Und der wiederum hat keinen anderen Zweck als die Behauptung von Reichtum und Luxus. Sehr einfach, sehr körperlich, sehr unterhaltsam.
• »Eisenstein«: Christoph Nußbaumeders jüngstes Stück erzählt in den Kammerspielen von Lug und Trug, Liebe, Zwang und Leid in einer niederbayrischen Dorfdynastie über drei Generationen hinweg. Falsche Bankerte und versteckte Altnazis, verbotene Verbindungen und kaputte Karrieren – Anselm Weber selbst inszeniert die Uraufführung wie eine TV-Serie, klein spielt man unter tief hängenden Jahreszahlen, die sich von 1945 bis 2008 schieben.
• »Medea«: Fadhel Jaibi sei, heißt es, einer der profiliertesten Künstler Tunesiens. Er und seine Frau Jalila Baccar krempeln den antiken Stoff ins Heute: Mythos und Metaphysik raus, aber Psychologie und Spannung nicht rein. In ihrem Migrationskrimi ist Medea eine Türkin, die mit dem Griechen Jason nach Duisburg auswandert, wo die von ihnen gestohlene islamische Handschrift (das Goldene Vlies) an den Hehler Kreon verhökert wird. Medea, vernachlässigt, gerät unter Islamisten-Einfluss und Kopftuchzwang. Liebesverrat und Kindermord verlaufen wie (von Euripides) bekannt, doch die Dialoge sind selbstgemacht und meist trivial, die Figuren undifferenziert; Handlung und Spielweise schwanken zwischen freundlicher Komik (gern auf Kosten traditioneller islamischer Lebensweise) und verstaubter Pathetik, die der graue Einheitsraum in den Kammerspielen unterstützt. »Medea« fügt der Migrationsproblematik nicht einen neuen Aspekt hinzu, ist im Gegenteil so simpel wie die öffentliche Debatte zumeist.
Ein langer, lahmer, verstolperter Anlauf. Und dann der Sprung, der das Schauspiel Bochum unter Weber mit einem Mal dahin katapultiert, wo man es haben möchte, wo es hingehört. Unter dem Titel »Die Labdakiden« inszeniert Roger Vontobel als letzte Premiere der zwei Eröffnungswochenenden auf der großen Bühne Sophokles’ »Ödipus«, Aischylos’ »Sieben gegen Theben« sowie »Antigone«, wieder von Sophokles. Ein dreieinhalb Stunden langer – ein viel zu kurzer Gang durch die Abgründe dieses Unglücksgeschlechts. Denn die Regie vertraut ganz auf die Sprache der antiken Dichter und die immer noch große Kraft ihrer Dramen; sie erstarrt weder zu Gips, noch wirft sie mit Plastik um sich. Von Anfang an ist jede Figur mit ihrer ganzen Geschichte da, öffnet sich hinter jeder Situation ein Imaginationsraum. Wie zu Beginn: Da spielen still Kinder zwischen den hohen Säulen des Thebaner Königspalastes. Da eilt eine Frau heraus, Iokaste, führt eilends, wenn auch gefasst, die Kinder herein, fest schließen sich die Tore. Da, man weiß nicht wie, wächst eine mit Händen zu greifende, bedrohliche Stille. Und dann schreit es los: »Die Pest!« Und: »Hilf uns, König!«: Der Chor. Und wie sich der dann in einen Dialog mit Ödipus begibt, ist es eine wunderbare Choreografie zwischen Angst und Ratlosigkeit hier, Wissen und Macht da, zwischen weichen Körpern und einem wie ein Bogen gespanntem.
So ist jede Szene zwingend und genau gearbeitet; situative Zitate der Jetztzeit (etwa Rituale moderner Mediendemokratie) schaffen nicht billige Aktualisierung, sondern unterstreichen Gültigkeit (hier die der Mechanismen der Macht). Vor allem im ersten Teil außerordentliche Augenblicke: Wenn Ödipus im Zentrum seines furchtbaren Erkenntnismahlstroms begreift, dass er selbst der Frevler ist, bricht in dem stahlglatten, glaubhaft selbstbewussten Herrscher (der in vielem an Obama erinnert) fast hörbar die Feder. Zusammenfallend, saugt Paul Herwig den ganzen Bühnenraum um sich herum mit hinein den Strudel. Ein ungeheurer Moment.
Kongenial auch die Bühne Claudia Rohners: Mächtige Stützen, die sich in »Sieben gegen Theben« zu einer Mauer zusammenschieben. Aischylos’ Drama ist ja problematisch: zu viel Mauerschau und Kriegsrhetorik, zu Recht wird es stark gekürzt. Hier helfen die Videoprojektionen enorm, die gegen den öffentlichen Raum (der Reden) einen privaten (der Zweifel) setzen. Der letzte Teil, »Antigone«, aber hätte größer geraten dürfen, in Fontobels Fassung ist gar Kreon der Protagonist, der er jedoch ohne eine starke Antigone nicht sein kann. Kreon ist hier kein Blender, sondern ein getreuer Sachwalter einer Macht, die auf Regeln ruht, in Michael Schütz’ Darstellung eine Helmut Schmidt-Figur. Während Antigone (Lena Schwarz) zu sehr Mädchen bleibt, zu wenig gegründet in einem Gegenweltentwurf. Doch sind dies, gemessen an der Größe des Abends, Geringfügigkeiten.
»Wir haben in Essen für Bochum die Rampe gebaut«, hat Anselm Weber im K.WEST-Interview gesagt. Das versprach Anlauf und Aufstieg. Den Sprung aber hat bisher nur einer geschafft. Weber wird noch stark kraxeln müssen, damit die Ebene, zu der diese Rampe führt, keine nur nominell höherliegende ist.