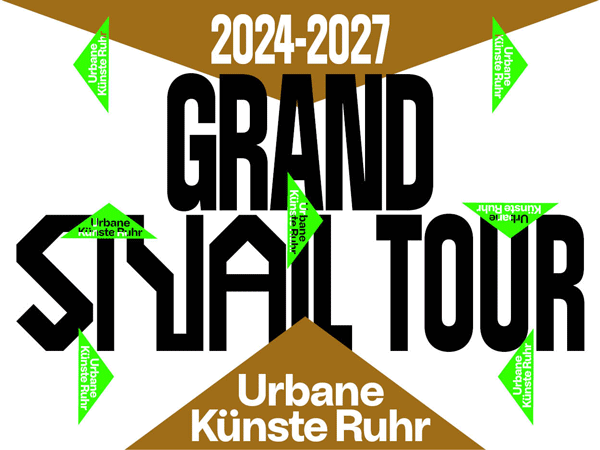Das Land wurde 40 Jahre alt, die 32 Schülerinnen und Schüler wurden acht Jahre alt: 1988 in Israel. Da sind schon mehrere Kriege geführt und gewonnen, unter Schmerzen und Verlusten und begleitet von der Veränderung, die der Sechstage-Krieg durch territorialen Zuwachs und durch die besetzten Gebiete mit sich bringt und dennoch, trotz des Wunders der Existenz eines jüdischen Staates, die Ur-Angst vor Vernichtung nicht bannen konnte. Die Kinder des Landes, Sabras genannt, sind ein Versprechen. Und sollen ein Versprechen geben: für Erez Israel da zu sein. Ein Versprechen sollte zweiseitig sein: die Person, die es gibt, und die- oder derjenige – und sei es ein Abstraktum wie ein Staat, der es empfängt, aber dafür auch etwas einzulösen hat.
Das gebrochene Versprechen betrifft auch Yael Reuveny selbst, 1980 in Petah Tikva geboren mit familiären Wurzeln im Irak und Osteuropa. Sie sagt am Anfang ihrer filmischen Recherche, dass sie Israel vor langer Zeit verlassen habe. Sie, die ebenso angetreten war als »Heldin und Idealistin«, wanderte aus nach Deutschland, lebt in Berlin in einer Patchwork-Familie, und wählte »die arrogante Leichtigkeit des Exils«, dessen »Schuld und Widerspruch« sie bald erkannt haben wird.
Für ihre Dokumentation kehrt Reuveny zurück an das ehemalige, in den Nationalfarben Blau-Weiß gestrichene Schulgebäude: »Der Mensch ist nichts als die Form der Landschaft seiner Heimat« stand auf einem Schild an seinem Eingang und konnte von der Grundschülerin Yael nicht verstanden werden. 15 ihrer damaligen Klassenkameraden und -kameradinnen zieht sie ins Gespräch. Die Begegnungen werden auch zur Selbstüberprüfung aus «bitter-süßer Verzweiflung« als einem vertrautem Grundgefühl. Reuveny lässt sich selbst nicht aus, sie ist mit sich sogar schonungsloser als mit ihrem jeweiligen Gegenüber, dem sie nicht zu nahe tritt, auch wenn ihre Fragen das Große und Ganze, das Lebensentscheidende betreffen und treffen. Archiv- und privates Bildmaterial ergänzen das Erzählte und lassen es zur Chronik des Landes anwachsen.
Gewöhnung an das Ungewöhnliche
Israel, das bedeutete Sicherheit für Einwanderer wie die Eltern von Meital, die aus Rumänien kamen: »Für Shoah-Überlebende der zweiten Generation ist Fortgehen keine Option.« Da ist Moshy, der als Offizier Karriere gemacht, studiert und Erfolg errungen hat. Oder Avi, der als »Patriot fünfeinhalb Jahre der Armee« geschenkt hat, bis er gemerkt habe, dass »alles nur ein dummes Spiel« sei, der nun viel im Ausland arbeite, während daheim seine Familie lebe, die er vermisst, obwohl er auch mal ganz gern unabhängig sei.
Was für ein Weg: von zionistischen Anfängen der Pioniere, die die ersten Orangenbäume anpflanzten, in eine etablierte Mittelklasse-Gesellschaft mit Bungalows und Reihenhaus-Siedlungen zu den hochstrebenden standardisierten Silhouetten des boomenden 21. Jahrhunderts mit Luxusapartments, die selbstverständlich einen betonierten Luftschutzbunker und Sicherheitsraum (»Mamad«) enthalten.
Es ist die zweite Generation, die hier spricht. Sie wuchs auf mit der Hoffnung, keinen Krieg mehr zu erleben, wuchs auf mit der Last der Erwartung ihrer Eltern, die auch Druck ausübt, wächst in eine Normalität hinein, die Gewöhnung an das Ungewöhnliche gleichkommt. Für Frauen meint diese Erwartung Mutterschaft, wenn nicht, sei es wie ein »Verrat«, sagt Yael Reuveny.
Die Väter und Mütter wollten und wollen, dass ihre Kinder es ihnen gleichtun, am Aufbau des Landes mitzuwirken, den Stolz zu verwalten, Familien zu gründen und damit auch die Zukunft des Staates zu sichern, »den Standardweg einzuschlagen«, wie Rachel es nennt, die Listen des Notwendigen abzuhaken, wie Keren sagt, die dabei gespürt habe, etwas zu versäumen. Oder zu versagen: »In Israel Single zu sein und keine Kinder zu haben, macht keinen Spaß«, sagt Shiri.
Tor der Hoffnung
Ansprüche, Erwartungen, Mahnungen, Zwänge. Im Schulunterricht ist noch immer die Pädagogik der Kibbuzim-Bewegung spürbar, auch wenn auf den Straßen die Friedensbewegung aktiv ist, die als Abfallprodukt die Erlaubnis zum eigenen und individuellen Traum einfordert, der dann durch die Ermordung von Jitzchak Rabin 1995, durch Intifada, Libanon-Krieg und die Situation in Gaza zerstob.
Welche Entscheidungen werden in Freiheit getroffen, welche werden einem auferlegt? Diese Frage beschäftigt alle, die vor der intensiven, aber diskreten Kamera von sich mitteilen. Das Recht auf eigene Wunschvorstellungen und diese dann zu leben, weist als Thema über das Individuelle ins Exemplarische. Ebenso wie ausgesprochene oder unausgesprochene Schuldgefühle: gleich, ob verheiratete Männer und Frauen, Alleinstehende oder ein schwules Paar, das mehrere Kinder adoptiert hat und sich nur verantwortlich fühlt »für unser kleines Zuhause«.
Für den im Krieg gefallenen Mitschüler Moishik, der auch zu Yaels Jahrgang gehörte, stehen dessen Eltern. Das Exil ist nicht die Antwort auf seinen Tod, sagt sein Vater, nicht für den Bruchteil einer Sekunde sei es das gewesen. Und so stehen sie an Gräbern, immerhin an Gräbern, die die Großeltern oftmals nicht bekommen haben. Petah Tikva lautet in der Übersetzung: »Tor der Hoffnung«. Für Yael Reuveny bleibt es das schönste Wort. Nächstes Jahr in Petah Tikva….
Ihre Generation der jetzt 40-Jährigen, die in den Komfort geboren wurde, durfte als erste hoffen und musste Hoffnung verlieren, die unabhängig vom eigenen Gelingen besteht. Dass der Film all dies ausspricht und summiert – auf konzentrierte Weise unangestrengt, ohne Pathos, beinahe ohne Absicht – macht ihn zu einem Zeugnis, das schon im Moment seiner Ausfertigung und Fertigstellung historischen Wert hat.
»Kinder der Hoffnung«, Regie: Yael Reuveny, D / Israel 2020, 88 Min., Start: 4. November