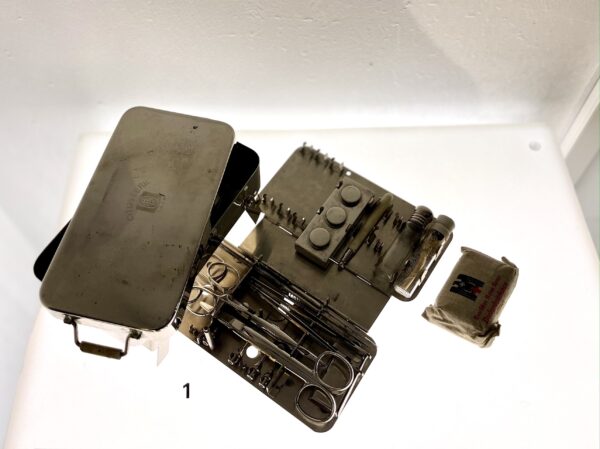Das Internationale Frauen Film Festival findet zum 40. Mal statt, diesmal in Köln. Ein Streifzug durch das Programm – vom Wedding nach Ankara, zu zwei Frauen in Wales, die sich ihre Liebe ersingen, zu einer Familie ins finnische Lahti, und in das Amerika nach und vor Trump als apokalyptische Fantasie.
Fluchtwege
Der Eröffnungsfilm: »Ellbogen« von Asli Özarslan
In der Schule lernen fürs Leben: Wie bewirbt sich jemand auf eine Lehrstelle, wie motiviert stellt er oder sie sich dar, was sind die richtigen Reizworte? Das üben sie im Unterricht, aber in der Praxis scheitert Hazal (Melia Kara) und hilft bloß ihrer Mutter in der Bäckerei. Ankommen in Deutschland, aber wie? Hazal ist eine von vier Freundinnen aus dem Wedding, die in der deutschen Gesellschaft ebenso wenig daheim sind wie in der türkischen Tradition. Sie stehen dazwischen. Keine Integration und Teilhabe, aber nicht randständig genug für die totale Negation. Hazal wird gerade 18, aber für ihre Familie bleibt sie unmündig. Asli Özarslan hat »Ellbogen«, den Erfolgsroman von Fatma Aydemi, knapp und straff verfilmt, nachdem die Theater auch schon zugegriffen haben. Stoff und Figuren besitzen Direktheit, die Perspektive ist eigensinnig, das Aroma der Straße steigt einem in die Nase, die Probleme sind konkret. Die Nähe zu den jungen Frauen wird von der Kamera noch extrem betont: Sie hält kaum Distanz. Es geht um Jobs, die es für sie nicht gibt, um Jungens, um Klamotten, Joints, Ausgehen – um Zukunft, an die sie nicht glauben. Ihr Alltagsfrust und Angepisstsein münden nachts in der Berliner U-Bahn in Gewalt. Dabei kommt ein Student zu Tode, der von den Freundinnen zu Boden geschlagen und in den Schacht gestoßen wird, nachdem er sie harmlos angemacht hatte. Ein Video belegt die schlagzeilenträchtige Tat. Dann geht alles ganz schnell. Hazal flüchtet nach Ankara, kommt bei einem Freund unter, fühlt sich für Momente befreit, gerät ins Visier der Polizei wegen eines kurdischen Kontakts, versucht ihre Identität zu wechseln und verweigert, sich in Deutschland vor Gericht zu verantworten. Ihre Spur verliert sich.
16. APRIL, 19 UHR, FILMPALAST, KÖLN (FESTIVALERÖFFNUNG)
17. APRIL, 18 UHR, ODEON, KÖLN
20. APRIL, 18 UHR, SCHAUBURG, DORTMUND
Lernen, Ich zu sagen
»Chuck Chuck Baby« von Janis Pugh
Eine Pusteblume schwebt von draußen in das Schlafzimmer einer Frau hinein und in ihre Hand. Das Leben von Helen (Louise Brealey) in Wales aber ist alles andere als ein Blütentraum. Sie wohnt mit ihrem Ex-Mann, dessen neuer Freundin und sterbender Mutter Gwen zusammen, die Helen liebevoll umsorgt, um in der Nachtschicht am Fließband einer Hühnerfabrik zu arbeiten. Musik ist das Lösungs- und Erlösungsmittel aus der Tristesse. Neil Diamonds »I am … I said« etwa. Einer der vielen Songs, die die weiblichen Figuren des Films von Janis Pugh auf den Lippen tragen und mitsingen, wenn sie aus dem Radio, vom Recorder oder Plattenspieler erklingen. Lieder, die die Welt bunter aussehen lassen, so dass selbst die blauen Arbeitskittel die Farbe zu wechseln und die Höfe der Arbeitersiedlung ihren trüben Anstrich zu verlieren scheinen. Lieder, die handeln von Veränderung, Lebendigkeit und Freiheit (»Freedom the lesson we must learn«). Doch die Entscheidung für eine andere Möglichkeit von Leben muss erst erstritten werden, zunächst gegenüber sich selbst. Joanne (Annabel Scholey) ist zurückkehrt in die »dirty old town«. Früher war Helen heimlich in Joanne verliebt. Ob das Gefühl noch da ist und ob es hält? Und wie begegnet Joanne den Spuren und Verwundungen der eigenen Vergangenheit, die sich ihr eingekerbt haben. »Chuck Chuck Baby« ist mehr und anderes als ein nettes Feel-Good-Musical. Es härtet sich an der Wirklichkeit, der die Frauen in der Fabrik mit deftigem Humor begegnen, um sich ihren Alltag (»For all of these simple things«) zu erleichtern. All das Ungelebte, Aufgestaute, Aufgesparte versetzt die Menschen in Rage oder in Stagnation und Verzweiflung, aber befähigt Helen und Joanne doch, einander Ja zu sagen. Da darf es dann Pusteblumen schneien.
18. APRIL, 20.30 UHR, Filmforum NRW, KÖLN
20. APRIL, 20.15 UHR, SCHAUBURG, DORTMUND
Das Ganze und seine Teile
»Family Time« aus Finnland
Die Klinke wird gedrückt, wir sehen Hände von Personen und die Mitte ihrer Körper, aber – noch – nicht die Gesichter. Einzelteile addieren sich im Weiteren zum Ganzen, um sich danach wieder zu zergliedern. Die Mitglieder einer Familie treffen nach und nach ein. Tia Kouvos Debüt »Family Time« zeigt im ersten Kapitel ein Weihnachtsfest mit Lachs-Essen und Gesang im Haus der Großeltern, einer hölzern braunen Wohnhöhle. Kein seltenes Motiv, erinnern wir uns, um in Skandinavien zu bleiben, an Bergmans »Fanny und Alexander« oder auch an Woody Allens »Hannah und ihre Schwestern«. Das Fest wird aber nicht wie beim dänischen Kollegen Thomas Vinterberg zur Generalabrechnung. Erzählt wird in ruhigen distanzbewussten Einstellungen, manchmal abgelöst von einer bewegten Handkamera, die die Zimmer des für sich allein im Schnee liegenden, Lichter geschmückten Hauses (Sauna inklusive) erkundet. Aufmerksam für das Alltägliche, interessiert an den ordinary people, ihren Eigenschaften, Gesprächen und Gewohnheiten, Sehnsüchten, Blockaden, auch Missgeschicken, die den Heiligabend humorvoll ins Profane bugsieren, und insgesamt etwas ins Tschechow-hafte changieren. Das zweite Kapitel, im Neuen Jahr, wechselt die Perspektive. Der Organismus Familie wird zerlegt, und wir beobachten, wie seine Glieder unabhängig voneinander funktionieren, als Paar, als Eltern und Kinder, gut oder weniger gut, routiniert, krisenhaft in Szenen einer Ehe oder in der dem Alter geschuldeten Einsamkeit. Am Ende kommt noch einmal die Tür ins Bild, aber die Klinke kann nicht gedrückt werden: Wir hören einen Sturz auf der Schwelle, ohne ihn zu sehen. Die Familie versammelt sich zur Beerdigung. Eine Leerstelle bleibt.

Das andere 1968
Agnès Varda dokumentiert die »Black Panthers«
Die Revolte ist auch eine Stilfrage, das Symbolische wirkt machtvoll: schwarzes Leder, schwarze Barette, schwarze Sonnenbrillen und das natürlich krause (nicht mehr geglättete) Haar. Die straff organisierte, radikale Forderungen formulierende Black Panther Party versteht sich auf solche Zeichen für ihre Brüder und Schwestern. Weiß ist weiß, und Schwarz soll schwarz sein. Es ist nicht die Zeit für Aufhellung. »Black ist honest and beautiful.« Damit beginnt Agnès Varda, Ikone des französischen Films und europäischen Autorenkinos, ihre Dokumentation von 1968. Es ist das Jahr der Ermordung von Martin Luther King, Emanzipationsbewegungen und Empowerment sind auf dem Wege. Das Diffizile des Diskurses, wonach Sprechen die Frage aufwirft, in wessen Name und aus wessen Geist jemand das Wort führt und ob er Legitimität dafür besitzt, gibt es noch nicht. Unterlegt von Soulmusik, sehen wir fast nur junge Gesichter einer neuen Generation, die sich politisiert und aufbegehrt. Ein Drittel der Bevölkerung der kalifornischen Stadt Oakland, in der Varda gedreht hat, ist schwarz und die für besonders brutal geltende Polizei (»the Pigs«) der Feind. Der 17-jährige Bobby Hutton wurde eines ihr Opfer. Für einen anderen, Huey Newton, der wegen Mordes angeklagt ist, den er nicht begangen haben kann, wird vergebens demonstriert. So schreibt sich die Chronik der Demütigung, Entrechtung, Willkür, Gewalt fort. A never ending story.
21. APRIL, 14 UHR, FILMHAUS, KÖLN (ZUSAMMEN MIT DEM FILM »A PLACE OF RAGE«)
Das amerikanische Massaker
Donald Trump ante portas: »Hello Dankness« von Soda Jerk
2016. Das gewisse Wahljahr in den USA, wir wissen, wie es ausging, nicht Bernie Sanders, nicht Hillary, sondern The Bad Orange Man löste Barack Obama ab. Annette Bening schmettert wie die Streisand »Don’t rain on my parade«, während die Original-Barbra selbst später mit den Bee Gees ein Falsett-Duett singt und ihren Hit »Memory«. Schreckliche Erinnerungen an einen Präsidenten grundieren diese irre Revue. Was einmal mit Trump begann, kann nicht heil enden. »Hello Dankness« malt ebenso verspielt wie verbittert den Amerikanischen Traum als realen Horror aus. Der Film sampelt, montiert, collagiert, addiert, hypertrophiert und ist ein grandioses unfair play mit Mythen und Monstrositäten Amerikas: Hollywood, Musicals, der Shutdown im Western, Comic, Katastrophenkino, Walt Disney, Hitchcock, Mel Brooks, Scorsese und Sergio Leone, John Carpenter, Indiana Jones und Freddy Krueger, die ewig junge Jugendkultur von Shirley Temple, »American Graffiti« und Kevin alone, Schwarzenegger und Ice Cube, Zombies und das reale Phantom Putin, Jane-Fonda-Blondinen und zwischendrin der All American Boy Tom Hanks. Das Empire, das jeder gute Amerikaner in seinem Haus und Vorgarten verteidigt, wie es die gepflegte Steven-Spielberg-Vorstadt-Welt und weniger idyllisch David Lynch zeigen, schlägt zurück. Der Boden tut sich auf, die Apokalypse ist nah, in Erwartung, dass Roland Emmerich den »Independence« Day ausruft. Die schlimmsten Fantasien sind wahr geworden: Der Demokratie droht das Ende.
17. APRIL, 20 UHR, Filmhaus, Köln
Zum Festival
Vom 16. bis 21. April 2024 stellt das IFFF Dortmund+Köln rund 90 aktuelle und historische Filme vor. Neben den Wettbewerben und den großen Festivalsektionen wie »begehrt! – filmlust queer« gibt es weitere Formate, darunter etwa die Reihe »Spot on, NRW!«, bei der es diesmal um die Kölner Produzent*innen der Weydemann Bros geht. Mit dem Nachwuchspreis für Künstlerinnen der KHM wird Laura Engelhardt gewürdigt. Die belgische Kuratorin Marie Vermeiren hat aus dem 10.000 Filme umfassenden Festivalarchiv in Dortmund den feministischen Klassiker »The Girls« von Mai Zetterling (1968) ausgewählt. Außerdem wird unter anderem im »Special Screening Frauenfußball« an »COPA 71«, das erste internationale Frauenfußballturnier 1971 in Mexico City erinnert, und vom 16. bis 19. April ein umfangreiches Programm aus Dokumentar- und Animationsfilmen für Kinder und Jugendliche angeboten.