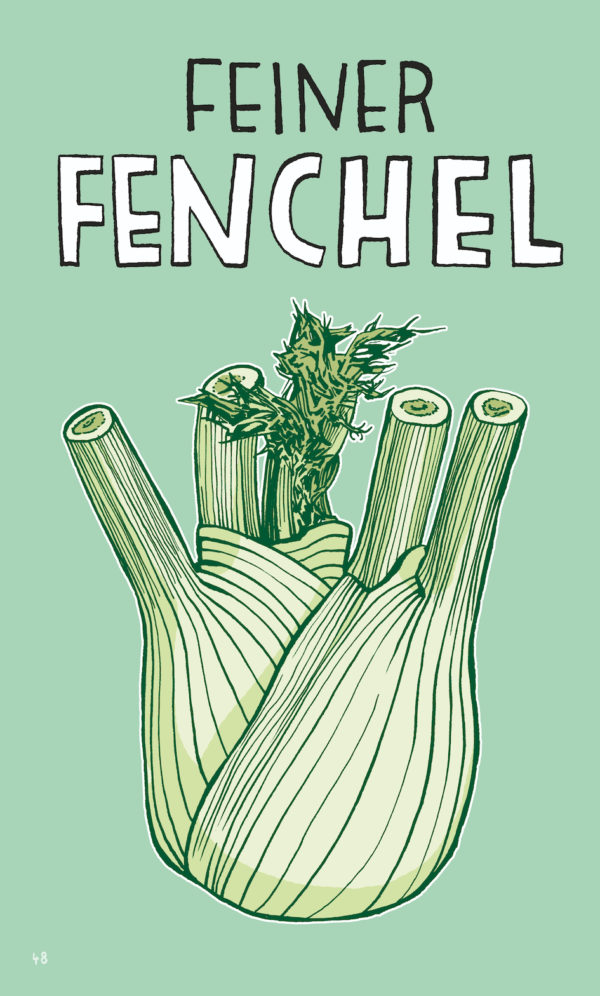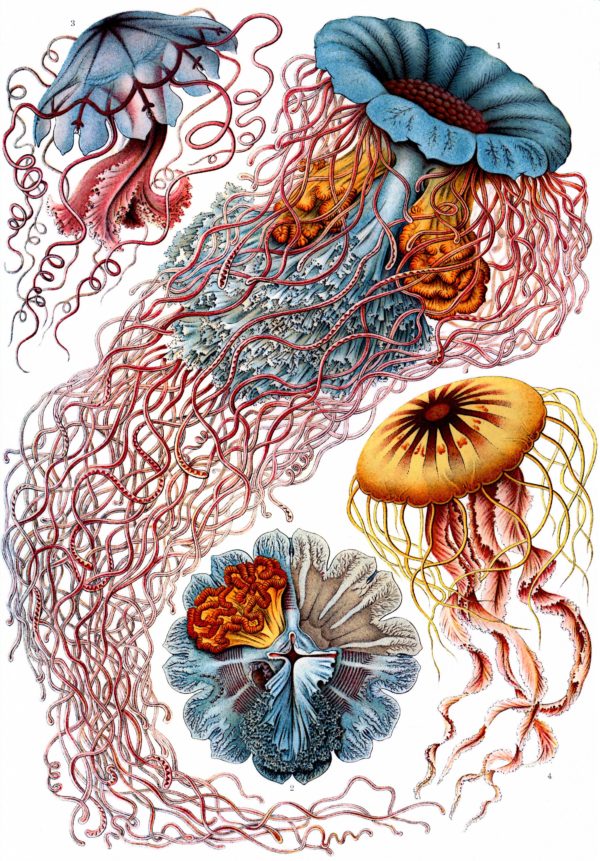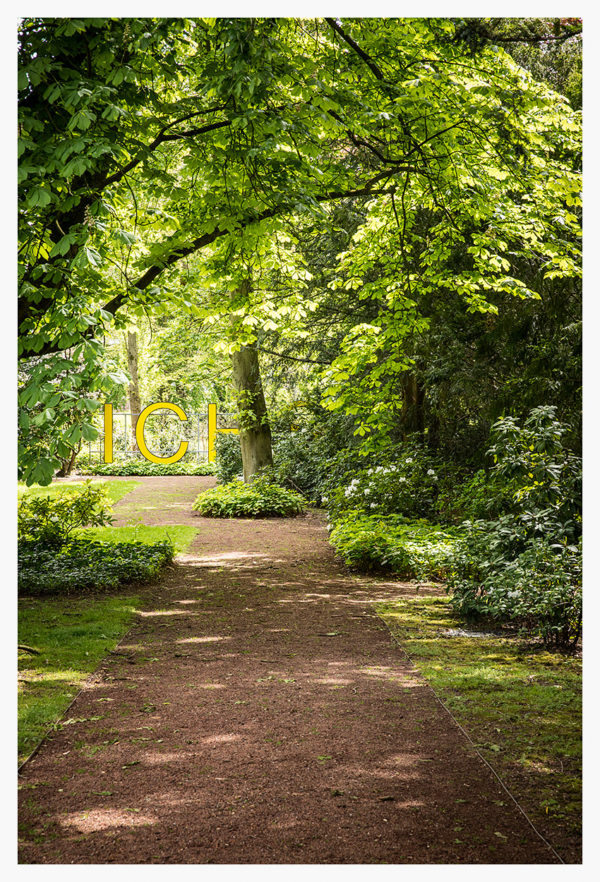Vor ein paar Jahren kannte der Duden das Wort noch nicht. Jetzt nimmt er »kuratieren« zur Kenntnis als »schwaches Verb«. Dem grammatikalisch gemeinten Verdikt möchte man vehement zustimmen angesichts der dubiosen Etymologie. »Kurator« kam natürlich von curare = pflegen, als man Museumsangestellte so bezeichnete, die eine Sammlung behüteten, erweiterten und, in Teilen, ausstellten. Niemand sah eine Notwendigkeit, ihre Arbeit mit einem eigenen Verb zu belegen. »Kurieren« ging ja auch schlecht.
Doch dann etablierte sich im Gefolge Harald Szeemanns und der »documenta 5« ein neues Berufsbild des an keine Institution gebundenen freien Kurators, der an wechselnden Orten Ausstellungen mit verschiedenen Zutaten moderner Kunst unter einem tatsächlich oder vorgeblich gemeinsamen Thema – nun ja: konzipiert, komponiert, organisiert und propagiert. Während der verwandte Kustos auf das Museums-Habitat beschränkt blieb, bekam der Kurator so eine zweite, schillernde Seite. Für sein Tun musste nun doch ein Verb her, und da sich jenes oft auf internationaler Ebene abspielt, »übersetzte« man curating in kuratieren. Dieser Missgriff ist wohl längst inkurabel. Aber was hat es damit auf sich, dass neuerdings einfach alles kuratiert werden soll: Gespräche, Tanz, Modenschauen, der »Content« des Web? Was ist am Kuratieren der Kunstwelt so sexy, dass das Wort in alle Lebensbereiche sickert?
»Ich weiß gar nicht, woher dieser inflationäre Gebrauch kommt«, sagt Florian Matzner, zuletzt gerühmt für seine Ruhr.2010-»Emscherkunst«. Dass er diese Großausstellung zwischen Kanal und Kloake kuratiert habe, weist Matzner von sich: »Ich bin Ausstellungsmacher«, sagt er. Das klinge manchen Leuten zu hausbacken gegen den globalen Kurator. Aber so nenne sich inzwischen ja fast jeder, der gerade keinen festen Job habe in der Kultur.
Feste und gar unbefristete Jobs würden immer rarer, sagt Matzner, auch Museen »arbeiten immer häufiger mit freien Kuratoren – die sind ja viel günstiger.« Und »der ganze Markt boomt, insofern gibt es da ein weites Betätigungsfeld.« Matzner ist für diesen Markt der temporären Kunstereignisse, der Biennalen und Triennalen und der Kunst im öffentlichen Raum das beste Beispiel. Er weiß freilich auch: »Es gibt nur wenige, die sich allein mit dem Kuratieren über Wasser halten können.« Er selbst, Professor für Kunstgeschichte in München, tut es auch nicht, obwohl er das Ausstellungsmachen »von der Pike auf gelernt« hat.
Beim konzeptuellen Überbau für Ausstellungen hält Matzner »einiges für übertrieben. »Ich überschätze meine Funktion da nicht. Ich sehe mich als Anwalt der Künstler beim Versuch, mit Veranstaltern – und Sponsoren – ein Projekt auf die beste mögliche Weise zu realisieren.« Das geschehe immer zusammen mit den Künstlern, ohne ihnen dabei ein Konzept überstülpen zu wollen.
Ähnlich sieht das Raimund Stecker, Direktor des Duisburger Lehmbruck-Museums und zwischen 2005 und 2010 selbst freier Kurator. Er halte nichts davon, wenn der Name des Kurators prominenter gezeigt werde als die Namen der beteiligten Künstler. Die Position des Kurators sei medial zu sehr in den Mittelpunkt gerückt worden, analog zur Rolle eines Filmregisseurs. Den »Stars« unter den Kuratoren kreidet Stecker überdies an, dass sie immer mit der gleichen Künstler-Truppe umherzögen: »Ich finde das allzu vorhersehbar.«
»Ich bin eher Teamplayer«, sagt Stecker. Die eben beendete Duisburger Ausstellung zu Wilhelm Lehmbrucks »Kniender« sei in erster Linie von einer Kuratorin des Hauses und zwei »Top-Gastkuratorinnen« verantwortet; doch insgesamt seien zwölf Leute daran beteiligt gewesen. Kunsthistorische Ausstellungen will Stecker grundsätzlich in Händen der hauseigenen Kuratoren/Kustoden oder ausgewiesener Experten für das jeweilige Thema wissen. Bei zeitgenössischer Kunst sieht er da mehr Freiheit. Da könnten zum Beispiel auch Praktikanten von den Unis Bochum oder Düsseldorf zum Zuge kommen.
Auch Sabine Maria Schmidt kennt Geschichten von Galerien, die Bilder eines hauseigenen Künstlers präsentieren und dann von einer »kuratierten« Schau sprechen; »früher hätte man gesagt: Ich hänge eine Ausstellung.« Schmidt wehrt sich emphatisch gegen solch beliebigen und »inflationären« Gebrauch des Begriffs: »Kurator ist ein Beruf, ein wichtiger und großartiger Beruf«, der Professionalität verlange, Erfindungsreichtum, Präzision und Komplexität. »Grundlegende und gesellschaftlich relevante Fragestellungen mit einer Ausstellung formulieren und dabei künstlerische Positionen nicht übertönen, sondern verstärken« – so sieht Schmidt ihre Aufgabe. Bloße Verwaltung oder Kunstmarketing seien »tödlich«, doch als Künstlerin sehe sie sich ebenso wenig. Eher als »Artenschützerin« für nicht marktkonforme Künstler.
Sie selbst hat nach klassischer Ausbildung – Promotion, Volontariat, freiberufliche Arbeit – alle Aggregatzustände des fertigen Kurators durchlaufen. 2002 bekam sie eine feste Stelle im Duisburger Lehmbruck-Museum als Kustodin. Doch 2007 wechselte sie zum Museum Folkwang, als Kuratorin für zeitgenössische Kunst, trotz eines befristeten Vertrages. Sie bereue den Schritt keineswegs, sagt Schmidt. Projekte und Ausstellungen wie im Folkwang hätte sie sonst kaum irgendwo verwirklichen können. Am neuen Dasein als freie Kuratorin schätzt sie die Möglichkeit, Projekte ganz unabhängig vom Profil einer Institution zu entwickeln. Andererseits könne die Geschichte eines Hauses eine durchaus positive Filterwirkung haben; seit einiger Zeit würden wieder deutlich mehr Ausstellungen mit klarem Bezug auf Sammlungen und historischen Zusammenhang kuratiert. Wo Schmidt künftig ihre Schwerpunkte setzt, lässt sie noch offen.
Promotion in Kunstgeschichte oder verwandten Fächern, dazu ein Volontariat, das ist noch immer der klassisch-seriöse Weg zum Kuratorenberuf. Immer häufiger werden außerdem spezialisierte Ausbildungen geboten, so seit 2009 in Bochum der Aufbaustudiengang »Kunstkritik und kuratorisches Wissen«. Ulrike Groos, damals Leiterin der Kunsthalle Düsseldorf, initiierte das Projekt zusammen mit Beate Söntgen, Professorin für Kunstgeschichte in Bochum. Sie habe, sagt Groos, bei wissenschaftlichen Praktikanten mehrfach festgestellt, dass es an Kenntnissen vom Alltag in Museen fehlte: Budgetierung, Sponsoring, Kontakt mit Künstlern, Vermittlung. Verfassen von Texten, die sich nicht an ein wissenschaftliches Publikum richten.
Zwei Semester dauert die Weiterbildung, angeboten vom Kunsthistorischen Institut der Universität, aber nicht als Teil der Studienordnung. Es gibt daher keinen akademischen Abschluss, sondern ein Zertifikat. Die zehn Studierenden des aktuellen Jahrgangs haben alle nicht nur einen Master-Abschluss in Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und verwandten Fächern; sie haben auch in unterschiedlichem Maß praktische Erfahrungen gemacht, wenngleich noch nicht als Kuratoren. Sie sehen daher die Weiterbildung nicht nur als Chance für mehr Praxis, sagt Programmleiterin Dorothee Böhm, sondern umgekehrt auch als Gelegenheit, den angestrebten Beruf noch einmal theoretisch zu reflektieren.
Solchen Grundlagen ist das erste Semester gewidmet – zumeist in Kompaktseminaren, da die Studierenden von überall her kommen, nur nicht aus Bochum und Umgebung. Da wird dann, zum Beispiel, der Besuch im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie vorbereitet, mit kritischem Blick auf die Frage, ob die Ausstellung »Global Contemporary« dem gesetzten Thema kuratorisch tatsächlich gerecht wird.
In den Semesterferien werden alle Teilnehmer eine sechswöchige »kuratorische Assistenz« ableisten, in einem der zahlreichen teilnehmenden Museen zwischen Bielefeld und Mönchengladbach. Aus dieser Assistenz muss sich ein kuratorisches Projekt entwickeln, das durchaus Chancen hat, auch verwirklicht zu werden.
Dass neun von zehn Teilnehmern des Jahrgangs Frauen sind, ist kein Zufall. Die Zukunft des Kuratierens ist weiblich. Dass die prominenten Stellen in Museen und Kunsthallen noch immer von Männern dominiert sind, wird sich denn auch bald ändern, meint Ulrike Groos. Die Frauen seien einfach zu gut. Die Bochumer Nachwuchs-Kuratorinnen jedenfalls werden nicht nur professionelles Rüstzeug mitbringen; sie scheinen auch durchaus realistische Vorstellungen von der Praxis ihres Traumberufs zu haben. Sie stellen sich darauf ein, dass sich sie erst einmal »von Projekt zu Projekt« hangeln und »flexibel sein« müssen, dass es auch finanziell schwierig werden könnte. Wie viele andere junge Menschen im modernen Kulturbetrieb lassen sie sich davon nicht schrecken.
Deswegen erliegen sie doch nicht dem Glamourbild des um den Globus jettenden, supereinflussreichen Star-Kurators. Sie lassen, à la longue, Sympathie für die Anbindung an eine Institution erkennen. Nicht nur wegen der regelmäßigen Bezahlung. Sie sehen auch, dass Projektarbeit an wechselnden Häusern immer von neuem viel Organisation erfordert, die mehr als im Rahmen einer Institution und ihrer Sammlung auf Kosten inhaltlicher Arbeit gehen kann. Die Erfolgsquote früherer Absolventinnen des Studiengangs ist durchaus ermutigend. Für Jennifer Crowley zum Beispiel erwuchs aus ihrem Praktikum beim Museum Folkwang eine selbstkuratierte Ausstellung über den Künstler Pidder Auberger. Sandra Dichtl leitet den Dortmunder Kunstverein. Sarah Sonderkamp arbeitet in der Verwaltung der Sammlung Olbricht.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete übrigens neulich aus Berliner Galerien, dass der umsatzschwache Januar Hochsaison sei für Nachwuchskünstler und »kuratierte Ausstellungen«. Das heißt, es muss auch wieder andere geben, die irgendwie – nun ja: gemacht werden.