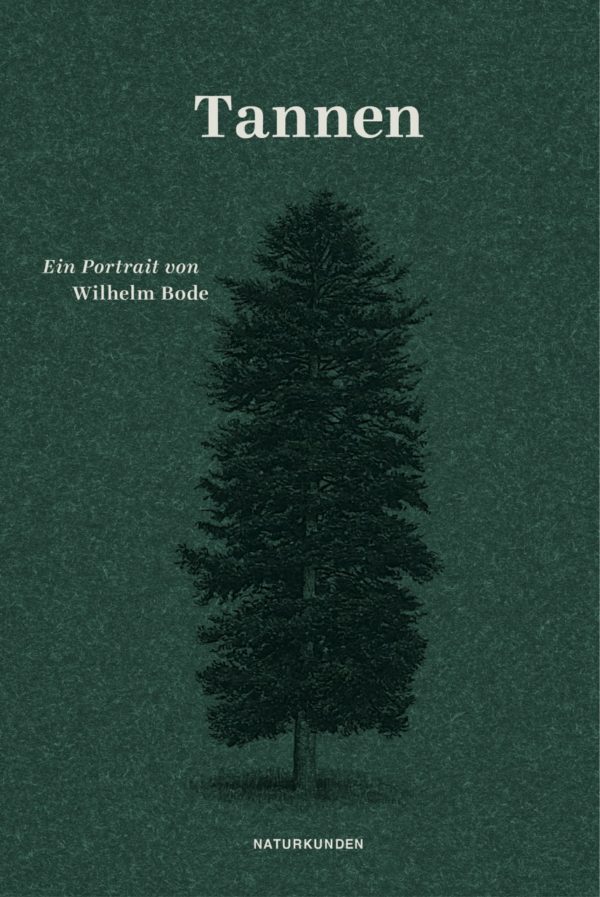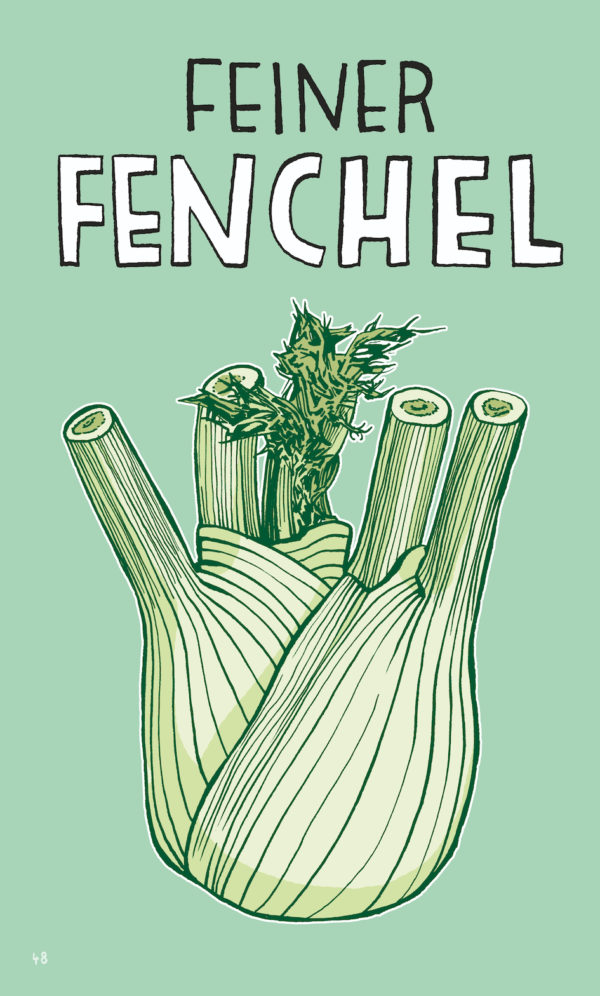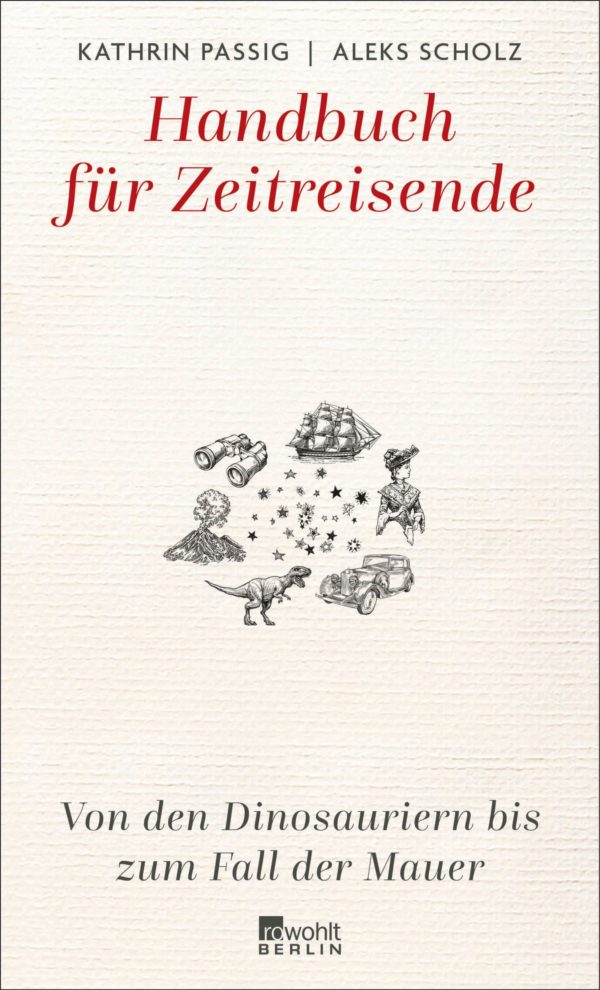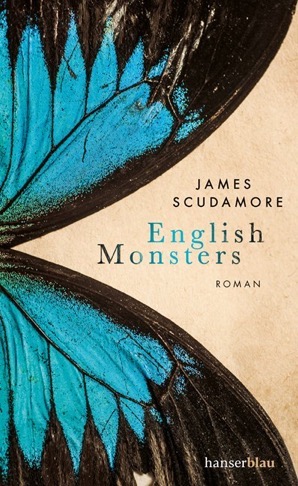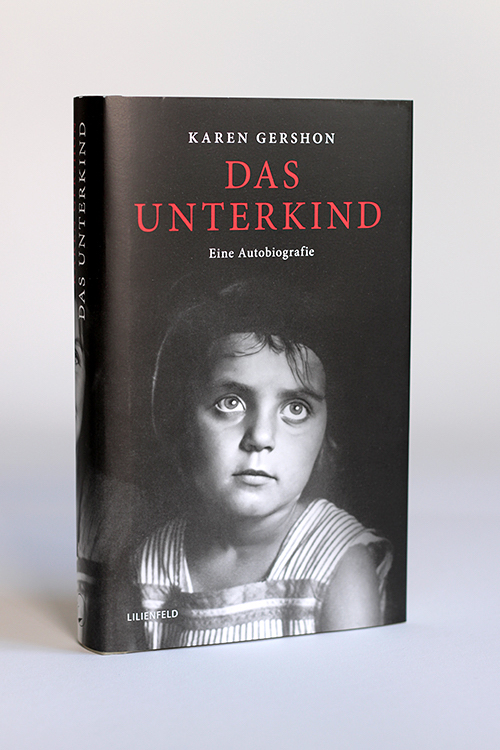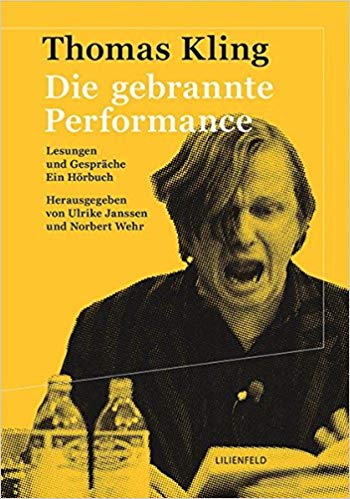Als »Tattoo-Mann« der deutschen Literaturszene wurde Clemens Meyer bezeichnet. Als ließen sich durch den Hinweis auf Meyers Tätowierungen auch seine Geschichten beglaubigen, die häufig von Menschen handeln, die sich auf der Schattenseite des Lebens einzurichten versuchen. »Hart« ist ein Wort, das oft bemüht wird, wenn von der Literatur des 1977 in Halle Geborenen die Rede ist. Gemeint ist seine Sprache genauso wie das Leben, von dem Meyer erzählt.
»Wenn die Farben dich bedecken, bist du in Sicherheit«, schreibt Clemens Meyer in seinem Vorwort zur wunderbar aufgemachten Anthologie »Das Herz auf der Haut«. Sie versammelt literarische Geschichten über das Tattoo, überraschende Funde wie einschlägige Texte, von Ray Bradbury über Wolfgang Hildesheimer, John Irving, Egon Erwin Kisch bis hin zu Sylvia Plath. Am 9. Juni stellt Meyer das Buch zusammen mit den Herausgebern Benedikt Geulen, Peter Graf und Marcus Seibert im Blue Shell in Köln vor, begleitet von Rui Lobo am Akkordeon.
K.WEST: Was stellt das erste Tattoo dar, das Sie sich haben stechen lassen?
MEYER: Eine Eidechse.
K.WEST: Welche Bedeutung hat das Motiv für Sie?
MEYER: Der Tätowierer konnte Eidechsen ganz gut. Andere Sachen weniger. Also habe ich eine Eidechse genommen. Es war Zufall. Damals fand ich, dass es ganz gut aussieht, ein bisschen nach Neuer Sachlichkeit. Ich habe die Eidechse allerdings später mit einer Schlange übertätowieren lassen.
K.WEST: Können Sie sich noch an die Gefühlslage erinnern, aus der heraus Sie es sich haben machen lassen?
MEYER: Als ich mit 18 von der Schule kam, hatte ich das Gefühl, dass es Zeit für etwas Krasses ist; etwas, das mich von der Masse abhebt. Ich hatte damals eine andere Lebenseinstellung. Manchmal kann es auch andere Gründe haben, warum man sich tätowieren lässt: Ein Tattoo ist ja auch eine Art Schutzpanzer, der Selbstvertrauen gibt und abschreckt. Und es ist immer auch eine Rebellion gegen die Vergänglichkeit, gegen das Fließen der Zeit.
K.WEST: Hat Ihnen das Etikett »Tattoo-Mann« als Schriftsteller geholfen oder eher geschadet?
MEYER: Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich habe mich ja nicht tätowieren lassen, um im Betrieb für Erregung zu sorgen. Ich schreibe für meine Leser. Natürlich hat es Aufmerksamkeit auf mich gelenkt. Damals gab es Pressefotos, auf denen ich ein kurzärmeliges Hemd trage und meine tätowierten Arme zu sehen sind.
K.WEST: Aber irgendwann hat Sie der »Tattoo-Mann« dann gestört.
MEYER: Während der Leipziger Buchmesse 2006 erschien in der Welt ein Artikel über eine Lesung, in dem behauptet wurde, ich wäre herumgelaufen und hätte jedem meine Tätowierungen gezeigt. Angeblich hätte ich damals auf der Bühne ein Statement abgegeben, demzufolge mein »kleiner grüner Drache« immer, wenn ich 100 Euro verdiene, einen neuen Flügel bekomme.
K.WEST: Das stimmt nicht?
MEYER: Das war eine unverschämte Lüge, aber sie war von da an in Umlauf. Dieser Mensch war überhaupt nicht bei der Lesung dabei gewesen. Wenn es Sommer ist und ich zur Arbeit gehe und schwitze, ziehe ich mir auch mal ein kurzärmeliges Hemd an. Das ist es dann auch. Alles andere ist Kolportage. Dass es für den Literaturbetrieb bemerkenswert ist, dass ein Schriftsteller tätowiert ist, ist nicht mein Problem.
K.WEST: Häufig wird die Tatsache, dass Sie selbst großflächig tätowiert sein sollen, als Beglaubigung eines manchmal exzessiven Lebens herangezogen. Aus diesem Leben, so geht die Geschichte, speisen sich die »härtesten Geschichten«, die derzeit in Deutschland geschrieben werden. Beim Lesen des Vorworts zu »Das Herz auf der Haut« kann man hingegen den Eindruck gewinnen, dass es Autoren wie Stevenson, Cook oder Melville gewesen sind, die Ihr Interesse am Tätowieren überhaupt erst geweckt haben. Dann hätte nicht nur das Leben Spuren in der Literatur, sondern die Literatur Spuren im Leben hinterlassen.
MEYER: Ich habe mir im Vorwort die Freiheit genommen habe, hier und da zu romantisieren. Richtig ist, dass ich als Kind viel gelesen habe. Das Motiv des Tätowierens tauchte in den von mir geliebten Seefahrer-Romanen natürlich mehrfach und eindrucksvoll auf. In Kneipen und in dem Viertel, in dem ich damals wohnte, bekam ich viele Menschen zu Gesicht, die auf ihren Armen geheimnisvolle blaue Zeichen trugen. Das konnte einem aufmerksamen Kind nicht entgehen.
K.WEST: Aber die Faszination, die für Sie von Tattoos ausgeht, hat auch etwas mit der Abenteuerlust zu tun, die ihren Trägern traditionell zugeschrieben wurde?
MEYER: Hinzu kommt dann noch eine bestimmte Philosophie. Ich habe mein erstes Tattoo 1996 machen lassen. In einer Zeit, als es noch nicht an jeder Ecke Tattoo-Läden gab. Damals war das Tattoo noch ein bisschen anrüchig und gesellschaftlich noch nicht so akzeptiert wie heute.
K.WEST: Als das Tattoo dann Mitte der 90er auf den verlängerten Rücken vieler Frauen gewandert ist, hat es seine Kraft als Unterscheidungsmerkmal verloren …
MEYER: … Sie meinen das Arschgeweih? Diese Art von Tätowiererei ist heute ad acta gelegt.
K.WEST: Aber mit dem Inflationärwerden des Tattoos hat es seine soziale Bedeutung eingebüßt. Arthur Rimbaud konnte noch schreiben: »Ich werde mir den ganzen Leib wundschneiden, ich werde mich tätowieren, ich will hässlich werden wie ein Mongole.«
MEYER: Gestern war ich in Berlin und habe in der U-Bahn einen Mann gesehen, der bis an den Hals hoch tätowiert war, überall. Das signalisiert sofort: Ich bin ein harter Typ. Ich habe ihn mir lange angeschaut. Solche Art von Tätowierung interessiert mich. Das hat mit Mode nichts zu tun.
K.WEST: Und Ihre Tattoos wollen Sie vermutlich auch nicht als Schmuck verstanden wissen?
MEYER: Viele der Tätowierungen auf meinem Arm sind alt. Sie sind teilweise schon verblasst. Körperzierde ist das nicht. Wenn jemand große Teile des Körpers tätowieren lässt, will er sich unterscheiden. Aber Sie haben Recht, heute ist es nichts mehr Besonderes, sich tätowieren zu lassen. Bei Fußballern sieht man manchmal sogar großflächige Tattoos. Tätowierte Millionäre riskieren nichts. All die, die ihre Schäfchen nicht im Trocknen haben, können sich nicht leisten, derart aufzufallen. Die haben dann ein kleines Tattoo auf dem Oberarm.
K.WEST: So wie die Frau des Bundespräsidenten.
MEYER: Genau. Wie heißt die noch? Die zieht dann ab und an Klamotten an, die ihr winziges und nicht gut gestochenes Tribal sehen lassen. Dass selbst da noch drüber getuschelt wird, ist schon merkwürdig. »Oh, die Frau des Bundespräsidenten ist tätowiert.« Naja.
K.WEST: Nervt Sie, dass ein Tattoo heute Mainstream ist?
MEYER: Eher nervt mich, wenn ich in Talkshows Meret Becker im Top sitzen sehe, damit man auch ja sieht, was sie sich hat stechen lassen. Damit der Moderator dann fragt: »Oh, sie haben ja ein neues Tattoo auf der Schulter?« Und dann sehe ich ein winziges Teil. Ein kleines Accessoire.
K.WEST: Welche Rolle spielt der Schmerz beim Tätowieren?
MEYER: Ich gehe ungern zum Zahnarzt und hasse Schmerzen. Wenn man mir Blut abnimmt, muss ich mich hinlegen, damit ich nicht umkippe. Vor meinem ersten Tattoo hatte man mir erzählt, es sei wie ein leichtes Kribbeln. Als es dann losging, dachte ich, ich falle um. Aber man gewöhnt sich dran. Es ist eine Art Auseinandersetzung mit sich selbst, eine Art Meditation: Die Zeit vergeht langsam, man muss aushalten und die Maschine summt laut dazu.
K.WEST: Mal daran gedacht, die Tätowierungen entfernen zu lassen?
MEYER: Um Gottes Willen. Das macht kein Mensch, der sich ernsthaft tätowieren lässt. Wozu denn auch. Sonst hätte ich es ja überhaupt nicht machen lassen brauchen.
»Das Herz auf der Haut«, Hrsg. von Benedikt Geulen, Peter Graf und Marcus Seibert. Mareverlag, Hamburg 2011, 368 S., 24,90 Euro
Lesung am 9. Juni um 21:30 Uhr im Blue Shell, Köln. www.literaturhaus-koeln.de