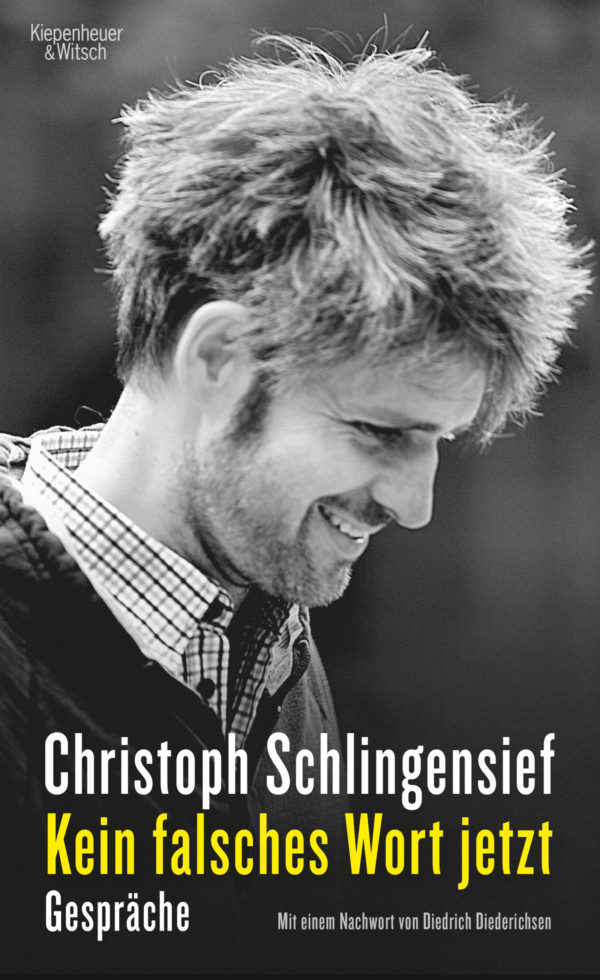Alles wurde über ihn gesagt, das meiste hat er selbst gesagt – und besser als wir anderen. Christoph Schlingensief war nach oder doch wohl eher noch vor Harald Schmidt der größte Master oft the Ceremonies im deutschen Medien-Cabaret. Er war ein Genie, wie Einar Schleef, wie Rainer Werner Fassbinder, so sagt es Elfriede Jelinek, sie hat Recht damit. Der Apotheker-Sohn aus Oberhausen, der in der dortigen Christuskirche ministrierte und dort betrauert wurde – u.a. mit einem Schubert-Lied aus der »Winterreise«, gesungen von Josef Bierbichler –, der Assistent von Werner Nekes, der experimentelle Filmemacher, der sich auf Fassbinder, der Aktionist, der sich auf Beuys berief, der Volksbühne-Heros, der Talkshow- und Freakshow-Dompteur, der Biennale-Künstler, der Afrika-Helfer und Heilssucher, der Bayreuth-Regisseur des »Parsifal« mit dem Gral als verwesendem Hasen und der Amfortas, der seine Krebs-Wunde zeigte und uns sein Leiden und Sterben austeilte wie Christus Brot und Wein, der schwarze Romantiker und konkrete Utopist: Er war »des Chaos wunderlicher Sohn«, wie Goethes Mephisto vom lieben Gott genannt wird. Luzifer, der gefallene lichte Engel. »Und mag ein Teil auch missgestaltet sein, die Wahrheit ist das Ganze.« Den Satz von ihm hatte ich für lange Zeit an meinem Schreibtisch angeheftet. Ich kannte Christoph Schlingensief seit 1984, als er mir seinen ersten Spielfilm »Tunguska – die Kisten sind da« gezeigt hat, im von Klaus G. Jaeger geleiteten Filminstitut der Landeshauptstadt Düsseldorf. Er war ein zuvorkommender, liebenswerter, zutraulich herzlicher Freund.
Gequält, genau, gehetzt
Ich erinnere mich an einen gemeinsam verbrachten Abend in den späten 80er Jahren, also vor seiner Berliner Volksbühne-Zeit. Er erzählte mir einen seiner Träume, in dem er – wie in einer Fritz-Lang-Szenerie – zum Mörder geworden war. Erzählte es mit einer Gequältheit, Genauigkeit und Gehetztheit eines Franz Woyzeck, als sei die Trennwand zwischen Fantasie und Tatsächlichkeit durchlässig. Fragil und gefährdet.
Ich will sein Werk – Filme, Theater und Musiktheater, Aktionen, Ausstellungen, Hörspiele, Bücher – nicht zu fassen versuchen. Stattdessen einen Abend, eine Aufführung dokumentieren, die während des von Matthias Lilienthal geleiteten Festivals »Theater der Welt« im Sommer 2002 in Stadttheater Duisburg stattfand, die ich in einer Kritik publiziert habe (SZ, 25. Juni 2002). Es war keines seiner großen Projekte, wie er sie von Hamburg bis Wien, von Berlin bis Zürich inszeniert hat, wenngleich eines der provokantesten, das die eigene Selbstüberforderung zum Äußersten trieb. Es enthielt alles, was in seinem Traum-Report sichtbar und sagbar geworden war: die Angst und die »ganz große dionysische rituelle Veranstaltung«. Schlingensief war sein eigener Doppelgänger und sein eigener Fremdkörper, ganz wie in einem Kippbild: »Ich mag ein begnadeter Selbstdarsteller sein, aber ich stelle mich nicht selber dar, sondern ich stelle etwas dar. Ich habe in allen meinen Filmen selber Rollen vorgespielt. Ich stelle also noch nicht mal Christoph Schlingensief dar, weil ich in Wirklichkeit gar nicht der Christoph Schlingensief bin, den alle meinen.«
»Der Hahn ist tot«
Christoph Schlingensiefs »Aktion 18« gegen Jürgen Möllemann
Duisburg. Es ist 20.15 Uhr, die Tagesschau geht gerade zu Ende, als im Theater Duisburg der Gong ertönt, als würde nun eine reguläre Abonnement-Vorstellung beginnen. Die Tonanlage ist schon eingeschaltet, wummert leise und unterlegt mit ihrem Geräusch die Erwartungshaltung. Es dunkelt, der rote Vorhang bewegt sich und eine junge farbige Frau in einem Etwas aus weiß-rosa Tüll rezitiert einen Text, in dem vom »Egoismus des Leidens« die Rede ist und davon, die Wunden aufzureißen und den Schmerz zu wecken. Es werden zwei Stunden des Zorns sein, fragmentarisch, aus improvisierten und performativen Elementen montiert, Solonummer, Conférence, Animation, Attacke, Entblößung, Beschädigung, weniger einer stringenten Dramaturgie folgend als dem Impuls gehorchend.
Zeit zum Nachdenken. Ich denke mich zwei Abende zurück, als im Düsseldorfer Schauspielhaus Frank Castorf gastierte mit seiner grandiosen Dostojewski-Bearbeitung »Erniedrigte und Beleidigte«. Heute Abend in Duisburg aber, beim Festival »Theater der Welt«, ist Christoph Schlingensief da; auch er könnte eine Dostojewski-Figur sein: Fürst Myschkin, »Der Idiot«, ein Mann Gottes.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach zehn Minuten zitiert Schlingensief Jesus Christus – die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz. Die Spur des Heiligen in der Kunst ist ein alter Pfad, der nicht als Mittelweg verläuft. »Blut Schweiß Tränen« drohen Tafeln auf der Showbühne an. Der Auftakt der »Aktion 18«, den der Junge aus Oberhausen im Rahmen seines »Quiz 3000« hier »in einer Gegend, die die Sozialdemokratie vergessen hat«, darbietet, ist auch ein Passionsspiel. Wer weiß, ob von J.S. Bach oder aus Oberammergau? Nach zehn Minuten klinkt er zum ersten Mal aus, ohne dass die Maske der Verzerrung den wuscheligen Bubencharme ganz zerstören könnte, wie Jesus im Tempel, der die Händler aus dem Haus des Vaters vertrieb, und trampelt auf einem Konterfei von Jürgen Möllemann herum, dessen Porträt an der Rampe neben dem blutbesudelten von Robert Steinhäuser angelehnt steht. Jesus war eben nicht nur der friedfertige Verkünder der Bergpredigt. Bei Matthäus heißt es: »Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.«
An diesem Abend wird Christoph Schlingensief sagen, was er vor Jahren gegen Helmut Kohl forderte: »Tötet ihn«. Er sagt es in einem Kunstraum. Als Happening, bei dem es für einen Moment auch so aussieht, als würde er einen Hahn mit einer Axt erschlagen haben. Voodoo-Rituale, Teeren und Federn und anderer Abwehrzauber. Das ist die erregt heißkalte Antwort des politischen Aktionskünstlers auf eine politische Strategie, die für ihn – wie für viele – finstere irrationale Regungen befördert und mit ihnen kalkuliert. Deshalb auch umhalst er das Bildnis des Amokläufers von Erfurt – wie Nietzsche in Turin das Pferd – und nennt ihn »Freund«. Schlingensief ist ein Fanatiker darin, sich gegen Mehrheiten zu stellen; einer, der zugleich weiß, dass »Minderheiten Minderheiten beschmutzen, um sich dadurch zu erhöhen«. Nur durch das Aussprechen des Unaussprechlichen, nur aus dem Provozieren des Missverständlichen erhofft er sich – noch – kathartische Wirkung. Manchmal müsste man ihn vor sich selbst beschützen. Manchmal will man ihn trösten.
Aber nicht so wie der Grünen-Politiker Cem Özdemir, der gekommen ist und in salbungsvollen, harmoniebewussten, matten Formeln den Diskurs pflegt und ansonsten so peinlich herumsteht, dass Schlingensief höhnt: »Da hinten lacht einer«. Angesichts der grünen correctness schreit er »Tut doch was«, rastet aus und zieht seine Nummer mit dem Hahn durch. Er will Blut sehen, um das Leben zu spüren.
In grauem Tweed und mit gedeckter Krawatte scheint Schlingensief nur so smart, wie Kerner gern wäre, so seifig, wie Heck immer war. Ein verspäteter Lenny Bruce, ein »King of Comedy« wie Jerry Lewis, der von Robert de Niro entführt wird, ein Trash-Sammler, Müll-Beseitiger, Demagoge. Und nur noch Schatten und Echo seiner selbst. Er braucht die Bühne, wo er allein übers Kuckucksnest fliegen kann. Unberechenbar, undurchschaubar. Fast eine tragische Figur. Abgründig, unglücklich, melancholisch wie Fellinis monströser müder Casanova. Wäre Helmut Dietl ein Kerl, hätte er diesen Schlingensief für die »Late Show« engagiert.
Hat sein Scheitern noch eine Chance? Die Linie ist haarfein, auf der dieser Borderliner balanciert. Man weiß nie, wann er sie überschreitet, ob er je die Medien-Manipulation und Regie-Macht abgibt, ob er selbst noch glaubt, dass gut ist, was sein theatrales, reales Handeln vermittelt. Wohl behält er die Kontrolle über sein System: über sich selbst, den Co-Moderator Horst, über die Elvis-Imitation Werner Brecht, seine Mitwirkenden, seinen Zirkus, die mit Fanfaren begrüßet Freakshow, seine zehn Assistentinnen, bei denen er den Grabscher markiert. Er spielt ein Ratespiel, bei dem die Kandidaten »Ordnungsfragen« beantworten, die die FDP betreffen, antisemitische Äußerungen, dubiose Geschäfte des Herrn Möllemann mit arabischen Ländern und »Schurkenstaaten«, Verbindungen im Zwielicht der Nazi-Vergangenheit.
Qualen verursacht, dass Schlingensiefs moralisch rigider Impetus – unauflöslich – zugleich auch Spielform ist, reflektierter, ironisch gebrochener Gestus: wenn er die israelische Flagge mit dem Davidstern entrollt, Solidarität bekundet, Westerwelles Betroffenheit in Yad Vaschem parodiert, wenn er mit einem halb verschluckten Nebensatz Schlesien Deutschland zuschlägt: »wenn Stoiber siegt«, wenn er Pim Fortuyn salutiert. In die Objekte seines Hasses hinein spiegelt und montiert das Multiplikations-Talent immer auch raffiniert gesellschaftliche Reaktionen auf eben diese Figuren.
Austreibung der Geister. Nein, es ist kein heiterer Abend. Schlingensief weiß, dass er nur verlieren kann. Dass sein Mobilisieren extremster Maßnahmen, im Frei- und Leerraum des Polit-Entertainment verbleibt: Gott sei Dank, vermutlich. Diese Resignation bleibt spürbar bei den wütenden Kampfansagen, dem messianischen Trieb, dem tobenden Gebaren. Dann gleicht er Peter Finch als Howard Beale in Sidney Lumets Film »Network«, wenn der Anchor-Man in seiner TV-Nachrichtenshow das Publikum auffordert zu skandieren: »Ich mach’ das nicht mehr länger mit. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken.« All das macht diese ‚Vorstellung’ so maßlos traurig, gespenstisch, verzweifelt munter wie einen Ball der einsamen Herzen. Am Ende ist er ganz verhetzt, verschwitzt, blutverklebt.
So sehen Helden in Hollywoods Action-Kino nach erledigter Arbeit aus, weshalb eine düstere Musikcollage erklingt, unter anderem aus »Alien« und David Lynchs Wild at Heart«, denn es kann kein Happy End geben. Als der Vorhang fällt, ist es Zeit für Sabine Christiansen. Der Dialog geht weiter. Christoph Schlingensief geht ab.
Der Text ist entnommen dem Buch »Aus der Fernnähe. Begegnungen mit Theater- und Filmkünstlern« von Andreas Wilink, C.W. Leske Verlag, Düsseldorf , 2019, mit freundlicher Genehmigung des Autors.