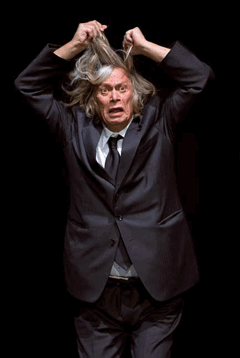// Mit Dimiter Gotscheff lässt sich besser schweigen als reden. Es ist, als würde er seinen Augen mehr trauen als Worten. Er schaut tief, lang und unverwandt sein Gegenüber an, so dass einem die Anekdote über Herbert Wehner in den Sinn kommt, nach der der knorrige SPD-Zuchtmeister jemanden zu sich bestellt, wohl eine halbe Stunde mit ihm stumm zusammen gesessen und ihn dann mit der Bemerkung verabschiedet habe, dies sei ein gutes Gespräch gewesen. Wenn Got-scheff dann mal zu reden beginnt, rau und warm, ist es stockend, zögernd, tastend. Ein Kampf, etwas über die Lippen zu bringen. Keine Floskeln und griffigen Formeln, keine taktischen Manöver, nichts von der Smartness unserer umworbenen theatralen Muntermacher, Alleskönner und Selbstdarsteller.
Ich dachte, als ich mit ihm vor 16 Jahren – da hatte er gerade Klaus Pohls Stück »Die schöne Fremde« aus dem realistischen Elend ihrer Uraufführung durch Heyme befreit – auf einem Podium im Düsseldorfer Schauspielhaus saß, an dem Mann haftet kein Parfüm. Alles pur. Er setzt eine eigene Duftmarke. Das Verschlossene und zugleich Direkte, das von ihm ausgeht, ist so verstörend wie anziehend. Biomasse Mensch.
Ebenso wird in Gotscheffs Theater der Mensch zum vegetativen System. Und der Mund zur Wunde – oder zum Geschlecht wie in einer surrealistischen Montage von Dalì, Buñuel oder Hans Bellmer. Der Mund öffnet einen Spalt zur Welt und reißt ein Loch ins Netzwerk sozialer Übereinkunft. Der Mund »als Fleisch, das zu reden beginnt«, beschreibt Gotscheff den Vorgang und hat – wie immer – ein Heiner-Müller-Zitat parat: »Der Mund entsteht mit dem Schrei«. Abnorme Auswüchse, die bis zu Slapstick und Blödelei ausarten dürfen, sind bei ihm gewissermaßen gattungsspezifisch als Conditio humana.
Das entfesselte Chaos und Getöse auf seinen Bühnen ist ein reaktives Verhalten zum Schweige-Gebot. Die Bühne Welt kracht in ihrem Getriebe, die Maschinerie rotiert. »Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei«, sagt die Frau/Stimme in Heiner Müllers »Auftrag«. Doch lässt sich diese Offerte auch der leichten Muse ablauschen: »Lippen schweigen, flüstern Geigen … Hab mich lieb«, walzert es durch Lehàrs »Lustige Witwe«, deren selige Vergessens-Melodie Gotscheff von seiner Winnie in Becketts »Glückliche Tage« summen ließ. Cry Freedom. Hinter den apokalyptischen Figuren in seinen während 30 Jahren entstandenen Inszenierungen bleckt, grinst, trauert die Gesellschaft im Wissen, dass »die Fata Morgana des Schlaraffenlandes von der Totenstarre befallen« (Adorno) ist.
Gotscheff ist Bulgare. 1943 geboren, kam der Sohn eines Tierarztes 1962 nach Ost-Berlin, um Veterinärmedizin zu studieren. Dort wurde ihm das Theater des Benno Besson und Fritz Marquardt zur prägenden Erfahrung und Orientierung. Er wusste, wie es sich im Schatten betonierter Titanen lebt. Die DDR verließ er nach der Biermann-Ausbürgerung wieder, kehrte nach Bulgarien zurück und wurde dort 1983 mit seiner Inszenierung von Heiner Müllers »Philoktet« schlagartig berühmt. Nicht zuletzt dank eines Briefes des Autors an den Regisseur. Müller schrieb ihm, durch die Aufführung sein Stück neu gesehen zu haben (»mit seiner grimassierenden Spielweise schreibt Gotscheff den Riss in die Figur….«). Klaus Pierwoß ist es zu danken, der ihn ans Schauspiel Köln engagierte, dass Gotscheff im westdeutschen Theater Fuß fasste und besonders an drei Bühnen Nordrhein-Westfalens Spuren hinterließ: in Köln bei Günter Krämer, wo Strindbergs »Fräulein Julie« 1992 zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde; in Düsseldorf unter Volker Canaris; und von 1995 bis 2000 während der unterschätzten Intendanz von Leander Haußmann als Mitglied des Direktoriums am Schauspielhaus Bochum.
In der personalen Konzentration, im Identifikation herausfordernden Erscheinungsbild und Wiedererkennungswert erreichte Bochum damals etwas, das sonst nur Castorfs Berliner Volksbühne, das Hamburger Schauspielhaus unter Baumbauer und Marthalers Verlobung mit Zürich schafften. Aus dem Abstand, der einem größer vorkommt, als er kalendarisch ist, sieht der Bochum-Block Gotscheffs weniger geschlossen und entschlossen aus, als seine Projekte während der Bindung an Düsseldorf und Köln und der folgenden Phasen in Hamburg oder Berlin. Erstaunlich, wie nahezu konventionell die Stückwahl mit Beckett, Kleist, Lorca, Pinter, Pirandello, Shakespeare und Walser (mit Ausnahme von Cervantes’ »Don Quixote«) wirkt. Die Gotscheff-Gruppe besaß in Bochum nicht mehr und wiederum noch nicht die vertraute Dichte – vielleicht auch daran ablesbar, dass fünf Bühnenbildner an den neun Produktionen beteiligt waren.
So sind die Arbeiten in einem höheren Maße als ohnehin bei ihm »Versuche« gewesen, wie der Grübler Gotscheff gern zweifelnd jede neue Exegese und deren Ergebnis nennt. Ein gewisser Potenzverschleiß war spürbar. Vorübergehend. Gotscheffs Rigorismus, der Verbindlichkeiten ignoriert und Konterbande in die Klassiker schmuggelt, die Widerständigkeit in der Haltung zum Text, den sich die Schauspieler einverleiben, um ihn durch ihre Sinnes- und Geschlechtsorgane zu filtern, hatte bisweilen die Tendenz, sich methodisch zu festigen. Der Formwille wechselte gelegentlich ins Formelhafte. Deformation ist Gotscheffs Thema, wobei in Bochum eine gewisse déformation professionelle spürbar wurde.
Wo aber Gotscheff sich ins Ungewisse vortastet, Lemuren züchtet, Nachtwache hält, bis sich die Umdüsterung blitzlichtartig aufhellt, Funktionsstörungen ins Bild fasst, sich purifiziert, sich aus der Retro-Realität einen Jux macht, weil Schwermut im Witz ein Ventil findet, kommen seine Inszenierungen zu sich selbst.
Er ist ein Künstler, der sich nie selbst kommentiert und außerhalb des Theaters unsichtbar bleibt, ein Querkopf, der u.a. in Frankfurt, Hannover, Wien, Hamburg und Berlin (Deutsches Theater, Volksbühne) Theater machte. Besonders in den jüngsten fünf Jahren mobilisiert er imponierend kreative Energie und wagt ästhetische Neufindungen, wie sie sein Tschechow-»Iwanow«, Molières »Tartuffe« und Aischylos‘ »Perser« zeigen. Gerade auch in Kombination mit den Bühnenbildern von Katrin Brack und stets, wie er selbst vehement erklärt, dank des Ensembles.
Wer von Gotscheff redet (auch mit ihm redet), muss von den Schauspielern sprechen. Sie sind und müssen sein: besessen, überdreht, Phantom-, Zerr- und Schreckensbilder, Spottgeburten, halb gefüllte Masken, die in ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit in ein gottverlassenes Nichts kosmischen Ausmaßes starren. Keine Gesellschaftswesen. Unschlitt. Relikte im gefrorenen Meer der Geschichte. Dazu gehört an erster Stelle seine Frau Almut Zilcher. »Die Bühne steht dir aber gut«, habe Gotscheff bei der allerersten Probe zu ihr gesagt, erzählt sie und denkt zurück an den ersten Kontakt: »Zuerst die Stimme, die hat mich begeistert, dann die Augen und dann die Hände. Na ja, und die Haare – die Mähne«. Der graue ungebärdige Schopf, der ihm seitlich ins Gesicht flutet, damals schon und immer noch. Gotscheffs eigene Erinnerung an das erste Wahrnehmen Zilchers auf der Bühne in Frankfurt, fasst er in einen seiner typischen Sätze, knapp, ruppig, wegwerfend und doch eine Liebeserklärung: »Da war so ein Fleck«.
Man muss unbedingt Samuel Finzi erwähnen, seinen Landsmann, den artistischen Luftgeist, der überhaupt das Ideal des Gotscheff-Schauspielers ist, in frühen Jahren ein hochnervöser Kasper mit Narrenfreiheit, längst ein grandios gereifter Menschendarsteller. Oder Wolfram Koch und Margit Bendokat. Und viele mehr. In Bochum waren es Henriette Thimig – seine stärkste, vitalste Protagonistin, Anne Tismer und Judith Rosmair, Peter Jordan und Matthias Leja.
Gotscheff scheint der Gedanke Genets nicht fern zu stehen, dass »der einzige Ort, um in den heutigen Städten noch ein Theater zu bauen, der Friedhof« wäre. Totengeläut (und sei es lautlos) jedenfalls ist oft zu hören in seinen Inszenierungen, »weil die Menschen halt keine Menschen sind«, wie die Marianne sagt in Horváths »Geschichten aus dem Wiener Wald«, von Gotscheff vor ein paar Jahren am Deutschen Theater inszeniert. Seine dramatischen Bruchstücke und Herzstücke lassen sich überschreiben mit: La Grande Illusion. Er schaut mit dem Blick des Fremden auf die Texte und auf die Körper der Schauspieler. Was er sieht, sind Trümmerlandschaften.
»Was für ein Ich« bleibt da? Womit wir bei Kleist und seinem Identitäts-Schwindel von Amphitryon und Jupiter, Sosias und Merkur im preußischen Theben sind – Gotscheffs erster Regie bei Haußmann im November 1995. »Ich bin ein Mensch da komm ich her da geh ich hin.« Gebetsmühlenhaft repetierte der Sosias des Joachim Król den einen Satz, bis der Refrain im Dienst der Selbstvergewisserung jeden Sinn und Kant’sche Gewissheit vernichtet. So wie Gotscheff bis zum Erbrechen das höhere Lustspiel zur Farce maskierte und zynisch aus Kleist heraus kitzelte.
Da schien bereits jener mordsmäßige Molière zu rumoren, den Gotscheff (Salzburger Festspiele / Thalia Theater, 2006) als Untergangs-Propheten »Tartuffe« der Dritten Welt gegen die Erste Welt das Messer wetzen ließ. Gotscheffs Formbewusstsein, grimmiger Humor, Pessimismus, Pathos der Verzweiflung und politischer Instinkt drücken sich aus in Choreografien des Untergangs, angetrieben von einer unerbittlichen Mechanik und im Banne von Heiner Müllers düster-barocken Prophetien und Totenklagen. Der Freiheitsgedanke der Kunst und ihr autonomer Anspruch bei gleichzeitigem Reflektieren gesellschaftlicher Zusammenhänge binden Gotscheffs Theater an die Tradition einer »Ästhetik des Widerstandes«.
Am 8. November erhält er den im Wechsel in den Kategorien Bildende Kunst, Film, Literatur und Theater vergebenen, mit 15.000 Euro dotierten Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum. Er ist der zehnte Preisträger seit 1990 und der dritte in der Sparte Theater nach George Tabori und Kurt Hübner. Die Verleihung im Schauspielhaus wird eröffnet mit der Inszenierung von Müllers »Hamletmaschine« (2007) mit Gotscheff selbst in der Titelrolle.
Der amerikanische Komponist Charles Ives hatte sich, nicht nur für sein Stück »Unanswered question«, das Gotscheff 1998 in seiner Bochumer Inszenierung von Pinters »Asche zu Asche« benutzte, auf den Philosophen Ralph Waldo Emerson berufen. Von dem stammt der Satz: »Aus den Trümmern unserer Verzweiflung bauen wir unseren Charakter.« Womöglich ist das eine Antwort, womöglich etwas, das Gotscheff aus dieser Musik heraushört und in seine Arbeit hineinlegt. Es wäre der Bochumer Nachklang.
Der Autor war Mitglied der Jury zur Verleihung des Peter-Weiss-Preises.