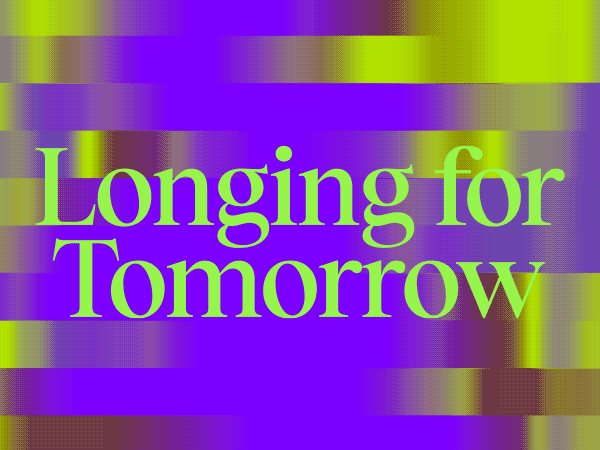Wir alle streben danach – aber was ist es eigentlich, diese Inspiration? Und wie kommt sie zu uns? Ein Gespräch mit der Philosophin Rita Molzberger.
kultur.west: Frau Molzberger, was ist Inspiration?
RITA MOLZBERGER: Das Wort kommt aus dem Lateinischen »inspirare« also »Einhauchung« und »Einflößen«. Es ist häufig auch in die Nähe von »Begeisterung« gesetzt worden – da ist der »Geist« dann auch mit drin –, aber auch von »Erleuchtung« und »Eingebung«. Im Lexikon der philosophischen Begriffe steht, es ist ein »scheinbar unvorbereitetes Betroffen- oder Ergriffensein von einem Gedanken oder einer Einsicht oder Idee«. Man hat also das Gefühl, es kommt so über mich, etwas fährt mir ein und ich habe dann Zugang zu Wissen, das ich vorher nicht hatte. Es lassen sich auch viele kultische Verbindungen dazu ziehen. Zum einen, dass man versucht diesen Zustand herzustellen, mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten oder dem Metaphysischen, dem Spirituellen. Zum anderen der Glaube an Ursprungslegenden, nicht nur im Christlichen: Geschichten, wo jemandem Atem eingehaucht wird oder der Geist über ihn kommt. Das ist mit Inspiration gemeint.
kultur.west: Warum gibt es diesen Wunsch, nach einer Inspiration von außen?
MOLZBERGER: Dieser Gedanke, dass im Atem Geist ist, dass man von etwas beflügelt wird, das von außen oder von oben auf einen herabkommt, ist auch metaphorisch schön. Gerade weil es nicht von innen geleistet wird. Es stellt eine Verbindung her zum Übermenschlichen, zum Übervernünftigen, manchmal auch zum Unvernünftigen. So muss man nicht erklären, warum einem jetzt diese beknackte Idee zugeflogen ist. Bei einer Inspiration war es eine Eingebung, das kann niemand verifizieren. Das ist spannend am Inspirationsgedanken: man kauft eine Legitimation mit ein.
kultur.west: Aber eigentlich deutet ja alles bislang Gesagte darauf hin, dass es nicht komplett von außen kommt, sondern wir die Grundlagen selbst gelegt haben.
MOLZBERGER: Ja, genau. Wenn uns das vollkommen fremd wäre, dann gäbe es diese Verbindung nicht. Es gibt eine schöne Arbeit über Kreativität, die den ganzen Gedanken daran aufhängt, dass in der Michelangelo-Darstellung »Die Erschaffung Adams« zwischen den Fingern von Gott und Adam eine Lücke ist. Die Finger verweisen aufeinander, aber es ist eine Lücke da. Wenn da nur große Leere wäre, wäre nicht zu erklären, wie so etwas in mich kommt. Ich muss zumindest die Wahrnehmungsorgane dafür haben, das muss irgendwo bei mir andocken, es muss ein Sensorium dafür geben, damit dieses Etwas zu mir kommen kann. Aber die Vorstellung bleibt, dass es etwas Äußeres, etwas Gnadenvolles ist, was ich nicht selbst so herstelle.
«Auch scheinbar vom Himmel gefallene Ideen haben Vorläufer, sie kommen nicht aus dem Nichts.«
Rita Molzberger
Auch ein sehr inspirierter und neuer Gedanke hat irgendwo Ursprünge, oder Anleihen oder Verweise. Das ist zentral: Ich bediene mich bei anderen Gedanken und rekombiniere sie. Und trotzdem gibt es da diesen Moment, eben diese Lücke zwischen den zwei Fingern, wo man das Gefühl hat: Das ist jetzt neu.
kultur.west: Ich habe mich zwischendrin gefragt, ob vielleicht Philosophie aus Inspiration besteht?
MOLZBERGER: Das ist ein spannender Gedanke. Sie macht auf jeden Fall für sich geltend, dass sie das Gebiet ist – neben der Theologie – in der das eine Rolle spielt. Aber Philosophie definiert sich eher darüber, dass es eine bestimmte Art zu fragen ist. Und eine bestimmte Art, Wissen zu generieren. Da muss eben auch die Inspiration die Prüfung bestehen, ob es wissenschaftlich erhärtbare Fakten gibt und ob es ein systematisch erschließbarer Gedanke ist. Wenn ich sage, das ist singulär, das kommt oder kommt nicht, dann kann ich darüber philosophisch im engeren Sinne gar nicht nachdenken.
kultur.west: Wofür brauchen wir überhaupt Inspiration?
MOLZBERGER: Wenn es in der Nähe der Kreativität verortet ist, liegt es nahe, dass man es zur Problemlösung braucht. Aber dafür würde es ja reichen, zu rekombinieren. Dafür müsste ich nicht etwas Äußeres annehmen, was mir diesen Gedanken einhaucht. Eigentlich brauchen wir es, weil wir Menschen sind und weil eine unserer Kräfte die Phantasie ist. Weil wir uns mit den Verhältnissen beschäftigen, in denen wir stehen. Wir Menschen tun dies auf eine sehr spezifische Weise, deshalb gibt es die Kultur, wie sie bei uns ausgeprägt ist. Das heißt, wir lösen keineswegs nur Probleme, sondern wir gehen auch spielerisch mit unseren Kräften um. Es geht nicht nur darum, eine neue Funktion zu entwickeln, sondern um in Muße selbstzwecklich etwas zu tun, was mir Lust bereitet. Und das heißt nicht, dass es zweckfrei ist oder zwecklos, sondern dass es ein Vermögen ist, das Menschen haben und dessen sie sich gern bedienen. Das Spielen ist etwas sehr Spezielles, auch das geistige Spielen mit Ideen.
kultur.west: Wenn wir Inspiration also benötigen: Wie können wir sie fördern?
MOLZBERGER: Man kann natürlich Techniken üben – das wird ja auch in Workshops gelehrt. Alles ist áskesis, Übung, und sicher hat es auch einen Anteil, ich glaube aber nicht, dass man mit einem Werkzeugköfferchen viel weiterkommt. Was man üben darf, ist, den Geist auch mal leerlaufen zu lassen, Dinge ruhen lassen. Das ist ein Gedanke, der uns zunehmend fremder wird. Da wo er nicht Retreat und Entschleunigung heißt, sondern echte Ruhe und Muße, Alleinsein und sich dem widmen, was da so kommt. Genau das wird eigentlich überall beschrieben, wo Menschen eine wirklich neue Idee entwickelt haben.
kultur.west: Es klingt also als ziemlich unwahrscheinlich, dass wir auf etwas Neues kommen, wenn wir ständig auf Sendung sind?
MOLZBERGER: Das gibt es natürlich auch, zum Beispiel im Dialog: Wenn jemand eine gute Frage stellt, komme ich vielleicht auf etwas, was ich alleine nicht gedacht hätte. Aber um es dann weiterzuentwickeln zu einem systematischen Gedanken, brauche ich Ruhe, Muße, da muss ich allein sein und nachdenken. Von dieser Ruhe haben wir aber jetzt und hier relativ wenig. Insbesondere im Neoliberalismus und im Kapitalismus ist dieser Gedanke, dass es Muße und Ruhe braucht und selbstzweckliches Tun auch sehr verstörend, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass eigentlich alles zu irgendetwas gut sein soll. Da herauszutreten kann auch eine Herausforderung sein.
kultur.west: Wenn wir aber jetzt die Muße und die Ruhe mit dem Gedanken antreten, dass Inspiration dabei herauskommen soll, sind wir doch wieder in dem Kreislauf?
MOLZBERGER: Genau, das ist der Workshop, den ich meine: Jetzt nutze Digital Detox 72 Stunden lang und warte darauf, dass du hinterher erleuchtet wieder in den ICE steigst. Das ist natürlich Blödsinn. Kann passieren, ist aber höchst unwahrscheinlich. Es geht eher darum, die eigene Haltung noch mal zu überdenken. Und vielleicht mehr davon auch in den Alltag zu holen. Widerstände zu spüren und auszuhalten – und natürlich im Alltag auch zu funktionieren. Wenn ich ständig inspiriert bin und meinen Geist leer haben will, dann ist Alltag sehr schwer zu leben. Aber es ganz rauszurechnen, ist auch nicht gut. Da geht es sicher auch darum, Gleichgewicht zu üben.
kultur.west: Welche Begriffe gehören noch in den Kontext der Inspiration?
MOLZBERGER: Ich würde am schnellsten auf Kreativität kommen, dann bin ich aber noch gestolpert über Enthusiasmus. Der gehört unbedingt dazu, weil es das Ergriffensein vom Göttlichen meint. Da wo Menschen aus sich heraustreten; auch Ekstase, wo das Göttliche aus einem herausredet und handelt. Das ist relativ nah an Inspiration. Es ist keine unvernünftige Sache, aber sozusagen Vernunfttätigkeit mit Affekt, man hat dabei Gefühle. Bei Kant heißt das: dem Gemüt Schwung geben. Das passiert ja auch, wenn man die »Windstille der Seele« nach Nietzsche aushält, das ist ja nicht immer schön. Das fand ich stark an diesem Gedanken des Enthusiasmus, dass es so einen Schwung-Aspekt gibt. Und dann habe ich noch gedacht an die Nähe zum Begriff des Pathos, des Erleidens. Das ist nicht ganz so nahe da dran, aber da geht es auch um leidenschaftliche Erregung, Gemütsregungen, Affekte.
kultur.west: Für diejenigen unter uns, die nicht so viel Muße haben, gibt es ja das Hashtag #Inspo – für Inspiration – auf den sozialen Medien, ganz Pinterest lebt von dem Gedanken, dass es eine Inspirationsplattform sein will und dass wir ganz inspiriert einfach nur nachkaufen müssen. Und sogar Co-Working-Spaces werben mit dem Begriff Inspiration – ist das nicht eine ziemliche Banalisierung?
MOLZBERGER: Wenn man das philosophisch ernst genommen hat, ist es eigentlich pervers, den Begriff mit Lohn- und Erwerbsarbeit zusammenzubringen, weil es dem entgegensteht. Aber klar, das klingt halt irgendwie ganz cool, dass wir inspiriert werden und kreativ sind. Es wird vieles als Inspiration verkauft, was dem nicht entspricht. Es ist ein Kaufanreiz, aber bestimmt keine Inspiration und erst recht kein enthusiastisches Arbeiten.

Zur Person
Die Philosophin Dr. Rita Molzberger ist Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Neben pädagogischen Fragen beschäftigt sie sich in ihrer Forschung immer wieder mit Achtsamkeit, Langeweile, Muße und der kreativen Ausdrucksform Tanz. Gemeinsam mit Nora Hespers veröffentlicht sie seit 2017 den Podcast »Was denkst du denn?«, in dem Alltagsfragen philosophisch betrachtet werden.
Leseliste
Rita Molzberger hat eine kleine Leseliste mit Büchern zusammengestellt, die sie zum Thema Inspiration empfiehlt
- Simone Mahrenholz: Kreativität. Eine philosophische Analyse
- Ulrich Bröckling: Über Kreativität. Ein Brainstorming, in: Christoph Menke, Juliane Rebentisch (Hg.): Kreation und Depression. Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus
- Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität
- Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen
- Hans Joas: Die Kreativität des Handelns
- Karl Rahner: Über die Schriftinspiration
- Sarah Diehl: Die Freiheit, allein zu sein. Eine Ermutigung