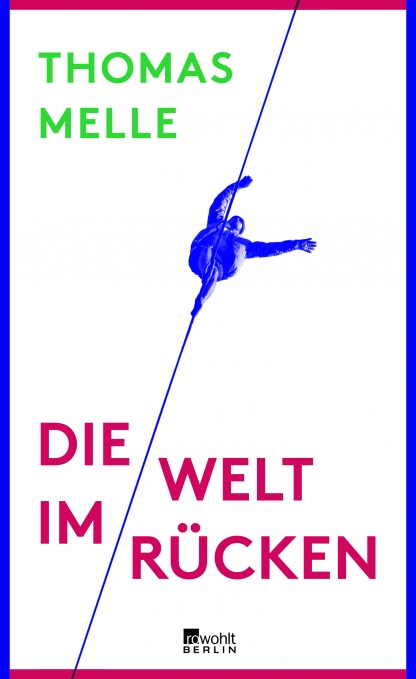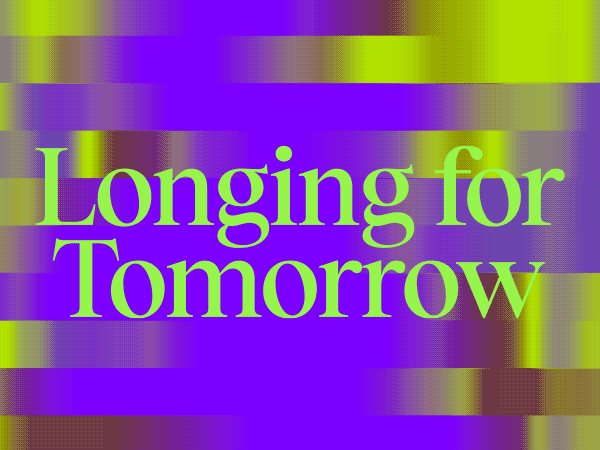Kaum ein Buch löste in dieser Saison so heftige Reaktionen aus wie Thomas Melles »Die Welt im Rücken«. Während Maxim Biller es im Literarischen Quartett als Katastrophe empfand, über diese Krankengeschichte überhaupt reden zu müssen, attestierten andere Rezensenten Melle »große Literatur« und die Jury des Deutschen Buchpreises nahm »Die Welt im Rücken« auf die Shortlist für den »Roman des Jahres«. Doch die Genrekriterien dieser Auszeichnung erfüllt das Buch nur bedingt. »Die Fiktion muss pausieren (und wirkt hinterrücks natürlich fort)«, schreibt der 1975 in Bonn geborene Melle im Prolog, und dem Nachsatz kommt dabei mehr Bedeutung zu, als es die Einklammerung vermuten ließe.
Melle leidet an einer schweren Form der bipolaren Störung, die man Ende des 19. Jahrhunderts mit Emil Kraepelin als »manisch-depressives Irresein« bezeichnete. Die bislang drei Schübe dieser Krankheit strukturieren Melles Versuch, das Trümmerfeld zu sichten, das er sich selbst seit Ausbruch kurz vor der Jahrtausendwende in den lang anhaltenden Phasen seiner Manie hinterlassen hat. Melle sprengt Vernissagen und Partys, randaliert und pöbelt, trägt seine Bibliothek ins Antiquariat, verwüstet Wohnungen, kündigt Mietverträge, meint, Sex mit Madonna zu haben, trifft auf Picasso und hört aus David Bowies Songs an ihn adressierte Geheimbotschaften heraus. Melle verstrickt sich in ein paranoides System von Verweisen und sieht Zeichen, wo keine sind. Dann folgt die depressive, in Selbstmordversuchen kulminierende dumpfe Zeit der »Minussymptomatik« mit wiederholten Zwangseinweisung in die geschlossene Psychiatrie.
Aus der Binnenperspektive versucht Melle sich in »Die Welt im Rücken« seiner eigenen Geschichte zu bemächtigen, um sich so ein für allemal auch von den Figuren zu befreien, die als Wiedergänger des zerstörten Selbst durch seine fiktionalen Texte geistern. Sein Leben setzt er zum »gescheiterten Bildungsroman« zusammen: das Aufwachsen in einer zerrütteten Familie im Bonner »Haribo-Slum«, das fatale Wechselspiel aus emotionalem Überschwang und Gewaltausbrüchen, das Studium in Tübingen, wo sich der hoch begabte Studienstiftler mit »Breitbandlernen« aus der Enge seiner kleinbürgerlichen Herkunft befreien will. Schon dort erlebte Melle nach einem Jahr des exzessiven Produzierens zwölf Monate des Zweifels und der Niedergeschlagenheit, was er im Rückblick als erste, damals nicht erkannte Depression deutet.
In den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von Krankheitsgeschichten erschienen, in Tagebuch- und anderer Form, von Christoph Schlingensief, David Wagner oder Wolfgang Herrndorf, um nur ein paar der herausragenden Versuche zu nennen. Muss man dem Interesse an diesen Texten eine voyeuristische Lust an der Katastrophe unterstellen? Für Thomas Melles »Die Welt im Rücken« braucht es das Wissen um die Fundierung im »richtigen Leben« des Autors nicht. Denn dank der stilistischen Präzision, des in seiner Bitterkeit feinen Humors und der bemerkenswerten Distanz, die Melle als Erzähler zum eigenen Unglück hat, würde »Die Welt im Rücken« zweifellos auch ohne das Label »wahre Geschichte« funktionieren.
Thomas Melle: »Die Welt im Rücken«, Rowohlt Berlin, Berlin 2016, 352 Seiten, 19,95 Seiten.
Lesung am 30. Januar 2017 im Literaturhaus Bonn (Haus der Bildung)