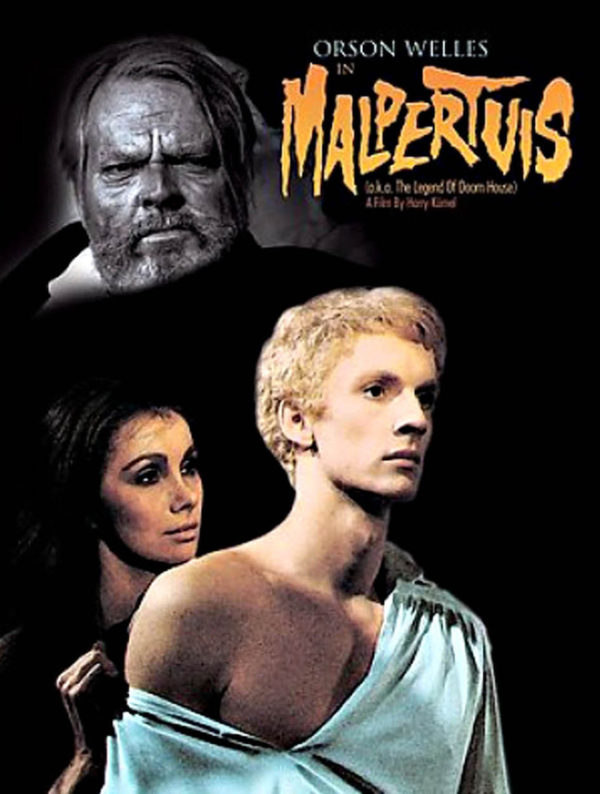Wenn die Kunst des Kinos darin besteht, Bilder für die Ewigkeit zu schaffen, dann hat Wim Wenders gleich eine ganze Galerie davon auf seinem Konto: Bruno Ganz als trauriger Engel auf der Siegessäule unter dem »Himmel über Berlin«, Nastassja Kinski in der sich spiegelnden Scheibe einer Peep Show in »Paris, Texas« oder Pina Bauschs Tänzer vor den Industriedenkmälern des Reviers.
Wer sich fragt, warum gerade sein Name im Ausland meist als erster fällt, wenn vom deutschen Kino die Rede ist, findet die Antwort in diesen Bildern. Nur ein visuelles Kino travels, wie die Hollywood-Produzenten sagen; es macht sich auf Reise und muss sich nicht vor Sprachbarrieren fürchten. Was nicht heißen soll, dass diesem Film- und Fotokünstler die Worte nichts bedeuteten.
Unterwegs als Reisefotograf
In einer Retrospektive im Düsseldorfer Museum Kunstpalast mit »Landschaften« hatte er den großformatigen Prints kleine Texte beigegeben, so wie im schönsten seiner vielen Fotobücher, der Bilder- und Geschichtensammlung »Einmal«. Wenn er stehende Bilder macht, begibt sich Wenders in die Rolle der alten Reisefotografen; und man staunt nicht schlecht, was er da alles erlebt hat: »Einmal traf ich Martin Scorsese/ unterwegs im Monument Valley./ Er lag unter seinem Auto/ und versuchte, einen Reifen zu wechseln./ Wir haben ihn und Isabella dann/ in unserem Wagen mitgenommen./ Es war eine vergnügte Reise.«
Es verwundert nicht, dass der am 14. August 1945 in Düsseldorf geborene Wim Wenders seine erste Produktionsfirma »Road Movies« nannte. Schon seine frühen Filme erzählten vom Unterwegssein. Die Blüte des Straßenfilms der 60er und 70er Jahre hatte Dennis Hoppers »Easy Rider« ausgelöst.
Mit diesem ebenfalls auch als Fotograf wirkenden Filmkünstler verband Wenders später eine enge kollegiale Freundschaft. Diese Filme kehrten dem alten früheren Kino buchstäblich den Rücken. Doch man musste nicht in die Ferne schweifen, um den Weg zum Ziel zu machen. Wenders’ frühes Meisterwerk »Alice in den Städten« führt einen gestrandeten Journalisten und ein neunjähriges Mädchen quer durch Deutschland – und findet dabei die betörendsten Schauplätze in Wuppertal.
Inzwischen sind Wenders’ wichtigste Filme mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW restauriert. Auf der letzten Berlinale, wo die restaurierten Fassungen in einer Werkschau liefen, konnte man hektische Branchenprofis dabei beobachten, sich mit ihnen eine Auszeit zu gönnen. Was man beim frühen Wenders findet, ist die Zeit an sich. Entstanden in einer Phase, als sich die Filmindustrie gegen die Übermacht des Fernsehens mit weißen Haien und Weltraumopern wehrte, entdeckte man mit Wenders die Langsamkeit. Seine Schwarzweißfilme »Im Lauf der Zeit« und »Der Stand der Dinge« verteidigten die Schönheit des schon damals vom Aussterben bedrohten Zelluloidfilms gegenüber dem beginnenden Videozeitalter.
Zu Besuch in der Düsseldorfer Wenders-Foundation
Wer die Düsseldorfer Wenders-Foundation besucht, das ebenfalls mit Hilfe der Filmstiftung aufgebaute Forschungszentrum, findet sogar die Notizzettel in gewaltigen Filmbüchsen archiviert. Auch diese Silberdosen sind inzwischen überholt worden vom Lauf der Zeit, obsolet durch digitale Datenträger. Auch wenn die restaurierten Farbfilme nun wieder in frischen Farben strahlen und die schwarzweißen hoffentlich ihr Filmkorn behalten haben: Ohne Wehmut kann man die digitalen Kopien nicht genießen.
Wenn Rüdiger Vogler als Filmvorführer in »Im Lauf der Zeit« erklärt, dass das Malteserkreuz eben doch kein Schnaps ist, sondern zentraler Bestandteil eines jeden Projektors, aber aus der Vorführkabine kein Rattern mehr zu hören ist – hat sich das Kino für immer von seinen Wurzeln gelöst. Hat sein Nest verlassen. Es ist, um mit dem frühen Wenders zu sprechen, »zwanzigtausend Lichtjahre« weg von zu Hause. Ob es dabei erwachsen geworden ist?
In seinen Filmen umarmt Wenders die neueste Digitaltechnologie, bis hin zu seinem jüngsten 3D-Spielfilm »Every Thing Will Be Fine«. Aber was stehende Bilder angeht, ist er ein Verteidiger des Analogen, und das nicht nur in technischer Hinsicht. Abgesehen von den Panorama-Aufnahmen entstehen all seine Bilder mit einer klassischen Mittelformatkamera, der 1975 entwickelten Plaubel Makina 67. Es ist die Analogie zur sichtbaren Wirklichkeit, der Wenders die Treue hält. Sein Beharren darauf hat etwas von jener mit Nachdruck vorgebrachten Unschuld seiner Engel aus »Der Himmel über Berlin«. So behutsam wie Bruno Ganz und Otto Sander dem rastlosen Menschengeschlecht ihre Hände auf die Schultern legen, nähert sich der Fotograf Wenders der Wirklichkeit und hält sie fest.
»Was mich an einer Photographie interessiert«, schreibt Wenders im Katalog der Düsseldorfer Ausstellung, »ist einzig und allein, dass sie mir etwas zeigt, was es gibt, dass ich in ihr nicht mehr und nicht weniger sehe als: Das gibt es also.« Potentiellen Zweiflern vorauseilend, fügt er hinzu: »Kann ich das so stehen lassen, ›ob es das gibt?‹? Sollte ich das nicht lieber in der Vergangenheitsform sagen, ›ob es das gab‹, wo ein Photo ja immer notwendig auf etwas hinweist, was es einmal gab und jetzt eben nur noch auf diesem Bild gibt.«
Meister filmischer Inszenierung
Die Gleichsetzung mit dem Sujet eines Bildes und seinem Vorbild in der Realität klingt ein bisschen wie der Unglaube des Kindes, dem man René Magrittes Gemälde einer Pfeife mit der Textzeile zeigt: »Dies ist keine Pfeife«. Wenders’ ungebrochenes Verhältnis zum Erinnerungswert der Fotografie klingt umso verblüffender, als es von einem Meister filmischer Inszenierung stammt.
Als Regisseur war Wenders in den 70er Jahren einer der wenigen auf der Welt, die gefundene fotografische Räume bespielen und narrativ aufladen konnten, wie es Michelangelo Antonioni vorgemacht hatte. Und dabei dem Zuschauer jenen doppelten Dienst erwiesen, der heute so selten geworden ist im Kino: nämlich Geschichten und Bilder zugleich zu sehen.
Im Kunstbetrieb zählt Wenders zu den international erfolgreichsten Fotografen; inzwischen beanspruchen seine Bilder ähnliche Formate wie die Arbeiten der großen Fotokünstler, aufwändig präsentiert hinter Acrylglasversieglung. Das fordert unwillkürlich den Vergleich mit der Düsseldorfer »Becher-Schule«. Doch Wenders, der Fotograf, spielt nicht in der Liga der zeitgenössischen Kunstfotografie eines Andreas Gursky oder Boris Becker.
Er ist nicht in erster Linie »Fotokünstler«, sondern gehört zu jener langsam aussterbenden Spezies von Fotografen, die nicht zuerst an das Bild denken, sondern an den Gegenstand. Auch Bernd und Hilla Becher dachten an Gegenstände, als sie die Industrie-Monumente fotografisch vor dem Verfall bewahrten. Gemeinsam ist allen immerhin, dass am Ende doch ein Bild dabei entsteht.
Fast unheimlich ist manchmal der ästhetische Mehrwert, den er dabei generiert. Erstmals sind in Düsseldorf vier Panoramabilder der Ruinen zu sehen, die die Anschläge vom 11. September in New York hinterließen. Als »Assistent« des von ihm bewunderten Fotografen Joel Meyerowitz hatte er die Bergungsstätte besuchen dürfen – und wurde plötzlich Zeuge eines rätselhaften Lichtspiels. »Der Himmel hatte sich geöffnet und es schien ein atemberaubendes Licht hinein. Mir war, als erhebe der Ort selbst die Stimme zusammen mit der verwundeten Stadt um uns herum.« Vielleicht brauchte es eines Regisseurs vom Range Wenders’, um die Erhabenheit des Naturereignisses einzufangen. So wie Werner Herzog in seinen filmischen »Lektionen der Finsternis« etwas Göttliches in den brennenden Ölfeldern von Kuwait erspähte. Lange hat Wenders gezögert, diesen ästhetischen Mehrwert angesichts des Schreckens vorzuführen. Doch man glaubt ihm, dass er keinen schöpferischen Ruhm beansprucht. Dass alles, was er von den Bildern verlangt, die einfache Botschaft ist: »Das gibt es also«.
Wenders ist jung geblieben. »Als das Kind Kind war«, beginnt einer der Engel-Monologe in »Der Himmel über Berlin«.Wim Wenders kann noch immer Bilder machen, die aussehen, wie sich die Welt einem Kind zeigt, das sie zum ersten Mal erblickt.
(Der Text ist zuerst am 1. August 2015 erschienen)