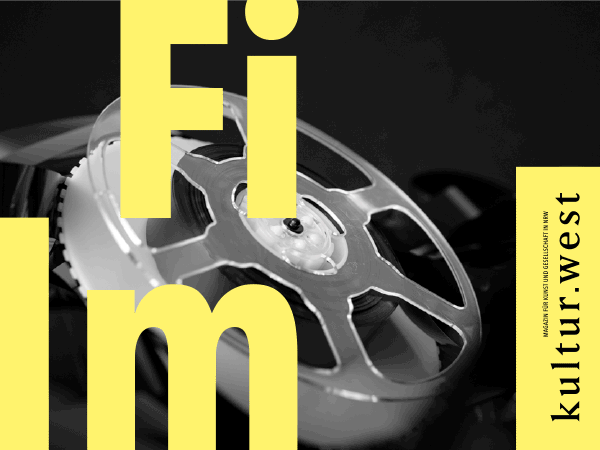TEXT: CHRISTOPH VRATZ![]()
In Frankreich haben sie einen hohen Popularitäts-Grad: weil sie Brüder sind, weil sie Musiker sind, und weil sie so unterschiedlich sind. Gautier spielt Cello, ist der Jüngere und nennt sich selbst den Flippigeren. Renaud, der Geiger, ist älter, bodenständiger, rationaler. »Die Capuçons glänzen im Übermaß mit dem, was man für genuin französisch erachtet – besonders in der Musik: Eloquenz, Esprit, untrügliches Stilgefühl, eine leichte, subtile Technik und einen feinen, unaufdringlichen Witz«. So urteilte für einigen Jahren die Welt, als der rasante Aufstieg der ungleichen Brüder im vollem Gange war.
Die Capuçons stammen aus Chambéry am Fuße der französischen Alpen – eine Gegend, wo das nächste Konzerthaus Dutzende Kilometer entfernt liegt. Studiert haben sie, wie fast alle namhaften französischen Musiker, in Paris. In ihren Klassen wurden sie jeweils mit ersten Preisen ausgezeichnet. Seither haben sie international Karriere gemacht, als Solisten und – kammermusikalisch vereint – im Duo bzw. im Klaviertrio oder -quartett. Renaud hat außerdem einige Zeit in Berlin studiert; daher sein gutes Deutsch, das er ein wenig scheu hinter seinem Englisch verbirgt.
K.WEST: Stammt aus der Berliner Zeit Ihre Vorliebe für deutsches Repertoire?
CAPUÇON: Schubert, Brahms, Beethoven – natürlich habe ich diese Komponisten auch während meines Studiums viel gespielt, vor allem aber in unzähligen Kammermusik-Abenden aufgeführt. Das prägt! Man darf aber nicht vergessen, dass 80 bis 90 Prozent dieses Repertoires von deutschen Komponisten abgedeckt wird.
K.WEST: Was viele französische Musiker nicht daran hindert, erst einmal mit Franck, Ravel oder Debussy auf den Plan zu treten.
CAPUÇON: Bis vor wenigen Jahren gab es in Frankreich keine nennenswerte kammermusikalische Infrastruktur. Nennen Sie mir fünf berühmte Streichquartette in den 70er oder 80er Jahren! Sie werden sie nicht finden. Entsprechend dünn war das Ausbildungssystem. Das hat sich inzwischen geändert. Dennoch bin ich stolz darauf, als Franzose oft nach Deutschland eingeladen zu werden, um deutsche Musik aufzuführen.
K.WEST: Sie könnten das nutzen, um einige französische Komponisten hierzulande bekannter zu machen.
CAPUÇON: Wir haben vor kurzem Kammermusikwerke von Gabriel Fauré aufgenommen, eine Musik, die in Deutschland wenig bekannt ist – meiner Meinung nach zu Unrecht. Wenn wir diese Werke künftig häufiger in Konzerten spielen, glaube ich, dass Fauré angemessenere Wahrnehmung erfahren würde.
Immer wieder wird Renaud Capuçon auf seinen Bruder angesprochen, selten auf die ältere Schwester, mit der die Jungen schon früh Musik gemacht haben. Die Eltern waren keine Musiker. Durch seine Geschwister sei er früh mit dem Kammermusik-Virus infiziert worden. Wenn er mit Gautier zusammen spiele, sei es »einfach organischer, jeder weiß, wie der andere denkt«. Umso wichtiger seien jedoch die Auszeiten. Manchmal treten sie für ein, zwei Spielzeiten nur selten gemeinsam auf. Wählerisch ist Capuçon auch bei der Wahl seiner Pianisten-Partner. Ein Experiment mit dem ungleich impulsiveren, experimentelleren Fazil Say scheiterte. Dafür sind Nicholas Angelich und Frank Braley längst feste Größen. Mit dem acht Jahre älteren Braley hat Renaud Capuçon sämtliche Beethoven-Sonaten im Konzertsaal aufgeführt und schließlich auf CD festgehalten. Das Projekt war bereits sein Traum, seit er seinen Lehrer in Chambéry die Sonaten hat spielen hören. Damals war er sieben. Zwar erinnert er sich nicht mehr an die Interpretation, aber an den Effekt, den diese Musik auf ihn machte: »Mir war sofort klar: Das möchtest Du auch mal machen.«
K.WEST: Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Frank Braley?
CAPUÇON: Vor 14 Jahren haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Vorab schon hatte er mir gesagt, dass er den Klang einer Geige grundsätzlich nicht besonders möge. Er hatte damals in Brüssel gerade den Königin-Elisabeth-Wettbewerb gewonnen, und ich hatte reichlich Respekt vor ihm. Also habe ich alles darangesetzt, ihn in seiner Meinung zu widerlegen. Nach unserem ersten Konzert wartete ich ab. Bis er meinte, ich hätte ihn dazu gebracht, die Geige zu schätzen. Ein Riesenkompliment! Und er wolle gern mit mir die Beethoven-Sonaten machen.
K.WEST: Mit Mitte 30 haben Sie das Ziel erreicht…
CAPUÇON: Es war eine eher langsame Entwicklung, die mich dahin gebracht hat. Ich besitze ohnehin kein Schnellschuss-Naturell. Bei mir brauchen die Dinge länger. Wenn man größer, vielleicht reifer wird, verändert man sich. Was sich bei mir, mit Blick auf diese Sonaten, durch das Alter und meine Erfahrungen geändert hat, ist die Nähe zu den Noten.
K.WEST: Was heißt das?
CAPUÇON: Ich klebe nicht mehr an jeder Einzelheit, der Umgang wird freier. Die Noten bilden mehr eine Art Relief. Ich habe das während meiner Berliner Studienjahre gelernt, bei meinem Lehrer Thomas Brandis, vor allem aber in einem Kurs. Mit unserem Dozenten sind wir den Text minutiös durchgegangen und haben bei jeder Nuance überlegt: Warum spielt das Klavier hier sforzando, warum steht da ein forte-piano? Wo liegen die Unterschiede?
Capuçon und Braley folgen der großen Linie, ohne den Blick fürs Kleingedruckte zu verlieren. Ihr Spiel besitzt ein hohes Maß an Klarheit und oft eine gewisse Leichtigkeit, nicht die so oft produzierte Erz-Schwere. Dass diese französisch anmutende Légèrté an einigen Stellen auf Kosten des Brio, des Beethovenschen Feuers, geht, ist durchaus gewollt. Doch so merkt der Hörer, dass gerade die erste Gruppe der drei Sonaten op. 12 noch dem Erbe Haydns verpflichtet ist. Eine der aufregendsten Erfahrungen und streitbarsten Herausforderungen für Capuçon war, sämtliche Sonaten an einem einzigen Abend aufzuführen. Bei einem kleinen Sommer-Festival in Frankreich, von 18 Uhr bis nachts um halb eins. Spätestens nach der Kreutzer-Sonate überkam Capuçon Müdigkeit, nicht allein physisch – gleichwohl eine »glückliche« Erfahrung.
Konzerttermine: 29. Januar 2012, Essen, Philharmonie (Laló: Symphonie espagnole); 26., 27., 28. Februar 2012, Köln, Philharmonie (Beethoven: Tripel-Konzert mit Gautier Capuçon und Frank Braley)