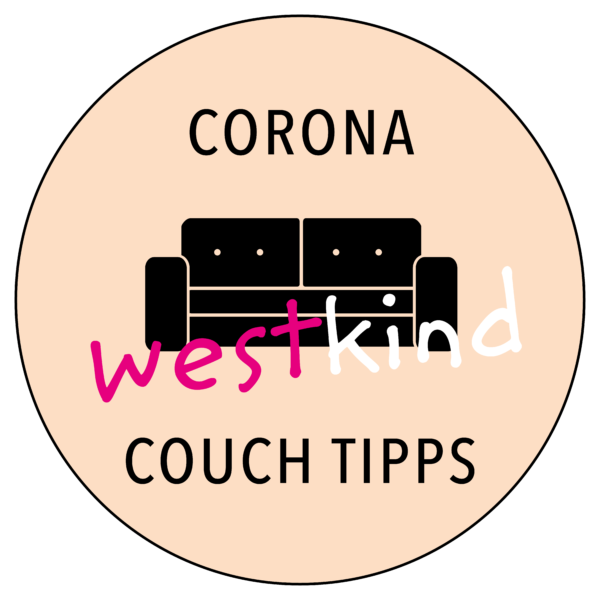Wodurch entsteht Kunst? Durch Distanz des Künstlers zu seinem Gegenstand. Wie wird sie erfahrbar? In der Distanz des Betrachters im Wechsel mit Identifikation, also teilweise Aufhebung der Distanz. Dieses Verhältnis ist wie das zwischen Reiz und Reaktion und der Fähigkeit des Menschen, eine Pause dazwischenzuschalten. Nicht dem Reiz (wie das Tier) direkt nachzugeben, sondern den Moment bis zur Erfüllung auszukosten oder sich die Erfüllung gleich ganz zu versagen.
Sind wir, als Zuschauer, nicht stets auf Abstand gehalten, ist es nicht sogar die Grundbedingung, um das Kunstwerk, die Inszenierung, Choreografie oder Sinfonie, aufzunehmen? Je lebendiger der Gegenstand, desto wesentlicher das Abstandsgebot. Es ist so schwierig nicht, zu Raffaels Madonnen, Leonardos Gioconda, Velazquez’ Infantinnen, Van Dycks Jünglingen, Renoirs Mädchen oder Picassos Frauenakten in einem distanzbewusst reflektierten Verhältnis zu stehen. Sie geben gewissermaßen den Rahmen dafür vor. Beim Darsteller, der uns auf der Bühne begegnet, ist es eine komplexere Anstrengung, Figur, Rolle, Interpret, Mensch zu unterscheiden und der Fiktion des ‚von Gleich zu Gleich’ zu widerstehen. Dies aber auch dann ein ästhetischer Gewinn und ein spielerisch intellektueller Akt. Der Vorgang dieser Differenzierung geschieht bei jedem Theaterbesuch, wir wissen es nur nicht mehr. Es ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Gut so.
Corona-bedingt denken wir es nicht nur weiter, sondern es muss praktiziert werden. Ja, und! Das muss keine Verlustanzeige ergeben, sondern kann – und sollte – Mehrwert sein: als Konzentrationsübung, Meditation über unser Abstraktionsvermögen und Herausforderung. Der Sicherheitsabstand würde – nicht als alleiniges, aber wesentliches Element – zum künstlerischen Credo. Das ist qualitativ etwas anderes als virtuelle Hygiene und keimfreie Kontaktnahme im digitalen Zeitalter.
Kunst entsteht aus dem Mangel
»Distanzierung legt nicht nur den objektiven Charakter des Kunstwerks frei. Sie betrifft auch das subjektive Verhalten, durchschneidet primitive Identifikationen…« (Adorno). Nehmen wir die Oper: Die Arie als Innehalten und Kristallisationspunkt einer Emotion im Gesang ist eine einzig große Distanz-Leistung und -erfahrung. Danach geht es weiter. Aber der Moment, da Dido, Donna Anna, Leonore, die Traviata Violetta sich – allein – selbst gegenübertreten, in den Spiegel ihrer Seele schauen und ihrem Gefühl Ausdruck verleihen, ist nicht zu überbieten. Wie im Theater der Monolog: wenn Ödipus’ sich erkennt, Gretchen im Kerker leidet, Posa stirbt, Wallenstein abtritt, Macbeth seinen Untergang kommentiert. »Der Monolog tröstet auch, ohne trotzig zu sein.«, sagt ein am Düsseldorfer Schauspielhaus engagierter Schauspieler. Die Versicherung der Existenz ist als Police immer auf Einen ausgestellt.
Kunst entsteht aus dem Mangel: Das wäre eine schöne Proklamation für die beginnende Bühnensaison. Erinnern wir uns an Heiner Müllers Bayreuther »Tristan«. Das auf Distanz angelegte Liebespaar fand vor unseren Augen zu einem anderen Schmelz- und Siedepunkt. Das war »Hyper real«: So nennt die in Berlin ansässige Constanza Macras ihr Tanz-Performance-Text-Musik-Hybrid, mit der das Düsseldorfer Schauspielhaus startet.
Becketts auf Godot Wartende Wladimir und Estragon, die im Schauspiel Köln den Auftakt machen, sind emigriert aus dem Sinnzusammenhang, Randexistenzen, nein, schon über den Rand hinaus getreten in die Niemandszeit und in das Niemandsland. Dort könnten sie Shakespeares Lear (von Johan Simons in Bochum inszeniert), den einstmals hochfahrenden, nun gedemütigten König ohne Land und ohne Kind treffen, der die Distanz zur Realität aufbringt, um irre zu werden: Der subjektiven Erkenntnis des Aus-der-Welt-Fallens und dieser Bedrohung sucht er mit aller Macht zu begegnen und trifft auf seine Ohnmacht.
Jede Zeichensetzung, der Gebrauch einer Metapher, das Einziehen symbolischer Handlungen, das Übertreten von Normen sind Übereinkünfte, die Distanz voraussetzen, plane Abbildung überspringen und sich mit Bedeutung aufladen. In der Gewalt des Distanz-Aufbringens liegt gerade auch die Kraft des Kunstwerks, als Kraft des Aufrührerischen und Nicht-Einverständnisses.
Machen wir aus der Tugend keine Not, die sich verschämt und verschreckt duckt, sich gehandicapt, amputiert, gelähmt fühlt. Das neue alte Gesetz formulieren und formatieren, darum geht es. Eine Gegenbewegung zur »Entkunstung der Kunst« (Adorno). Das wäre grundlegend anders als bloße Selbstlegitimation und das Signal ‚Es gibt uns noch, bitte vergesst uns nicht’, das während des Shutdown oftmals voreilig und kurzsichtig in rührend oder peinlich dilettantische Äußerungen mündete.
Das Ideal der Distanz ist jedoch nicht zu verabsolutieren, denn das Erleben des Publikums mit sich selbst und seinem Sitznachbarn hebt im Kollektiv nun gerade Barrieren auf oder will es tun, bis zu einem – bestenfalls – dionysischen Zustand, der Furcht und Schrecken, Mitleid und manchmal auch Aggression gegen das Gezeigte enthalten und sich entsprechend entladen kann. Man vergisst dies leicht, nicht nur aus der Position des ‚distanzierten’ Kritikers heraus, wenn im Parkett gähnende Langeweile herrscht, statt dass der Einzelne aus der Gruft seiner isolierten Erfahrung im Gemeinschaftlichen aufersteht.
Vorsicht, Sorge, Unbehagen
Was der Herbst an Erfahrungen bringt, an verordneter Grenzziehung und inneren Blockaden wissen wir, noch, nicht. Selbst wenn wieder vieles möglich sein sollte im Theaterraum – bleiben dennoch Vorsicht, Sorge und Unbehagen die uns ablenkenden Begleiter und Einflüsterer? Ereignet sich der Kulturinfarkt, weil der treue Abonnent, der rege Besucher, der Zerstreuungs-Kunde für sich entdeckt haben, wie wenig sie vom Lebensmittel Kunst brauchen?
Theater ist die andere Begegnung, auch mit uns selbst. Die Kunst geht von der Ausnahme aus – wie müsste sie da nicht die Ausnahmesituation produktiv und progressiv bestehen und gestalten können. Sie bemisst sich nicht entlang des Metermaßes. Stücke neu denken, sie ästhetisch und konzeptionell ‚durchspielen’ und das Gebot, Abstand zu wahren, nehmen, es untersuchen, es auf seine Spielbarkeit hin überprüfen und umwenden zu stolzer Behauptung.