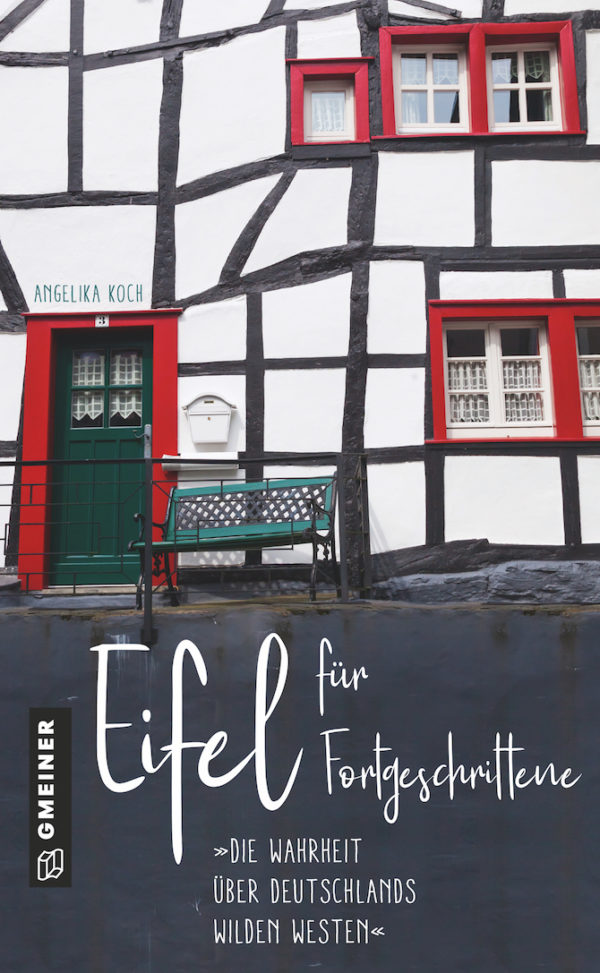// Der Weg zum Steinbruch führt vorbei an verklinkerten Einfamilienhäusern. Hier und da glänzen glasierte Dachziegel in der Sonne. Von den Wahlplakaten grüßen zuversichtliche Gesichter, familiär arrangiert. Man kennt sich. Das ist wirksamer als jeder Slogan. Es ist ruhig in Keldenich, dem drittgrößten Ortsteil der Gemeinde Kall. Doch was heißt in diesem Zusammenhang schon groß. Knapp 900 Menschen leben hier. Bei klarer Sicht soll man vom höher gelegenen Friedhof aus die Türme des Kölner Doms sehen können, aus gut 60 Kilometern Entfernung. Provinz eben.
Provinz? Dieses Wort begegnet einem häufig, wenn von Norbert Scheuers Romanen und Erzählungen die Rede ist. Ist das eine Lebensform? Eher eine Sichtweise, sagt Scheuer. Wer vom Rand her schaut, bekomme das Zentrum eben anders in den Blick. Umgekehrt gelte das natürlich auch. Und dann gibt es noch eine dritte Art zu gucken, die Norbert Scheuers: vom Rand her auf das Zentrum der Provinz. So hat Scheuer das in der Nordeifel gelegene Kall für die Literatur erschlossen.
Plötzlich ist, was eben noch Dorf war, verschwunden. Norbert Scheuer gibt die Richtung vor. Es geht durch eine kleine Unterführung, vorbei an leuchtend gelben Weizenfeldern, auf denen an diesem Sonntag gearbeitet wird. Wer sich nicht erklären kann, warum Menschen aus der Stadt flüchten, sollte einmal hierherkommen. Ein löchriger Stacheldrahtzaun grenzt den stillgelegten Steinbruch als illegalen Abenteuerspielplatz ab. Als einen dieser Orte, an die sich Er- wachsene später gerne erinnern, wenn von ihrer Jugend die Rede ist. In Scheuers Geschichten gibt es eine ganze Menge davon.
»Der Steinesammler«, so heißt Norbert Scheu- ers erster, 1999 erschienener Roman. Da hatte Scheuer schon eine Lehre in der Zementfabrik und die Abendrealschule hinter sich gebracht, in Iserlohn ein Diplom in Physikalischer Technik erworben und in Düsseldorf Philosophie stu- diert. Damals wie heute arbeitete er als Systempro- grammierer und war, als sein Romandebüt herauskam, 48 Jahre alt. Das ließe vermuten, dass Scheuers literarischer Fundus die eigene Erinnerung ist – und dass es Jahre brauchte, bis sich dort genug Material angesammelt hatte. So viel Stoff, dass Scheuer daraus einen kleinen, abgründigen Kosmos hat zusammenbauen können, den er dann in den zwei folgenden Prosabänden und auch in dem vor kurzem erschienenen, aktuell auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stehenden Roman »Überm Rauschen« beharrlich aus-, über-, und umgeformt hat, mit wechselnden Perspektiven und immer gleichem Personal.
Norbert Scheuer zu lesen, fühlt sich bisweilen wie ein Klassentreffen an. Man begegnet mal wieder alten Bekannten: Anton Braden etwa, der seit seinem Unfall im Steinbruch im Zementwerk arbeitet und abends, in Arimonds Wirtschaft, seine Fossilienfunde wie Schätze auf der Theke ausbreitet; Delamot, in dessen Frisiersalon die Dorfbewohner mit- und übereinander reden; oder dem Handlungsreisenden Vincentini, der mit einem elektrischen Akupunkturgerät namens Perseus über die Dörfer zieht und, wenn er seinen Perseus nicht an den Mann bringt, gelegentlich eine Frau schwängert.
Das alles findet dort statt, wo der in Prüm geborene Scheuer aufgewachsen und nach einem längeren Aufenthalt in Düsseldorf wieder hin zurückgekehrt ist: in der Eifel. In seinem 2005 erschienenen Erzählband hat Scheuer den Ort im Titel lokalisiert: »Kall, Eifel«. Das ist eine irritierend konkrete Verortung des Geschehens im Leben, zumal Scheuer in der Danksagung dann auch noch all denen Referenz erweist, die in der Cafeteria des örtlichen Einkaufsmarktes mit ihm plauderten. Deshalb wird Scheuer jetzt des Öfteren genötigt, auf die Bruchstellen zwischen Literatur und Leben hinzuweisen. Doch mit dem Titel »Kall, Eifel« ist ja zunächst einmal ein Fleck auf der literaturgeschichtlichen Landkarte markiert. Handelt es sich dabei doch um eine Anleihe bei Sherwood Anderson, um eine Verbeu- gung vor dessen 1919 erschienenem Kurzgeschichtenzyklus »Winesburg, Ohio«. Keine schlechte Referenz für Szenen aus dem beschädigten Kleinstadtleben.
Das Dorf ist von jeher ein idealer Schauplatz für verpasste Möglichkeiten und unerfüllte Wünsche, für Nicht-Gelebtes und Unausgesprochenes. Das lässt sich in zahlreichen Anti-Heimatroma-nen nachlesen. Doch bei Scheuer ist es nicht Ursache, sondern Ort des Unglücks, ein Raum, der seinen Geschichten Halt gibt. »Sie würden auch in der Großstadt funktionieren«, sagt Norbert Scheuer, der wie Leo, der Erzähler aus »Überm Rauschen«, Sohn einer Gastwirtin ist.
Pause. Norbert Scheuer trägt jetzt das Aufnahmegerät. Es geht ziemlich steil hinunter. Wer das zum ersten Mal macht, braucht beide Hände zum Festhalten. Der Steinbruch ist einer von Norbert Scheuers Lieblingsplätzen. Er kommt häufig hierher. »Man muss etwas nur immer wieder betrachten, dann sieht man, was es wirklich ist«, sagt er. »Deswegen spaziere ich auch immer dieselben Weg und sitze an immer denselben Orten, bis sich ihre spezielle Wesenheit einstellt.«
Häufige Umzüge prägten Scheuers Jugend, denn die Eltern betrieben gleich in mehreren Eifeldörfern ihre Lokale. Das führte dazu, dass er sich nie vollkommen in die jeweilige Dorfgemeinschaft integriert fühlte. Ein Rest an Distanz sei immer geblieben. Vielleicht ist eben dieser Abstand die Voraussetzung dafür, dass Scheuer so nüchtern und beherrscht, dabei aber zugleich doch immer auch teilnehmend und ganz nah dran an Dingen und Menschen eine eigene Welt hat entwerfen können. Eine Welt, die auf ganz andere – sehr wesentliche – Weise zeitlos ist als es die gesichtslosen Hausfassaden in Keldenich sind.
Doch wie wenig »Kall, Eifel« tatsächlich mit dem Kall in der Eifel zu tun hat, kann der Leser schon dem Motto des Buches entnehmen: »Queequeg was native of Rokovoko, an island far away to the West and South. It is not down on any map; true places never are.« Dieses Melville-Zitat ist »Kall, Eifel« als Gebrauchsanweisung vorangestellt. Literatur, davon ist Scheuer überzeugt, vermag eben eine ganz eigene, wirklichere, innere Welt hervorzubringen, die sich der Überprüfbarkeit entzieht. Und das Geschichtenerzählen sei immer auch konstruktive Arbeit an der eigenen Identität.
»Eigentlich hat Mutter nie etwas gesagt, wenn es uns betraf – alles mussten wir uns selber zusammenreimen, unser ganzes Leben ist eine mehr oder weniger von uns selbst erfundene Geschichte, ein Sammelsurium aus Worten und Stimmen, dem Gerede Betrunkener an der Theke unserer Gaststätte«, sinniert Leo in »Überm Rauschen. Er begegnet dem Leser im Jahre 1996 als 45-Jähriger. Leos Bruder hat sich seit Tagen in einem Zimmer des finanziell fast ruinierten Gasthauses eingeschlossen, was Leo veranlasst, zurückzukehren in die Eifel.
Einmal mehr nimmt Scheuer in »Überm Rauschen« abgebrochene Erzählstränge auf und führt bereits bekannte Motive neu aus. Auch das des abwesenden Erzeugers. Leo und Hermann kennen ihren biologischen Vater nicht. Der Mann, den sie Vater nannten, ist der Mutter bloß Ernährer ihrer unehelichen Kinder gewesen. So zumindest stellt es Leo dar. Während Norbert Scheuer sich am Ende des Buches bei seinem Vater bedankt. Dort heißt es: »Mein besonderer Dank aber gilt meinem Vater, für den dasjenige, was wir gemeinhin für Wirklichkeit halten, immer der kleinere Teil unserer Existenz gewesen ist.« Was damit gemeint ist, sei ja ziemlich klar, sagt Scheuer, um dann aber doch noch eine Auslegung seiner selbst zu versuchen: »Es könnte natürlich auch bedeuten, dass es den Vater nicht gibt.« Und dass diese Abwesenheit überhaupt erst das Erzählen in Gang setze. Doch soweit habe er noch nicht darüber nachgedacht. Sagt Norbert Scheuer, sichtlich von sich selbst überrascht. //
Norbert Scheuer, Überm Rauschen, Verlag C.H. Beck,München 2009, 165 Seiten, 17,90 Euro. Lesung am 6.9.2009 zusammen mit Joachim Król im Kölner Literaturhaus.