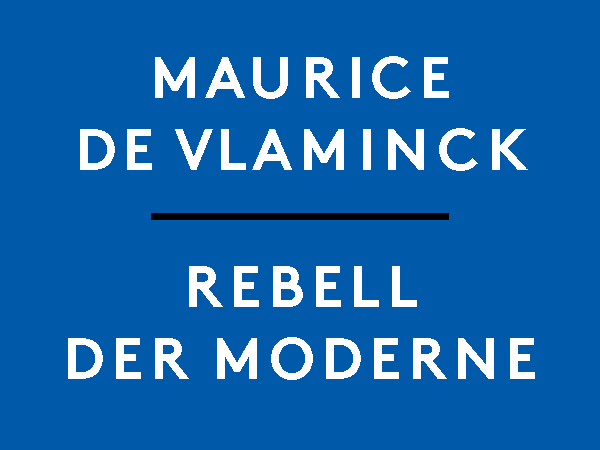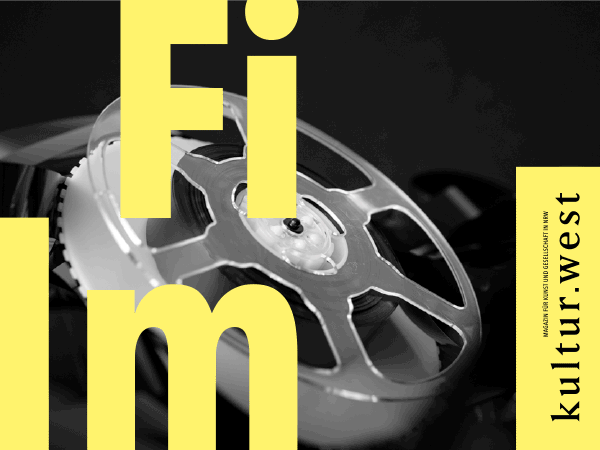Es beginnt mit einer Ohnmacht, womit die Krankheit zum Tode mit 30 Jahren ihren Lauf nimmt. Aber ohnmächtig war sie im Leben nicht – für eine Frau und Pfarrerstochter im viktorianischen Zeitalter. Emily Brontë ist ins Ausland nach Brüssel gereist, hat Französisch gelernt und einen Roman verfasst, den ihre Schwester Charlotte für »vulgär und hässlich« erklärt: »Wuthering Heights«, der einen düsteren, zweideutigen Charakter, Heathcliff, in den Mittelpunkt stellt.
Alle drei Schwestern, Anne, Charlotte und Emily, sind fantasiebegabt. Auch Bruder Branwell ist künstlerisch talentiert, der als Mann die Royal Academy of Arts in London besuchen darf, aber – unstet, aufsässig, ungefestigt – scheitert. Emily (Emma Mackey gibt ihr ein seine Regungen beherrschendes, verschlossenes Gesicht) ist eigensinnig bis zum Verstockten, sondert sich ab, streift durch die Natur, braucht wie ein Fisch den Tümpel ihres Zuhauses und der vertrauten Umgebung, wie sie sagt, und betrachtet die Welt und ihre Mitmenschen mit gerunzelter Stirn und zusammengezogenen Augenbrauen. Emily brüskiert, etwa als sie einmal die Totenmaske der Mutter aufsetzt, um die Verstorbene in einer Séance mit den Geschwistern erscheinen zu lassen und eine verstörende Situation hervorzurufen.
Eine Abwesende, selbst wenn sie präsent ist. Als gelte es, Verletzungen und Verluste abzuwehren, die sie erwarten werden. Französisch wird ihr zur Waffe und zum Wahrheitsträger, das sie unter anderem gegen Charlotte anwendet. So, wie Frances O’Connor zeigt, sind es zwei Männer, zu denen sie die innigste Bindung hat, die ihre Energie lenken, Leidenschaft wecken wie auch Kränkungen verursachen: Branwell (Fionn Whitehead), unter dessen Einfluss sie die Freiheit des Gedankens erfährt, und ihr Hauslehrer, der fromme Vikar William Weightman (Oliver Jackson-Cohen), der in seinem Gefühl zerrissen ist und früh an der Cholera stirbt.
»Emily« ist nicht ganz so, wie wir uns eine Literaturverfilmung über das England des 19. Jahrhundert vorstellen, von denen – gefühlt – Dutzende gedreht worden sind. Über eine von ihnen, es war wohl die von Janes Austens »Sense and Sensibility« durch Ang Lee, hatte jemand geschrieben, selbst die Schafe sähen aus, als sein sie speziell gecastet worden. Frances O’Connor wählt zwar auch stimmige Dekors und die Farben der Landschaft von Yorkshire, aber mehr bedeutet ihr das Ausgestalten der Innenwelt. In einem Konzert hören Emily und die Ihren eine Sängerin mit Mozarts »Zauberflöte«-Arie der Pamina, »Ach, ich fühl’s«. Der Titel wird uns zur Erkennungsmelodie für Emily. Es scheint, als würde O’Connor in die versiegelte Echokammer von Emily und ihrer fein gesiebten Subjektivität herabsteigen und sie belauschen, um die explosiven emotionalen Tonlagen zu uns herauf zu transportieren. Der ohnehin nicht darstellbare Vorgang der Erfindung von »Wuthering Heights«, mag die Geschichte sich auch an den Verlust von Branwell und William binden, bleibt verborgen, es genügt, dass Emily das gedruckte Buch in den Händen hält. Erschienen unter dem männlichen Pseudonym Ellis Bell. ****
»Emily«, Regie: Frances O’Connor, UK 2022, 130 Min., Start: 24. November