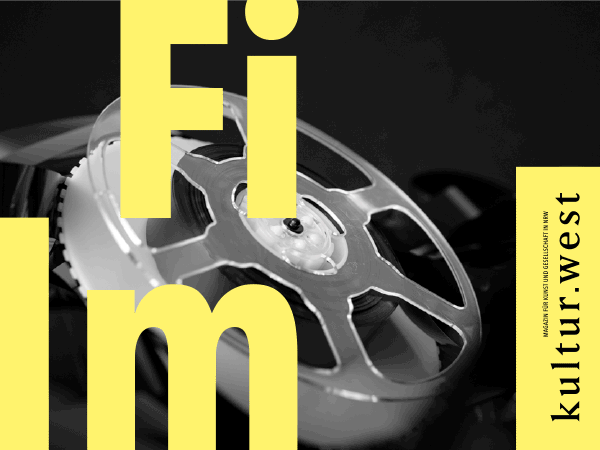»Gelsenkirchen: Herz im Revier voll Kraft und Zauber« – so gurrt seit August 2005 das offizielle Stadtmotto. Schrecklich gut gemeint. Aber es war Notwehr. Gelsenkirchen, früher als rußgeschwärzter, kulturloser Moloch geschmäht und vor 50 Jahren von Georg Kreisler als »Grubengasparadies« verhöhnt, ist wieder zur Chiffre für bodenlose Ruhrgebiets-Tristesse geworden. »Eine Stadt kämpft um ihren Ruf«, stellte mitfühlend die taz fest. Schon lange war Gelsenkirchens Arbeitslosenquote die höchste in Westdeutschland. Dann kam Hartz IV. Mit der neuen Berechnung schnellte die Quote vor einem Jahr von 18 auf plakative 25 Prozent: Bottrop, Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel waren als Klischeeträger aus der Schusslinie, Gelsenkirchen musste allein herhalten als Folie für Kohlenpott-Stereotypen. Wie bei Georg Kreisler: »Herren und Damen, von Rang und von Namen, kommen zu uns – und fahr’n gleich wieder weg.« Dann schrieben sie von »Verliererstadt«, vom »Bitterfeld des Westens«, von »Wohnhäusern wie verwahrlosten Denkmälern«. Als ob es sonst nur Harvestehude, Bogenhausen, Dahlem oder Kronberg im Taunus gäbe.
Nun: Die Besucher mögen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof angekommen sein, jenem bräunlichen Betonpissoir, das Stadt und Bundesbahn vor 30 Jahren an die Stelle eines alten Prachtbaus gestellt haben. Womöglich haben sie auch den angeschlossenen Busbahnhof gesehen, der an grauen Tagen wahrhaftig Depressionen auslösen kann. Dann sind die Gäste vermutlich durchs schäbige »Bahnhofs- Center« zur Fußgängerzone gelangt, haben dort die Ramschläden gezählt – und sind vielleicht noch bis zum berühmten, aber fahrlässig ruinierten Hans-Sachs-Haus gelangt.
Zugegeben: Das reicht für ein schnelles schwarzes Bild. Dann hilft es wenig, wenn man sich noch die protzige Fußball-Arena ansieht, wenn man kennerisch ins richtige Schalke fährt und sich jenem wohligen Gruseln hingibt, das viele Intellektuelle angesichts unterschichtig- exzessiver Fußballbegeisterung befällt. Da posaunt man dann arglos herum, dass »in Gelsenkirchen alles mit Schalke zu tun hat«, weil man nicht weiß, dass in anderen Ecken der Stadt keineswegs überall Fahnen mit »S04« hängen und dass auch die Begeisterung in Schalke teils bloße Rückkoppelung ist, weil Menschen sich gern so verhalten, wie es Medien immer wieder schildern. Vom Schalke-Helden Ernst Kuzorra ist ein Zitat überliefert, in verschiedenen Versionen und also zweifelhaft, aber schön: Auf die Frage des schwedischen Königs, wo denn dieses Gelsenkirchen genau liege, soll Kuzorra gesagt haben: »Anne Grenzstraße, Majestät.« Gut erfunden, denn erstens markiert die Grenzstraße tatsächlich den Übergang von Schalke zur Alt-Gelsenkirchener Innenstadt. Und wenn demnach zweitens Schalke nicht Gelsenkirchen ist, dann ist auch Buer nicht Gelsenkirchen, nicht Horst, nicht Ückendorf, Resse oder Heßler. In der Tat: »Groß- Gelsenkirchen« hat so viele Gesichter wie eingemeindete Stadtteile. Den klarsten Kontrast zum Bahnhofscenter bietet Buer, das 1928 mit Gelsenkirchen kombiniert wurde. Es wird geprägt von Repräsentationsbauten des frühen 20. Jahrhunderts: Rathaus, Polizeipräsidium, Gymnasien, ziegelexpressionistischer Postpalast. Gutbürgerliche Wohnstraßen. Es gibt in bester Lage Döner-Paläste und einen »Kuaför Salonu«, aber auch klassische Läden gedeihen. Südlich schließt sich ein weitläufiger Park an, mit Seen und Barockschlösschen. Nicht weit davon der Hauptfriedhof, der keinen Anlass gibt, dort nicht begraben sein zu wollen. Zwischen Park und Friedhof finden sich Häuser und Villen der gediegensten Art und zeigen, dass Begüterte dort durchaus auch zu leben verstanden und verstehen.
Am lebendigsten ist die industrielle Vergangenheit in Hassel. Dieser nördliche Stadtteil lag zwischen den Zechen Bergmannsglück im Westen und Westerholt im Osten. Die schönsten Ecken der Bergarbeitersiedlung erinnern an die Essener Margarethenhöhe: nicht der schlechteste Ort zu leben für eine Arbeiterfamilie. Dass die so sicher scheinende Symbiose mit der Schwerindustrie ihren Preis hatte, lässt sich daran ablesen, wie ein Bündel aus dicken Fernwärmerohren vom Kraftwerk zur Zeche geführt wurde, mitten durch Hassel, zentimeternah an den Fenstern eines Wohnhauses vorbei und im Bogen über den Garten hinweg.
Noch ist die Vergangenheit nicht vorbei in Hassel. Das Schild »Knappschaftsältester« ist noch nicht museal. Die Zeche Westerholt fördert noch immer Kohle ans Gelsenkirchener Tageslicht, die weitgehend jenseits der Stadtgrenzen gewonnen wird. Und an Wintertagen liegt schon mal Kohlenrauch in der Luft, weil manche noch mit Deputat heizen. Aber Bergmannsglück ist längst weg. Die Kokerei ist 1999 erkaltet, und auch das Kraftwerk liegt still und wird abgerissen. Ein verwittertes Straßenschild zeigt, dass noch vor 50 Jahren die Ottestraße auf dem jetzigen Kraftwerksgelände weitergegangen sein muss. Nun folgt schon die nächste, die postindustrielle Überlagerung des Bodens. Ein Prozess, den die Stadt seit Jahrzehnten wieder und wieder gestalten muss.
Aschenputtel war Gelsenkirchen immer in seiner industriellen Geschichte. Doch versuchte man, der Maloche Kultur entgegenzusetzen – auch gebaute Kultur. Das waren konservativ-bürgerlich geprägte Symbole wie Rathaus und Gymnasien in Buer, aber zunehmend auch Manifestationen der Moderne, allen voran das Hans-Sachs-Haus in der Stadtmitte, nach Plänen Alfred Fischers erbaut und 1927 eröffnet: Verwaltungsgebäude und Volkshochschule, mit Bibliothek, Restaurant, Konzertsaal samt Orgel. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war Kohle gefragt, und Gelsenkirchen lieferte. Zu welchem Preis, das zeigten zwei Schlagwetterexplosionen auf der Zeche »Dahlbusch« mit über 100 Toten. Vor diesem grimmigen Hintergrund legte die Stadt ein zweites, stolzes Bekenntnis zu Kultur und Moderne ab, mit dem Bau des Musiktheaters nach Plänen von Werner Ruhnau. Als es 1959 eröffnet wurde, ging die Stadt aber schon auf dünnem Eis. Damals arbeiteten 44.000 Menschen auf Gelsenkirchener Zechen – bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 400.000. 1965 waren schon 15.000 Püttjobs verschwunden, durch zwei Stillegungen und Rationalisierung. Ein Jahr drauf dann der Schlag: »Graf Bismarck« schloss, die größte Zeche in Gelsenkirchen und eine der modernsten im Ruhrge biet, deshalb reagierten die Menschen ungläubig, entsetzt. 6800 Arbeitsplätze verschwanden. »Dahlbusch« folgte ins Aus: mit 2500 Jobs. Dass der Bismarck-Schock kein radikales Programm zur Strukturreform provozierte, mag im Nachhinein verwundern. Doch erschien die Schließung gerade der besten Zeche wohl zu willkürlich, um daraus weitreichende Schlüsse zu ziehen. Tatsächlich rationalisierten die übrigen Zechen der Stadt, arbeiteten bis in die 90er Jahre weiter. Dafür schlossen das Gussstahlwerk und die Eisenhütte »Schalker Verein«, und in der heute fast vergessenen Gelsenkirchener Textilindustrie brach ein Betrieb nach dem anderen zusammen. Schon anfangs der 80er saß die Stadt in der Zwickmühle: weniger Betriebe, weniger Arbeit, weniger Steuern, hohe Sozialkosten. Dass sie auch Einwohner verlor, hätte helfen können, doch sanken dadurch Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen. Dennoch bemühte man sich in seltsam kopfloser Weise um Modernisierung; damals schlug sie sich im Zentrum jene Wunden, die heute so hässlich vernarbt sind: Man riss, zum Beispiel, das alte Rathaus ab, den alten Bahnhof und das dazugehörige Hotel.
Die durchaus zeitgeistige »Sanierung« tat vielen bald leid. In den späten 80er Jahren wandte sich das Blatt zu Konzepten der Restaurierung und Neunutzung, wie sie dann von der – in Gelsenkirchen residierenden – IBA Emscherpark umgesetzt wurden. Bloß dass in Gelsenkirchen der späte Kollaps des Bergbaus folgte. Wieder verschwanden Tausende Arbeitsplätze. Und kaum war »Hugo« im Jahr 2000 geschlossen, kam die deutsche Wirtschaftsmisere. Nein, dass die Gelsenkirchener sich nicht am eigenen Schopf aus der Krise gezogen haben, ist kein Wunder. Erstaunlich ist, was sie »dennoch« geschafft haben.
Sie haben der Krise noch ein neues Kunstmuseum abgetrotzt: Sie haben versucht, die Breitenbildung als Kulturbildung zu verteidigen gegen bloßen Erwerb berufspraktischer Fertigkeiten. Gleichzeitig haben sie zu sparen begonnen, als Andere noch aus dem Vollen schöpften. Vom Museum wurde 1984 nur der erste Bauabschnitt eröffnet. Das Sprechtheater wurde aufgegeben; das Philharmonische Orchester fusionierte 1996 mit dem in Recklinghausen; die Oper musste eine (bald gescheiterte) Ehe mit Wuppertal durchleiden. Mehr Sparen sei ohne Substanzverlust nicht möglich, sagt Peter Rose, Kulturdezernent von 1975 bis 2000. Noch immer stehe alles unter dem Damoklesschwert weiterer Kürzungen. Jüngst erst sei man vorübergehend auf die Idee verfallen, den Posten des Leiters von VHS und Stadtbibliothek nicht mehr zu besetzen. Insgesamt aber habe Gelsenkirchen Hochkultur, Breitenbildung und Förderung der freien Szene nicht gegeneinander ausgespielt. Auch unter CDU-Herrschaft seien die tödlichen Schnitte ausgeblieben. Noch immer spiele das Musiktheater auf hohem Niveau, reiche das Bildungsangebot trotz Konzessionen an »Verwertbares« aus, und die freie Kulturszene – Beispiel Consol-Theater auf dem Zechenareal in Bismarck – biete ein lebendiges Bild. Wenn Gelsenkirchen 2010 Kulturhauptstadtteil wird, hat es was zu zeigen.
Außerdem wurde ein Industrieareal ums andere abgeräumt, gereinigt und neu gestaltet – mit Parks, mit restaurierten Zechengebäuden, fortschrittlichen Wohnsiedlungen, mit Instituten und Gewerbebetrieben. Das Schloss in Horst und Haus Berge in Buer wurden saniert. Das Hans-Sachs-Haus dagegen wurde viel zu lange sparsam vernachlässigt. Nun ist es so marode, dass die Restaurierungskosten jedes Gelsenkirchener Maß überstiegen; der Rat beschloss den Abriss. Selbst der ehemalige Kulturdezernent meint, man müsse loslassen, was nicht mehr zu halten ist. Doch viele Gelsenkirchener und Auswärtige beschleicht ein ungutes Gefühl. Die Renovierung durch einen privaten Investor scheint während der CDU-Herrschaft wenig professionell ausgehandelt worden zu sein, und die Summe von 140 Millionen Sanierungskosten scheint unter SPD-Oberbürgermeister Baranowski allzu bereitwillig als Hebel genutzt zu werden, um dem Schrecken ein schnelles Ende zu bereiten.
Jetzt blickt Gelsenkirchen auf die Fußball-Weltmeisterschaft, weil einige Spiele im Stadion der Schalker ausgetragen werden. Man hofft auf Besuch und Umsatz und versucht dafür sogar, die Gegend um den Hauptbahnhof aufzuhübschen. Nur sind ein paar WM-Spiele keine Strategie, und die Fokussierung des Stadtmarketings auf »Schalke« ist zweifelhaft, weil Gelsenkirchen hinter dem gehegten Mythos zu verschwinden droht und ein Image als Zentrum fußballnärrischer, sonst unterbelichteter Sozialhilfeempfänger auch kaum als Fortschritt zu verbuchen wäre. Da gehen Stadtwerbung und klischeehafte Erwartungen von außen eine unheilige Allianz ein. Die Arbeitslosenquote ist seit dem Sommer von 25 wieder auf knapp über 20 Prozent gesunken; da mögen Justierungen der Hartz- Bürokratie eine Rolle gespielt haben, aber auch Erfolge der Arbeitsmarktpolitik und der Wirtschaftsförderung. Und Peter Rose beobachtet, dass eine vorübergehende Tendenz zum hilfesuchenden Jammern im Schwinden sei und eine Stimmung des »Jetzt erst recht!« um sich greife. Was nicht selbstverständlich ist: Wenn etwa die höhere Tochter und Bundes-Familienministerin von der Leyen den Kommunen nonchalant empfiehlt, auf Elternbeiträge zu Kindertagesstätten zu verzichten, muss das in Gelsenkirchen wie Hohn klingen: als sei eine Stadt mit solcher Struktur schon jenseits aller politischen Kalkulationen, ein hoffnungsloses Getto für 270.000 Unglückliche, die das Pech haben, an der Emscher zu leben und nicht an Isar oder Alster. Dabei ist Gelsenkirchen heute in fast jeder Hinsicht ein besserer Wohnort als je zuvor in seiner Geschichte. Der Versuch, aus diesem Potenzial eine urbane Zukunft mit weniger Menschen und weniger Arbeit zu entwickeln, hat Anspruch auf Respekt, auf Sympathie statt billiger Zynismen, auf finanzielle Unterstützung – nicht nur, weil da letztlich an der Zukunft der gesamten Gesellschaft gebaut wird.
Sönke Wortmann hat vor Jahren einen Kurzfilm gedreht: »Gelsenkirchen, mon amour«. Der Mann ist aus Marl. Von Münchnern oder Hamburgern ist Liebe vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber Bereitschaft, diese Stadt als bewohnbaren Raum zu erkennen, wäre schon nicht schlecht. Dafür müsste man allerdings hingucken. Kürzlich hat Gelsenkirchen Journalisten überregionaler Medien zu einer zweitägigen Tour mit »Licht- und Schattenseiten« geladen. Gerade vier sind gekommen. Vielleicht hat die übrigen der anbiedernde Stadt-Slogan auf dem Briefpapier verschreckt. Vielleicht aber war nur die Arbeitslosenquote schon zu weit gesunken.