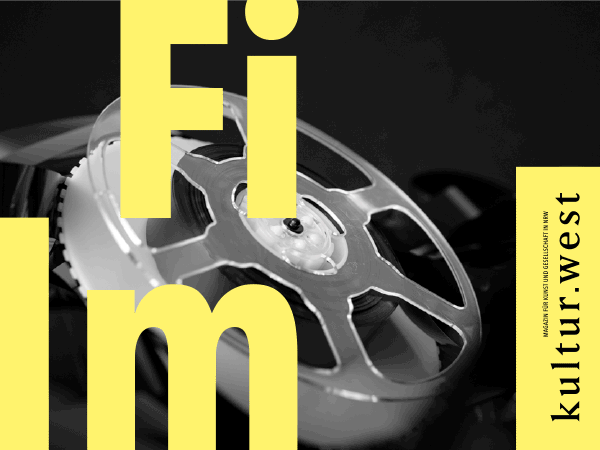Es ist ein Verlust anzuzeigen – er betrifft das Theater, genauer gesagt: das Stadttheater, so wie es dank bestandsichernder Subventionierung und trotz massiver werdendem Druck der öffentlichen Hand sowie Milchmädchenrechnungen ökonomischer Besserwisser unbeschadet existiert. Ohne der beliebten Erregungs- und Alarmierungs-Rhetorik zu verfallen, soll die Behauptung aufgestellt sein: Es ist ein Verlust an Deutungshoheit und Bedeutsamkeit, an narrativem Vermögen, an gesellschaftlicher Relevanz, und, ja auch, an Unterhaltsamkeit. Statt dessen Mangelverwaltung auf unterschiedlichem Niveau. Weiterspielen wie gehabt.
Die Haupttugenden des Theaters seien »Phantasie und Improvisation, Frechheit und Toleranz, Selbstironie, Sex, Geschmacklosigkeit, Subversion, Unsittlichkeit, Irrsinn und Gelächter, Obszönität, Blasphemie, Ironie, Publikums-, Kritiker- und Selbstbeschimpfung und so weiter und so fort bis ans Tor der Hölle«. Der Cerberus und Teufelskerl Claus Peymann hat weit ausgeholt, als er jüngst in der Sache Stadelmaier contra Lawinky dem übergriffigen Schauspieler nach der Frankfurter Notizblock-Affäre Asyl bot und sich dabei schon wieder so progressiv wähnte wie zuzeiten in Stuttgart im Schatten von Stammheim. Aber es ging nicht um eine Staatsaffäre, sondern um eine publizistische Posse. Es war nichts als Theater. Was gehen den Bürger die Befindlichkeiten dieser Leute an, um es mit einer bevorzugten Wendung eines der Hauptakteure, dem so genannten Opfer zu sagen? Was der Intendant des Berliner Ensembles als Übertreibungskünstler mit seiner süffigen Giftliste zum Besten gab, zeigt nur die Diskrepanz zwischen Selbst- und öffentlicher Wahrnehmung, zeigt die Tragödie einer lächerlichen Verkennung, die mit weniger Talent zur permanenten Krisenbeschwörung und behaupteten Krisenbewältigung auch anderswo als am Schiffbauerdamm stattfindet. Und zeigt die Sehnsucht nach dem Spüren von Intensitäten. Die Regel hingegen ist »gefälliges Qualitätsmanagement« (Süddeutsche Zeitung).
Wie oft geht man als Theaterzuschauer nicht mit dem Eindruck nach Hause, den Thomas Bernhard als Schlusssatz seiner Prosa-Komödie »Alte Meister« bildet und mit ihm in zugeneigtem Hass das Burgtheater meint: »Die Vorstellung war entsetzlich.«? Wie oft weiß man nicht bereits nach zehn Minuten auf der Bühne, was die Uhr geschlagen hat und quält sich durch drei weitere Stunden, als gäbe es eine Pflicht, die Zeit abzusitzen? Da sollte sich das Theater den genialen Billy Wilder zum Vorbild nehmen, der nach wie vor gültige zehn Gebote aufstellte: »Die ersten neun lauten, Du sollst nicht langweilen!« Als Reaktion auf allgemeine Orientierungslosigkeit reagiert das Theater mit einer pathetischen Sehnsucht nach Sinn und mit einem kritischen Engagement, das nicht selten in einen treuherzigen, der Komplexität globaler Zusammenhänge nicht gewachsenen Moralismus verfällt. Oder begnügt sich, obwohl es unter dem ebenso abgenutzten wie inhaltsleeren Angstbegriff »Regietheater « firmiert, mit bravem Nacherzählen und lähmendem Textaufsagen, weil es keine Lösungen zu bieten, aber leider dabei auch die Einsicht und Durchsicht des Unlösbaren aufgegeben hat.
Oder es orientiert sich, seitdem es vor geraumer Zeit neue Verbindungen eingegangen ist, die zunächst die Freie Szene geknüpft und ausprobiert hat, an der bildenden Kunst und der Popmusik, nähert sich der Installation, der sozialen Plastik, der Collage und Montage, der Dekonstruktion, dem Sampeln und der Simulation. Das sogenannte postdramatische Theater lastet sich Theorie auf, bewegt sich in Referenzsystemen, verlangt von sich und uns, Kontexte zu analysieren, sich im Popdiskurs auszukennen, rüstet sich soziologisch und philosophisch auf, reagiert sich an akuten Krisenherden ab, inhaliert Modetrends, Wissenschafts-Debatten und das mediale Entertainment.
Allerdings ist an Rhein und Ruhr dieser sonst längst Mainstream gewordene Trend, der selbst schneller epigonal geworden ist als jede andere ästhetische Handschrift, kaum wahrnehmbar. Hier herrscht mehrheitlich die Praxis einer wie von sich selbst ermüdeten Routine, die den x-ten »Nathan«, »Hamlet« oder »Kaufmann von Venedig «, eine weitere »Iphigenie«, einen neuen »Danton« ins Repertoire hievt, mit Sophokles, Hebbel, Arthur Miller, Sartre oder Moritz Rinke die Welt erklären will –und mit dieser Absicht nicht selten aufläuft. Aber nicht in Becketts Sinn von »Scheitern. Wieder scheitern. Besser scheitern«.
Am ehesten noch in Nischen bewährt sich das Stadttheater, wenn es zum Beispiel wie bei Anselm Weber in Essen sich bis an den sozialen Rand ausdehnt, wie am Schlosstheater Moers mit einem Demenz-Projekt initiativ wird oder wie Ciullis Theater an der Ruhr programmatisch den Dialog mit anderen Kulturen führt, der aber wiederum schnell zu einem mehr als unbefriedigenden Resultat führen kann wie am Düsseldorfer Schauspielhaus mit einem spektakulär teuren Antiken-Projekt und den klein geratenen Versuchen mit osteuropäischer Dramatik.
Es war zwischen Bochum und Bonn eine – wie schon im Vorjahr – weitgehend schwache Spielzeit, die eine einzig wesentliche Inszenierung hervorgebracht hat: Jürgen Goschs »Macbeth« am Düsseldorfer Schauspielhaus. Die Aufführung wurde – nebst bereits mehreren Gastspielen und Einladungen zu Festivals – fürs Berliner Theatertreffen im Mai nominiert: auch mit der Stimme des Autors dieses Textes als Mitglied der siebenköpfigen Jury, die im Jahresdurchschnitt an die hundert Aufführungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz besichtigt hat. Goschs stets die eigenen Instrumente und das eigene Handwerkszeug vorzeigender, wie gehäutet wirkender, blutsatter »Macbeth« scheint insofern über sich selbst hinauszuweisen, als er ein »drittes, fröhliches Reich des Spiels und des Scheins« (Friedrich Schiller) in monströser Verformung schafft, eigene Wirkungsmechanismen bis zum Exzess ad absurdum führt. Und sich sonstigen Positionen verweigert.
Wir erleben als Impulsgeber und Energieträger die autoerotische, autopoetische Lust und Kraft der Beschäftigung des Theaters mit sich selbst als Weisheit letzter Schluss. »Wir spielen immer, wer es weiß, ist klug«, um Schnitzler zu zitieren. Keine Psychologisierung; kein dröges Text-Bedienen; kein verqueres Pirouetten-Drehen auf blind polierten Textflächen, die dem Ich keinen Halt mehr zu bieten vermögen, weil dieses Ich sich ja längst in den Diskursen der Moderne um seine Existenz gebracht hat und die Welt nichts mehr im Innersten zusammen hält, was nicht daran hindert, diesen Ich-Verlust virtuos und oftmals mit witzelnder Penetranz zur Schau zu stellen und die Demontage als finale Erkenntnis zu feiern.
Eine andere Kunstform hat diese Scheu vor dem Subjekt nicht. Sie spielt das Menschentheater weiter, aus dem es in einer seiner frühen Entwicklungslinien auch hervorgegangen ist: das Kino. Es erzählt die besseren Geschichten.
Heutige und alte Geschichten: nicht mehr so sehr bigger than life, vielmehr näher am Leben. Es traut sich zur Emotion, wagt sich ans Gefühl, gibt dem Individuum Raum und dem Charakter Schattierungen und durchleuchtet ihn – ob Woody Allen, George Clooney, Ang Lee, Bennett Miller, Francois Ozon, Michael Haneke, Detlev Buck, Hans-Christian Schmid, um nur einige Regisseure aktuell laufender großartiger Filme zu nennen. Das Theater hat sich mit seinen »Als ob«-Haltungen großteils davon entfernt.
Wenn es die mal aufgibt, ist man beglückt: wie bei Goschs Berliner »Virginia Woolf«, wie in Andrea Breths Wiener »Don Carlos«, selbst noch in Thalheimers »Emilia Galotti« oder Ostermeiers »Hedda Gabler« aus Berlin. Wenn das dann wiederum abfällig Metropolen- oder Repräsentationstheater genannt wird, liegt ein Problem des Theaters mit sich selbst offen zu Tage. In einem diffusen Rezeptionsverhalten und bei komplett unterschiedlichen Zielgruppen, deren Gemeinsamkeit es ist, dass sie Bewertungs-Maßstäbe immer weniger anzulegen wissen, streben die Positionen deutlich auseinander.
Das Gros der Zuschauer schätzt die gediegene Aufführung entgegen einem »Ekeltheater«, das der Spiegel jüngst polemisch anprangerte, und den »modernen Klassiker-Zertrümmerern« (Horst Köhler), wähnt sich an einem Ort, der immer auch noch der bürgerlichen Selbstvergewisserung dient, und plädiert für ein Ding, das es nicht gibt: »Werktreue«. Wenn das mal nicht Bequemlichkeit und Denkfaulheit ist. Die Gegenfraktion kann der Methode, alles auf eigene Augenhöhe zu zwingen und beliebigen Referenzsystemen zu unterwerfen, etwas abgewinnen. Die Kulturpolitik wünscht sich, schon zur Selbstlegitimation, prestigeträchtige Kultur-Events. Und der Kritiker sitzt wie gewohnt zwischen den Stühlen.
Wo der professionelle Zuschauer sich überstrapaziert oder gelangweilt fühlt, der Abonnent lau klatscht und ab- oder wegnickt und die unter 30-Jährigen lieber in den Club oder ins Multiplex gehen, bieten weder das ästhetisch behäbige Nachspiel noch das forcierte Verweigerungsspiel, sind weder die Überkonnotation noch das Unterkomplexe Modelle, um das Theater wieder zu beleben.Es darf nicht allein der Ort für Connaisseure sein, aber sich auch nicht damit begnügen, die Erstbegegnung mit einem Stoff zu ermöglichen.
Die Spieltheorie, wie sie Gosch von Düsseldorf bis Hamburg, Hannover, Berlin und Zürich seit einigen Jahren erfolgreich und völlig entspannt durchexerziert, bietet da noch eine am ehesten taugliche Offerte. Aber diese Methode scheint auch mit einer Verschwörung gegen den Apparat zu tun zu haben, scheint das System Stadttheater zu unterlaufen, indem sie so etwas wie eine Zelle in den schwerfälligen Organismus implantiert, die sich widerständig oder einfach nur autonom behauptet. Ein anarchischer Moment, der auf Dauer vermutlich wiederum zur Struktur erstarren würde und damit Teil des Systems würde, das er jetzt leger außer Kraft setzt. //
Das Forum WDR 3 am Sonntag, 9. April 2006, 19.05 bis 20 Uhr, beleuchtet Standpunkte und Perspektiven zu diesem Thema unter dem Titel »Ist das Theater noch relevant?« Gesprächsteilnehmer sind: Thomas Oberender, Klaus Weise, Andreas Wilink und Anke Spiegel, Vorstand der Theatergemeinde Köln. Die Moderation hat Dina Netz, die Redaktion Morten Kansteiner.
______________________________________________________
Wort-Spiel
Von Klaus Weise
Am Anfang war das Wort. Gottes. Dann, in seinem Schatten, folgte das Wort des Dichters. Der Mensch verschaffte sich Gehör, piepste auf im Universum, der Dialog begann und mit ihm das Drama, also der Kampf um Macht, Liebe, Tod. Am Anfang war das Wort. Nicht der Strich. Der ist die Erfindung eines »zappelphilippigen « Publikums und eines »demiurgen« Regisseurs, der das Verb funktionieren als Weisheitszahn in seinen Hamsterbacken trägt. Freilich, wenn im Zuge der Banalisierung der Kunst der Dichter zum Müllsammler des Alltags wird, kann der Strich zum Lebensretter des Theaters werden, weil er befreit von Problemen, dem eingebildeten Aua, das außer dem Schreibenden keiner hat – naja. Nun aber zum Thema: Nach der Theaterkrise soll es jetzt die Theatersackgasse geben – besonders in NRW, dem angeblichen Tiefland der Talente. Ist was dran oder ist es bloß egomane Rangelei im Ranking der Theatermacher und ihrer Kritiker, die zu oft ins Kino gehen, die Architektur und bildende Kunst mehr lieben als das Theater und zu lange sonnengebadet haben in der von Paris nach Berlin gewanderten Melancholie-Ausstellung?
Die Frage lautet: Wohin mit dem Theater, nachdem dieses sich im läppischen Hinter-dem-Text-Herrennen den Verstand aus den Füßen gelaufen hat, und nachdem das sich identifizierende Ich abgetragen ist wie die Stäbchen eines Mikado-Haufens? Ist es behäbig, dem Text hinterher zu rennen, um ihn zu erreichen, wenn er von Büchner, Kleist oder Shakespeare stammt, wenn er uns, die wir uns nicht zwölfmal im Jahr mit ihm beschäftigen und drüber stumpf werden, eine Welt eröffnet, die in den Genen der Erfahrung verborgen liegt und des Dichters als Rufer gegen das große Vergessen bedarf?
Hier stellt sich, immer in der Kunst, die Frage nach dem Wie: Wird ästhetisch-äffisch nachgeahmt oder neu-gierig gesucht (Es soll ja Regisseure geben, die sich schon vor ihrer ersten Inszenierung wiederholen!)? Das Aus einer Theatertheorie ist spannend, weil die Theorie versagt, nicht das Theater: Es ist ein Monstrum, das sich aus sich selber zeugt. Seine, also des gespielten Lebens Vergänglichkeit und Reproduktion, sind denen des gelebten Lebens am ähnlichsten: Darin ist das Theater einzigartig unter den Künsten, dass es am Leben haftet wie Pattex am Pullover.
Vielleicht wird ja, eines fernen Tages, der Text eingeholt oder, um im Bilde zu bleiben, überrundet vom großen Texterlöser und das Wort auf die Plätze verwiesen: Es war einmal. Aber bis dahin: Weil wir im Leben so verdammt ungern sterben oder anderswie untergehen, schauen wir so verdammt gerne auf der Bühne anderen dabei zu – zumal wenn, intelligent gemacht, die Mittel des Theaters nicht weggeleuchtet werden. Und wo landauf, landab allabendlich gut oder recht und schlecht gestorben wird (ganz wie im Kino und TV), da wird das Ich, einem Nierenstein gleich, folgerichtig Schaden nehmen bis hin zu seiner Zertrümmerung. Und wenn schon! Soll das Theater doch Ichlos bleiben, bis nach seiner Dekonstruktion seine Rekonstruktion als Innovation gefeiert werden kann.
Bei so viel Zukunft lohnt der Blick zurück: Die Knochen sind das Gedächtnis der Menschheit, nicht nur, wenn Hamlet Yoricks Schädel in den Händen hält. Vor 30.000 Jahren ritzten Menschen Mammutknochen. Was war zu sehen? Das menschliche Antlitz. Voilà, die Kultur war geboren als Beschäftigung des Menschen mit sich selber. Das Theater ist nur eine Möglichkeit dieser Beschäftigung – eine spielerische und, so möchte ich nicht uneitel hinzufügen, bei 85%-iger Platzauslastung eine notwendige.
Der Autor ist Generalintendant des Theaters Bonn.
Der angstfreie Raum
Von Benjamin Walther
Theater ist kein begehbares Reclamheft. Mich interessiert Theater immer dann, wenn es risikobereit und wach dem Leben begegnet – sich bezieht und in Zusammenhang setzt, sich frei erfindet und dabei immer wieder auch überprüft, wenn es leidenschaftlich ist, zart und verletzlich, hart und brutal. In Dresden, wo ich aufgewachsen bin, war das Theater der Ort, an dem man hören und sehen konnte, was so nicht gesagt wurde, an dem etwas gewagt wurde. Diese erste, sehr frühe Erfahrung ist für meine Arbeit ein starker Impuls geblieben. Das wichtigste ist für mich, unbeeinträchtigt arbeiten zu können, und ich glaube, dass momentan die größten Probleme der Theater aus der zu starken Orientierung an einem oberflächlichen Erfolgsbegriff und der Angst vor dem Fehler-Machen kommen. Das Ergebnis ist ein Klima der Erstarrung.
Ich denke, Theater hat die Verpflichtung, sich permanent auszusetzen – und das geht nur in einem angstfreien Raum. Wenn ich mich nicht mit jeder Inszenierung riskieren könnte, dann würde die Arbeit für mich an Relevanz verlieren. Vielleicht kann ich sagen, dass mich Theater in dem Augenblick zu interessieren beginnt, wo es erst einmal nur die Basis ist, auf der es steht: Spiel. Wenn es so frei und erfinderisch und voller Risiko wie das Spiel selber ist, dann hat es eine Chance. Dass das Theater in den letzten Jahren an Deutungshoheit verloren und sich mehr und mehr ins Abseits gebracht haben soll, finde ich nicht schlimm. Krisen können produktiv sein, und in Nischen lässt es sich erst einmal gut und vor allem in Ruhe und mit aller Konsequenz arbeiten. Außerdem wüsste ich nicht, was in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht Nische ist.
Es braucht also heute vor allem Offenheit und Mut. Dann erst wird Theater zu einer großartigen, pulsierenden und sich auf das vielfältigste im Jetzt spiegelnden Institution, die aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken ist. Dann erst wird Theater zur Heimat. //
Der Autor ist Hausregisseur am Schauspielhaus Bochum.
Das brasilianische Gefühl
Von Matthias Pees
Ich lebe ja jetzt in Brasilien, und da gibt es gar kein Stadttheater! Zwar zwei gleichnamige Gebäude in den Zentren von São Paulo und Rio de Janeiro, aber die stehen so gut wie immer leer. Schade, hier könnte ruhig öfter mal was stattfinden. Andererseits sind das so riesige, neoklassizistische Kolosse, viel zu groß für zeitgenössische Kunst, viel zu behäbig für Populäres. Und viel zu teuer, hier zu produzieren, für hiesige Verhältnisse. Ziemlich gefährlich auch für die Zuschauer, abends in den Zentren. Die Zeit des Stadttheaters in Brasilien scheint also eindeutig vorbei zu sein.
Und in Deutschland? Da scheint sich das Repräsentationstheater mitsamt seinem Anständige-Stücke-in-anständigen-Inszenierungen- Anspruch ja gerade wieder an allen Spiralblöcken vorbei bis in die erste Reihe vorzukämpfen: allenthalben halbgares Heile-Welt-Geschwätz, mitten im Kaputtgehen. Das sieht man von Brasilien aus vielleicht auch besser als von drinnen: das da doch alles kaputt geht in Deutschland. Das wird demnächst wie hier! Zu gefährlich in den Zentren: Alles voll kreischenden nackten Negern, blutüberströmt und kackeverschmiert, man versteht kein Wort und schon gar nicht die Zusammenhänge. Wenn du Glück hast und der Security-Guard Mumm hat, rettest du dich noch in irgendeine Eingangshalle eines leer stehenden Stadttheaters. Noch einmal davongekommen. NO FEAR 2004. In Recklinghausen haben wir versucht, mit den Ruhrfestspielen einen sozialen Ort zu entwickeln, mehr für den Aufenthalt denn für den Konsum gedacht, mehr für alternative Manifestation, Verortung, Andere Identität denn für Repräsentation und Serviceleistungskonzepte. Theater, Performance, Musik, die hier stattfanden, hatten mit diesem Ansatz zu tun, waren von ihm her gedacht und dabei mitnichten losgelöst vom »vorherrschenden Publikumsgeschmack «. Im Gegenteil: diesem Publikum, das es im Ruhrgebiet in viel umfangreicherem, ernsthafterem und brasilianischerem Sinne gibt als etwa in Berlin, war das Projekt schließlich gewidmet. »Das Publikum« ist aber keine Konstante, es gibt ja kein stehendes Publikumsheer, das nur auf seinen Einsatz im Theater wartete. Publikum ist das, was sich jeweils neu zusammensetzt aus den Leuten, die kommen oder zumindest demnächst auch mal kommen wollen. Insofern braucht es zumeist Zeit und Ausdauer, damit sich ein Publikum bildet. Man rechnet im Theater gemeinhin mit drei bis vier Jahren und vergibt Intendanzen deshalb auch entsprechend.
Ob man jedoch solch eine Wechselkur kulturpolitisch autoritär installieren kann, wie das in unserem Fall seitens der Landesregierung und gegen den Willen der Veranstalter geschah, erscheint im Nachhinein freilich zweifelhaft. Die regionalen (oder im Falle des DGB: rustikalen) Selbstbehaupter haben sich dagegen, weil es offensiv nicht ging, eben subversiv zur Wehr gesetzt, fast in oben beschriebenem Sinne: uns Widerstand geleistet, sabotiert und bei nächster Gelegenheit fortgejagt, um den alten Status quo wiederherzustellen. Gute alte Guerillataktik, fast schon brasilianisch.
Der Autor ist Dramaturg und hat mit Frank Ca storf das Konzept der Ruhrfestspiele 2004 erarbeitet.
»Ernstes Realismus-Problem«
Gespräch mit Marie Zimmermann

K.WEST: Inszenierungen, die auf irgendeine Weise anrühren, erstaunen, begeistern, erhellen, erschüttern – werden immer seltener. Inszenierungen, die auf irgendeine Weise langweilen, immer häufiger. Warum?
ZIMMERMANN: Das ist mir zu monochrom-düster, es fehlt nur noch der Zusatz: Und unser kranker Nachbar auch. Dass die Glücksmomente, die Momente verblüfften Erstaunens immer weniger werden, mag exponentiell zunehmen, je häufiger man professionell ins Theater gehen muss. Aber das Ungewöhnliche zu erfinden ist wohl eines der maßlosesten Unterfangen von Kunst überhaupt. Aus dem »Marat/Sade« von Peter Weiss stammt der Satz: »Das Neue entsteht nur aus ungeschickten Anfängen«. In diesem Sinne gibt es zu viele geschickte Anfänge derzeit. Heiner Müller hat einmal gesagt: Das Elend des deutschen Theaters bestehe darin, dass alle immer nur das machten, was sie können. Ich glaube, wir haben auf dem Theater wie in der Wirklichkeit im Moment ein ernstes Realismusproblem. Das heißt, die Bilder der sogenannten Realität, aus der heraus wir uns ins Theater flüchten oder retten – je nachdem – stülpen jeden Tag die Welt so verwirrend um und um, dass die Kunst so schnell gar nicht mitkommt. Dadurch wird das Theater entmachtet als Institution, die einem Weltbild Sinn gibt. Und die Verfahren, die damit arbeiten, der Welt mit Unsinn beizukommen – wie Castorf etwa –, sind einfach mittlerweile zu bekannt und werden außerdem von Epigonen mittlerweile in der dritten Generation ziemlich langweilig kopiert. Wenn vor einigen Jahrzehnten die bürgerlichen Klassiker so inszeniert wurden, dass der Abstand kenntlich wurde, und damit auch das Heute, dann hatte jeder Zuschauer die Originalbilder im Kopf. Das ist heute anders. Das Publikum ist heterogener geworden, die Regisseure sind heterogener geworden.
K.WEST: Sie glauben also, dass zu wenig experimentiert wird?
ZIMMERMANN: Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Die im engeren Sinne politische Aufgabe des Theaters ist vorbei, die Gesellschaft ist ausdifferenziert, wir sind ein bis an die russische Grenze nahezu durchdemokratisierter Kontinent, wo die Künste sich endlich viel freier verhalten könnten, weil sie diese Sekundäraufgaben gar nicht mehr übernehmen müssen. Marx’ berühmter Satz müsste jetzt heißen: Die Ökonomen haben die Welt nur verändert. Es kommt darauf an, sie zu interpretieren.
K.WEST: Das wäre die Stunde des Theaters!
ZIMMERMANN: Es könnte die Stunde des Theaters sein, wenn es nicht den ultimativen gesellschaftlichen Entwurf hinsetzen, sondern den Texten wieder mal eine andere Melodie ablauschen würde. Aber das passiert ja. Es gibt einfach in der Breite einen jungen Nachwuchs von sehr kompetenten Leuten in den Theatern, ich kann die These vom ubiquitären Niedergang des Regiehandwerks oder des Theaters nicht nachvollziehen. Was richtig ist, dass die großen stilprägenden Ikonen zurzeit fehlen. Aber auch weder Schröder noch Merkel sind Ikonen. Vielleicht sind die Zeiten für Charismatiker ein bisschen rau. K.WEST: Auf dem Theater wird immer noch das Stück vom Ich-Verlust gespielt. Der Film hat diese Scheu vor dem Subjekt nicht. Hat das Theater diese »Charakter«-Stärke aufgegeben?
ZIMMERMANN: Das hat was mit dem ästhetischen Augenblick zu tun, den das Theater zu verwalten und zu gestalten hat. Der Film kann epische Bögen erzählen, der Theater ist immer der Augenblick. Das ist so ziemlich schwierigste, was man im Leben machen kann.
Marie Zimmermann ist Schauspieldirektorin der Wiener Festwochen und designierte Intendantin der RuhrTriennale 2008-2010 (Interview: Ulrich Deuter)
Wenn die Nacht zum Tage wird
Von Thomas Oberender
//__Die Fenster des Probenraums wurden mit Holzplatten licht- und schalldicht verschlossen und die Oberlichter mit schwarzer Folie beklebt. Kein Ton, kein Sonnenstrahl dringt von draußen herein. Was immer auf den Bühnen unserer Stadttheater zu sehen und hören ist, wird in diesen Häusern der künstlich erhaltenen Nacht zur Erscheinung gebracht. Wie vieles muss ausgeschlossen werden, um ein wenig zu zeigen – die Gesichter der Schauspieler sind überformt von der Maske, die Körper von Kostümen, die Alltagssprache von Sprachformen der Literatur und tragenden Bauchstimme der Darsteller. Diese Theater wurden von Menschen gebaut, die der Überzeugung waren, dass in diesen Räumen der künstlich erhaltenen Nacht das Wort »Gegenwart« eine andere Bedeutung besitzt – dass hier etwas zu finden sein sollte, das so und sonst unter uns nicht anwesend ist: Eine Sprache, ein Wissen und Empfinden, das aus anderen Zeiten und Welten der unseren hinzutritt, ohne in ihr aufzugehen.
Im Theater des Tages hingegen wird ans Licht geholt, was das Theater der Nacht zum Verschwinden bringen muss. Im Theater des Tages spielen die Schauspieler scheinbar oder tatsächlich in ihrer Alltagskleidung. Sie sprechen sich mit ihren Taufnamen an, wirken ungeschminkt und spielen mit der Realität von Spielorten, die keine Theater waren – in Zechen oder Industriehallen oder im eigenen Wohnzimmer. Auch der Mann der Straße, der Politiker, der Experte wird dort auftreten. Dieses Nonfiction-Theater wird nicht dokumentarisch sein, sondern so fiktional wie nie zuvor. Und eben dafür wird dieses Theater mit allem spielen, das normalerweise keine Rolle spielt – mit Laien und der schönen Hässlichkeit des Banalen, der Sprache der Straße, der Dokumente, Medien und privaten Bekenntnisse. Auch das Theater des Tages lügt, um die Wahrheit zu sagen. Es sammelt ein und auf, als Rohstoffe, was im Theater der Nacht im Text geläutert wurde. Denn das Theater des Tages sucht die Suggestion der Unmittelbarkeit, der außerkünstlerischen Realität einer Biografie und Geschichte jenseits des Theaters, einer Gebärde, die nie für die Bühne trainiert wurde und eben daher auf ihr so künstlich und interessant wirkt.
Im Theater der Nacht leben die Vampire – lichtscheu. Fern des Tageslichts saugen sie das alte Blut der Texte und lauern lüstern auf frisches. Was privat und persönlich ist an ihnen, verbergen sie aristokratisch, und natürlich wissen sie, dass, wer einmal von ihnen gebissen wurde, ihrer Welt auf immer angehört. Was dieses Theater der Nacht zeigt, kann nicht weit genug entfernt von uns sein, um uns nahe zu kommen. Worte, die vor 2000 Jahren geschrieben wurden, oder in einem anderen Land gerade unlängst, leben im Theater der Nacht im Versprechen und Fluch der Unsterblichkeit, der endlosen Wiederholung und Wiedergängerei, bis ein jähes, plötzliches Jetzt die Wesen der Nacht erlöst. Dafür wird es sich in die Nacht dieser Texte versenken, die Augen an den Dämmer der anderen Welt langsam gewöhnen, um in ihm Schemen zu entdecken, die uns an Menschen erinnern – die da, oben, auf der Bühne, im Rampenlicht, sind keine von uns. Vor ihrem eigenen Spiegelbild stehend, sehen sie im Spiegel nichts. Sie brauchen zwischen sich und ihrem Bild das Papier ihrer Rolle, damit sie sich sehen. Und daran erkennen wir sie, die Händler der Unsterblichkeit.
Wann immer ich in diesen Theatern der Nacht sitze, denke ich an die Bürger, die sie einst erbaut haben. Speziell in Deutschland waren diese Theater Orte, an denen, in Helmuth Plessners Sinne, eine Identität der Kultur berufen wurde, anstelle eines Staates oder einer nationalen Wirklichkeit. Sie waren Identifikationsorte, an denen sich eine Kultur etablierte und nobilitierte, die grundverschieden von der politischen Realität sein konnte, ja – sie sogar ersetzte und zugleich auf die mentale Höhe ihrer eigenen Aktualität gelangen ließ. Dafür entrückten die Erbauer dieser Häuser sich ihrer Gegenwart, schufen sie sich diese Höhlen, ließen sie Gestalten wiederkehren, an denen sich ihre Eltern bildeten und sie ein anderes Verständnis von Macht etablierten. Ist ein solcher Geist wieder erweckbar? Oder verhält es sich mit diesen Häusern der Nacht wie mit den Kirchen in Ostdeutschland? Sind diese Theater unsere letzte Mahnung an jene Bürger, die unsere Großeltern einst waren? Oder werden diese Häuser irgendwann ganz vom Theater des Tages übernommen, von der Mentalität des Kinos, das nicht wiederholt, sondern originär produziert. Das Überleben unserer Theater in ihrer luxuriösen, tradierten Form wird unabänderlich an dieses Auseinanderdriften von Tag und Nacht, von Vergegenwärtigung und Gegenwart gebunden sein. Das deutsche Theatersystem, von dessen Krise ich nicht sprechen möchte, ist nur ein Symptom dieser Drift, die auch sein Publikum erfasst. Es wird sich mit seinem Verhältnis zum Licht beschäftigen müssen, wenn es in seiner jetzigen Form überleben will. Und es wird untergehen, wenn es seine Nacht zum Tage macht.
Der Autor des Textes ist Schriftsteller, leitender Dramaturg des Schauspielhauses Zürich und designierter Schauspielchef der Salzburger Festspiele.