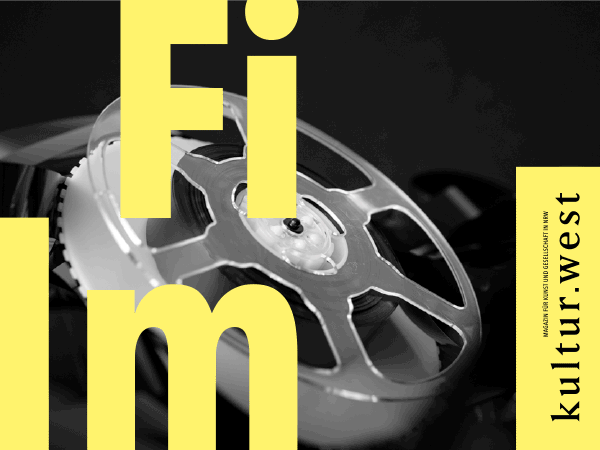»Omas Radio war beige, abgesetzt mit Elfenbein, in den hübsch geschwungenen Formen der beginnenden 60er Jahre. Seine durchbrochene Rückwand ermöglichte bei Betrieb des Radios den Blick in ein Röhrenmetropolis, in das hinein sich träumen ließ und das mit der Zeit auf bizarre Weise verstaubte, um dadurch noch phantastischer zu werden. Omas Radio sorgte für die Erschütterungen des Lebens, dort wurde mir eine Welt bewußt, die ich weit von der meinen vermutete, und als ich mich entschloß, diese Welt zu gewinnen, mußte ich meine bisherige verlassen. Meine, das war der Wald, der kleine Teich und die gespannte Aufmerksamkeit, dort Unberührtes zu entdecken, den Fuß auf eine Stelle zu setzen, wo nie zuvor ein anderer Mensch … – und am Radio lockte eine ganz und gar künstliche Welt, überall, berührt, bunt und grell …«
Eigentlich (und vielleicht Gewinn bringender) ließen sich diese Seiten mit den Geschichten füllen, die Manfred Trojahn im eben erschienenen Buch »Schriften zur Musik « keineswegs nur zur Musik erzählt. Eine sanfte Melancholie durchweht diese Erinnerungen, in denen der weit gereiste, längst großstädtisch-wendige Komponist sich in die Erlebniszonen der Kindheit zurückträumt. Da taucht nicht nur Omas Radio im sommerlichen Gartenhaus wieder auf und das verwunschene Haus des Wagner- versessenen Patenonkels mit den sorgfältig gepflegten Gewehren im Jagdzimmer und der »gerahmten, schlichten Weisheit des Führerspruches an der Wand«. Auch das Elternhaus wird heraufbeschworen, das Braunschweig der Nachkriegszeit, das nach Jahrhunderte alter Orientierung in Richtung Mitteldeutschland plötzlich den »Charakter des Geraden, Protestantisch-Langweiligen« annahm. Hier, im Flecken Cremlingen zwischen Braunschweig und Königslutter, wurde Trojahn 1949 geboren – als Sohn von Aussiedlern aus Westpreußen, wo man sich vor Zeiten noch Trojanowski nannte. Noch heute erwähnt Trojahn seine Eltern mit dem respektvollen Verständnis für Menschen, die sich ihre Existenz aus dem Nichts wieder aufbauen mussten. »Da war ich umgeben von Leuten, die aus gutem Grund auf eine ganz große Lebenssicherheit hinarbeiteten. Abenteuer in jeder Form war verpönt. Und natürlich war Sexualität ein totales Verdrängungsthema. « Bei diesen braven Leuten also schallte eines Tages aus dem elfenbeinverzierten Radio ein Werk, das alle erotischen Verdrängungen zur schieren Not verdichtete: Mozarts »Don Giovanni«. »Dieser Mensch faszinierte schon«, schreibt Trojahn im Aufsatz »Omas Radio«, »was machte der mit den Frauen? Hatte er Brausepulver? Und warum ging das so schlecht aus, hatte Oma recht mit ihrer Warnung vor den Dingen?… Ohne es zu wissen, war ich an den Rand eines Lebensgeheimnisses gekommen: Warum fasziniert uns der Abgrund?«
Solche Gedanken treiben wohl die meisten Pubertierenden um. Aber längst nicht alle können ihre Sehnsüchte in ein Meisterwerk der Musikgeschichte projizieren. »Ich habe mich dann mit Mozart näher beschäftigt und gelesen, dass er ein sinnlicher Mensch gewesen sei. Da wollte ich dann auch ein sinnlicher Mensch sein und habe versucht, das zu thematisieren. Aber man hat mir klar gemacht: Das hat mit uns nichts zu tun.« Der hormonelle Haushalt regelte sich dann irgendwann von selbst. Die sinnliche Faszination der Musik aber blieb – und der Wunsch, ein zweiter Mozart zu werden. Da das nicht an den Eltern vorbei ging, musste Trojahn junior den Nähroktober wert der Musik nachweisen. Also begann er, weil damals Orchesterplätze leicht zu haben waren, mit dem Flötenstudium und brachte es immerhin bis zum Meisterflötisten Karlheinz Zoeller an der Hamburger Musikhochschule. Doch statt ein sicheres Musikbeamtendasein zu führen, ging der Weg in eine höchst unsichere Richtung: das Komponieren. Bei den Braunschweiger Tagen neuer Kammermusik erschienen die Boten aus einer anderen Welt. Die heitere Souveränität des Südfranzosen Darius Milhaud faszinierten ebenso wie die Quirligkeit des italienischen Zwölftonpoeten Luigi Dallapiccola oder der charismatisch stechende Blick von Benjamin Britten. Kurz: der Eros Don Giovannis hatte gesiegt. 1971 begann Trojahn ein Kompositionsstudium bei Diether de la Motte in Hamburg.
Trojahn rauscht über den Sisalteppich in seiner großzügigen Düsseldorfer Wohnung, um noch einen Tee zu brauen. Reich bestückte Büchgerregale starren einen an, die Wände sind mit schönen Zeichnungen und farbkräftigen Gemälden geschmückt, während der Flügel im Hinterzimmer fast »versteckt« ist – ein Handwerkszeug und kein repräsentatives Möbel. Nach seinen eigenen schmunzelnden Erinnerungen war Trojahn einmal ein scheuer, schlaksiger Jüngling mit langem Haar. Heute fällt er, wenn man ihm im Einerlei des Konzert- oder Opernpublikums begegnet, eher durch das Gegenteil auf. Über dem meist schwarz gewandeten, kompakten Körper sitzt ein massiver, sorgfältig rasierter Schädel mit wachen Augen hinter der Nickelbrille. Wenn er seinem Gegenüber ironische Bonmots vor die Füße wirft, wirkt sein Selbstbewusstsein erst einmal niederschmetternd. Doch hinter der intellektuellen Maske steckt kein Zyniker, sondern eher ein Melancholiker, der die Welt ob ihrer Genüsse liebt, ohne ihre Fallstricke zu übersehen. Denn der Jungkomponist Trojahn musste gegen so manche Vorurteile und Anfeindungen kämpfen. Die meisten haben sich bis heute gehalten – vor allem der Vorwurf, in seinen Streichquartetten, Sinfonien und Liederzyklen die Tradition allzu hemmungslos auszubeuten. »Aber sehen wir es mal so: Was wir Avantgarde nennen, hat sich damals der Tradition bemächtigt und sie weggeschoben. Ich habe einen anderen Zugang dazu; die Sachen sind mir eigentlich zu wichtig, weil sie auch mein Leben zu sehr bewegen. Mir ist es unmöglich, das Schlussterzett des ›Rosenkavaliers‹ auszuhalten oder ›Butterfly‹. Davon abgesehen ist mir wichtig, das traditionell Gewachsene in das Denken mit einzubeziehen. Pierre Boulez hat gesagt, dass der avancierte Komponist sich weder auf die Vergangenheit noch auf die Gegenwart konzentrieren dürfe, sondern nur auf die Zukunft. Ich singe nicht dieses Lob des Gedächtnisschwunds.«
Wie an seine Kindheit, so erinnert sich Trojahn auch an das, was vor ihm an Wesentlichem geschrieben wurde: an den »Don Giovanni«, die Sinfonien von Beethoven, die Streichsextette von Brahms, die Musik eines Gustav Mahler oder Hans Werner Henze. All dies und noch mehr hat sich in Trojahns Musiksprache sedimentiert, ohne sie epigonal zu verkleistern. 1978 entfachte seine Zweite Sinfonie einen Skandal beim Musikfest in Donaueschingen, dem Allerheiligsten der zeitgenössischen Musik. Kein punktuelles Tröpfeln, sondern große, expressive Linien sind da zu vernehmen, silberne Fanfaren tönen herein, das Orchester schwelgt in Brucknerschen Farben, leidet wie bei Mahler, explodiert wie bei Henze – ein Elefant im Porzellanladen der Avantgarde. Als das Werk zum Festival nach Metz exportiert werden sollte, sträubten sich die feinfühligen Nachbarn, von »Neonazi-Musik« war in französischen Zeitungen zu lesen. »Das war eigentlich das Problematischste in diesem Zusammenhang, dass immer der Verdacht bestand, man habe eine rechte Gesinnung. Dabei bin ich genauso wenig rechts wie Stockhausen oder Boulez links sind. Mit politischer Gesinnung hat das nun wirklich nichts zu tun.«
Ein Jahr lang blieb Trojahn zum Studieren in Paris, lernte die Metropole und die französische Musik lieben. Noch heute hat das Ehepaar Trojahn eine Wohnung in Paris, und immer noch leuchtet durch den krachenden Furor und die endzeitliche Elegie der Fünften Sinfonie auch französische Klangsinnlichkeit hindurch. Aber Trojahn musste noch eine weitere Erfahrung machen, die seine Musik prägen sollte. »Irgendwann merkte ich, dass alles Italienische mich anzog – inklusive Mozart und Richard Strauss. Vielleicht ist so auch der Einfluss von Henze zu deuten, der seit Jahrzehnten in Italien lebt. Durch sein Auftreten in den sechziger Jahren hat er mir klar gemacht, dass ich Komponist werden wollte. Und er ist auch später immer ein starker Einfluss geblieben.«
Dieser Einfluss zeigt sich zumal in der suggestiven »Sprache« von Trojahns Werken, in denen eine theatralische, zuweilen »romanische « Deutlichkeit der Aussage vorherrscht. Hinzu kommt das Faible für Autoren wie Ingeborg Bachmann (Vokalzyklus »Lieder auf der Flucht«) oder Luigi Pirandello, der die Vorlage für Trojahns erste Oper »Enrico« lieferte, die er auf eine Texteinrichtung von Claus H. Henneberg komponierte. »Man darf es kaum sagen: aber ich habe eine große Liebe zur Gesellschaftskomödie, in der das Komische am Ende oft ins Schwarze umkippt.« Trojahn, der Opernmeister. »Das Genre Oper muß, wie alles andere heutzutage auch, mangels allgemeinverbindlicher Setzungen, in jedem Moment vom Künstler definiert werden«, schreibt er programmatisch in seiner Italien-Huldigung »Illyrien, mein umbrisches Neapel«. Neudefinition aber meint für Trojahn nicht unbedingt Neuerfindung. Und so wird gerade in seinen Opern das Weiterdenken des Henzeschen, vielleicht sogar des Mozartschen Musiktheaters evident – immerhin hat er für eine Produktion der »Clemenza di Tito« in Amsterdam die Rezitative von Mozarts Opera seria neu komponiert und dabei die Stimmen in einen Zauberwald irrealer, zugiger Klänge versetzt. Wie Henze besteht auch Trojahn auf narrativen Strukturen, die das Artifizielle, Enthobene nicht ausschließen. »Die kindliche Verabredung: ›du mußt jetzt tot sein‹ beim Indianerspiel mit dem Holzgewehr «, schreibt Trojahn posthum an seinen Librettisten Henneberg, »ist eine der Grundfesten des Theaters, und es fordert diesen ganzen kindlichen Ernst im Spiel, das Theater, die Oper zu lieben.«
In der Oper findet Trojahn das, was ihn einst als »ganz und gar künstliche Welt« faszinierte. Da macht es kaum einen Unterschied, ob er sich diese Künstlichkeit nach dem Vorbild von Shakespeares Illyrien erschafft – wie in der Oper »Was ihr wollt« (1998) – oder im bürgerlichen Ambiente von Pirandello. Dem sizilianischen Autor und seinen Gesellschaftskomödien blieb Trojahn auch im Opern-Triptychon »Limonen aus Sizilien« treu, das 2003 in der Kölner Regie von Günter Krämer eine ziemlich verunglückte Geburt erlebte – worauf der Komponist zur Selbsthilfe griff und das Stück in Würzburg eigenhändig inszenierte. Seither empfiehlt er jedem Kollegen, der sich über entstellende Inszenierungen erregt, das Regiehandwerk einmal selbst auszuprobieren. Schon in »Limonen aus Sizilien« hat Trojahn auch einen Autor des neapolitanischen Volkstheaters hineingeschmuggelt, der ihn derzeit bei einem neuen Projekt beschäftigt: Eduardo De Filippo. Seine Komödie »La grande magia« (Der große Zauberer), manchem noch in Giorgio Strehlers legendärer Inszenierung im Gedächtnis, komponiert Trojahn für die Dresdner Oper; 2008 soll die Uraufführung sein. Überhaupt kann sich der Komponist über Aufführungen und Aufträge nicht beklagen. Nur eine Erfüllung blieb ihm letztlich versagt: die Vertonung des »Merlin« von Tankred Dorst, der am Ende kein brauchbares Libretto hergab. So blieb es blieb bei einigen musikalischen Fragmenten: Splitter einer nie komponierten Oper über ein letztlich unmögliches Stück. //
Manfred Trojahn: Schriften zur Musik, hrsg. von Hans-Joachim Wagner, Frankfurt/M.-Basel: Stroemfeld Verlag 2006