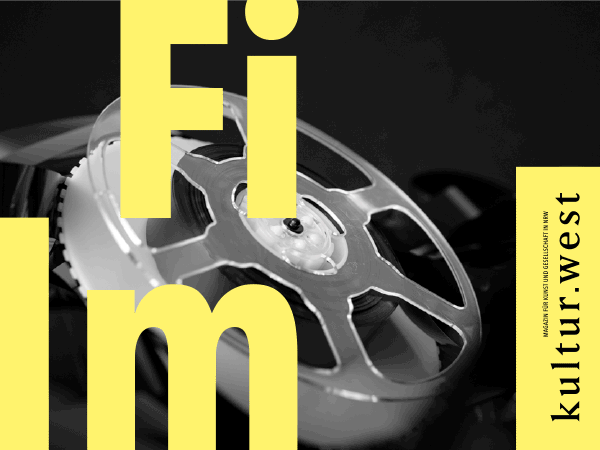TEXT: FRANK MAIER-SOLGK
25 Meter hoch agen die drei wuchtigen Ecktürme. Schieben sich über einen mächtigen Bau, dessen gleichmäßig geschlossene Fassade nur von wenigen großen, von harten Stahlrahmen eingefasste Fenster durchbrochen wird. Abweisend wirkt diese Fassade zunächst, doch auch wie gewachsen: ein feines, sichtlich von Menschenhand gefertigtes Ziegelmauerwerk von mattem, warmem, gleichmäßigem Grau. Wie ein ehrfurchtgebietendes mittelalterliches Kastell erhebt sich Kolumba, das neu eröffnete Kunstmuseum des Kölner Erzbistums, im engen Gewirr der Kölner Altstadtgassen, unweit vom Dom. Äußerlich erhaben, ernst und massiv – eine vielleicht nicht unbedingt einladende, aber doch ungemein spannungsvolle Gottesburg.
Vier Jahre Bauzeit, elf Jahre Planungszeit und in die 1970er Jahre zurückreichende Überlegungen gingen dem nun fertig gestellten Neubau des Diözesan-Museums voraus. Sein ebenso einfacher wie in der Ausführung komplexer Grundgedanke: Über den Ruinen der kriegszerstörten spätgotischen Kolumbakirche und dem witterungsgefährdeten archäologischen Grabungsfeld der romanischen Vorgängerbauten ein Museum für die Kunstsammlung des Erzbistums zu errichten. Eines, das die kirchenbauliche Geschichte des Ortes erhalten und dabei auch die Kapelle »Madonna in den Trümmern« von Gottfried Böhm aus den frühen 50er Jahren integrieren sollte.
Der Gedanke ist Wirklichkeit geworden, die Idee, so problematisch sie schien, gelungen. Der Schweizer Peter Zumthor, ein ungewöhnlicher, sehr langsam und eher Weniges bauender Architekt, war der richtige für diese Aufgabe. Entstanden ist ein Bau, der das Kontinuum der Geschichte zu suggerieren vermag – schon äußerlich, indem er der alten Umfassungslinie der Kirche sichtbar folgt und etwa entlang der Brückenstraße die kleine Reihe von erhaltenen Fenstern der spätgotischen Kirche mit ihrem feinen Maßwerk in seine Mauern fugenlos einbindet.
Der Eingang im Westen, in dem an den historischen Kirchenraum nördlich anschließenden Annexflügel, ist als hartkantige Öffnung in die Fassade eingeschnitten. Beim Eintritt geht es einem wie dem Kirchenbesucher, der zunächst in einen engen Vorraum gelangt, der nur seitlich seinen Fortsetzung findet. Hier führt der Weg nach links in einen abgedunkelten kleinen Vorraum, in dem sich die Kasse befindet. Daran schließt sich ein lichtes Foyer an, in dem man die Wahl hat: geradeaus den ehemaligen Kirchen- und jetzigen Grabungsraum zu betreten; daneben über einen schachtartigen Treppengang hinauf zu den Ausstellungsebenen zu steigen; oder aber sich als Einstimmung einen Moment innerer Sammlung in dem ehemaligen Kirchhof zu gönnen, zu dem sich das Foyer mit einer seitlichen Glaswand in ganzer Höhe öffnet. Dieser Hof ist ein intimer, von einer halbhohen Mauer eingefasster, kiesbedeckter und mit elf Gleditschien (Christusdorn) bepflanzter innerstädtischer »hortus conclusus«, in dem eine Steinskulptur – »Die große Liegende« des Schweizer Bildhauers Hans Josephson – und einige zwanglose herumstehende Garten- stühle das »Mobiliar « bilden. Es ist ein großes Verdienst von Peter Zumthor, diesen kleinen Freiraum innerhalb seines massiven Gevierts erhalten zu haben, wo sich im wahrsten Sinn des Wortes Luft zum Atmen holen lässt und wo mit einem Rundblick von der Nordwand der Kirchenruine mit ihren gotischen Resten über die modernen Gebäude der Nachbarschaft auch eine erste historische Ortsbestimmung möglich ist.
Zurück ins Foyer und von dort in die Grabungsstätte, dem größten und gewiss eindrucksvollsten Raum des Museums. Er ist eine ins Halbdunkel getauchte, zwölf Meter hohe Halle, die durch ihr sogenanntes Filtermauerwerk – von Freistellen durchbrochene Ziegel – die für die archäologischen Fundamente erforderliche Luft sowie das für eine geheimnisvoll dramatische Stimmung nötige Licht erhält: Fleckenförmig fällt es ein, gedämpft klingt der Straßenlärm. 13 schlanke, zwischen die Fundamente eingesenkte, konstruktiv maßgebliche Rundsäulen verstärken den Eindruck eines sakral überhöhten Andachtsraums der 2000-jährigen Geschichte, der seitlich auch noch das Oktogon von Gottfried Böhms Nachkriegskapelle gewissermaßen als neuzeitliches Ausstellungsstück in sich birgt.
Peter Zumthor hat es im Gespräch als vornehmste Aufgabe des Architekten bezeichnet, einen Bau zu errichten, der seinem intendierten Gebrauch am besten dient. Er wolle kein Museum, das dem »Bilbao-Effekt« und damit dem Stadtmarketing huldigt, etwa durch eine sensationelle äußere Form. Dennoch ist auch die Architektur von Kolumba stark auf Wirkung hin berechnet. Es ist eine der Qualitäten des Baus, der vom Bauherrn gewünschten Konzentration auf die Kunst und die Geschichte des Ortes mit ureigensten architektonischen Mitteln gerecht zu werden, also selbst Präsenz zu beanspruchen und dennoch der Kunst zu dienen. Äußerlich und in der Grundkonzeption geschieht dies durch das Prinzip der Überoder Weiterbauung, das, den hiesigen Gepflogenheiten im Umgang mit historischen Ruinen weitgehend entgegengesetzt, einmal nicht Alt und Neu als räumlich distanzierte Gegensätze gegenüberstellt und die Kriegszerstörung als offene Wunde mahnmalartig präsentiert. Insofern ist etwa Egon Eiermanns Neubau der Berliner Kaiser Wilhelm-Kirche der klassische Antipode. In Köln wird am Alten weitergebaut, werden Lücken geschlossen, Fragmente miteinander verbunden und die lokale, seit dem 9. Jahrhundert vorgegebene historische Kontinuität des Überbauens in die Gegenwart überführt.
Im Kolumba-Inneren demonstriert Zumthor seine Treue zur Historie durch eine Raumgliederung, die die Grundrissfigur der fünfschiffigen gotischen Kirche auch im Ausstellungsbereich spürbar sein lässt – zumindest auf der über dem Grabungsraum gelegenen zweiten Ausstellungsebene. Hier hat der Architekt um einen zentralen Ausstellungsraum sechs kleinere, kabinettartige Räume gruppiert, mit jeweils individuellen Grundrissen und unterschiedlichen Höhen. Die meisten Räume erhalten von Seitenund Seitenoberlicht einfallendes Tageslicht, verzichten auf die in Kunstmuseen vielfach gebräuchliche konstante Beleuchtung. Während das erste Obergeschoss, das auf das nördliche Annexgebäude begrenzt ist, mit seinen fünf – vielleicht doch etwas eng geratenen – Kunstlichträumen eher vorbereitenden Charakter besitzt, spielt Zumthor auf dieser weit spektakuläreren zweiten Ebene souverän mit den je nach Lichteinfall und Himmelsrichtung variierenden Stimmungen; mal nüchtern-klar, mal gedämpftfeierlich wirkt so das Grau der Wände. Hinzu kommt eine im gesamten Bau durchgehaltene eminent sinnliche Materialität: Hier herrscht nicht die aseptische Atmosphäre des White Cube, auch nicht die in vielen neueren Museen zur Schau gestellte polierte Eleganz, die Museumsräume wie Mode-Showrooms einer gleichen zeitlosen Ästhetik unterwirft. Stattdessen lichtgrau verputzte Wände, fugenlose Böden aus Kalkstein oder hellem Terrazzo, Decken aus Mörtel, die von einem Netz von Haarrissen durchzogen sind. Diese bewusst karge und trocken-spröde Materialität, die sich förmlich riechen lässt, ist der gewissermaßen baumeisterlich betonte Hintergrund für eine spirituell interpretierte Kunstgeschichte. Am stärksten ist dieser Eindruck bei drei schmalen, zum Teil über elf Meter hohen Kabinetten, die, durch matte Seitenoberlichte erhellt, die reduzierte klösterliche Atmosphäre am intensivsten vermitteln.
Das Museum ist eher zurückhaltend, fast sparsam mit Kunstwerken bestückt. Konzentration und Ruhe lautet die Überschrift. Jährlich mehrfach wechselnde Ausstellungen zeigen eine Auswahl von Arbeiten der eigenen, in ihrem Umfang nicht präzise benannten Sammlung – von der Spätantike bis in die Gegenwart, ohne Beschriftung, unabhängig von chronologischen, stilgeschichtlichen oder medialen Zusammenhängen. Man begegnet vielfachem Madonnenlächeln, aber auch Georges Rouault, Heinrich Campendonk, Antoni Tàpies, Joseph Marioni, August Macke. Eine Konrad Klapheck-Maschine schaut ein spätmittelalterliches Hausaltärchen an, Andy Warhols »Crosses« flankieren einen Kölner Schmerzensmann aus dem 16. Jahrhundert; eine Raumskulptur von Rebecca Horn ist ebenso da wie Stefan Lochners »Madonna mit dem Veilchen«. Man vertraut der sinnlich- geistigen Präsenz der Werke und hat die Platzierung der Arbeiten der Vorgabe durch die Architektur überlassen. Viel, sagt Peter Zumthor höflich, habe er während seiner Arbeit über eine Kunst gelernt, die hier noch ernst genommen werde. Aber man täusche sich nicht. Die Kunst in Kolumba – und des Kardinals und Bauherrn heftig umstrittene Rede bei der Eröffnung scheint es zu bestätigen – soll wohl doch weniger zur spielerisch freien Kontemplation anregen. Sie dient, laut erzbischöflichem Generalvikar, dem »missionarischen Anliegen«. Wer begriffen hat, was Kunst bedeutet, aber ist gegen solche Zumutung gefeit. //
Kolumba. Kunstmuseum des Erzbistums Köln, Kolumbastr. 4, tägl. außer Di 12–17 Uhr. Tel.: 0221/933193-0. www.kolumba.de