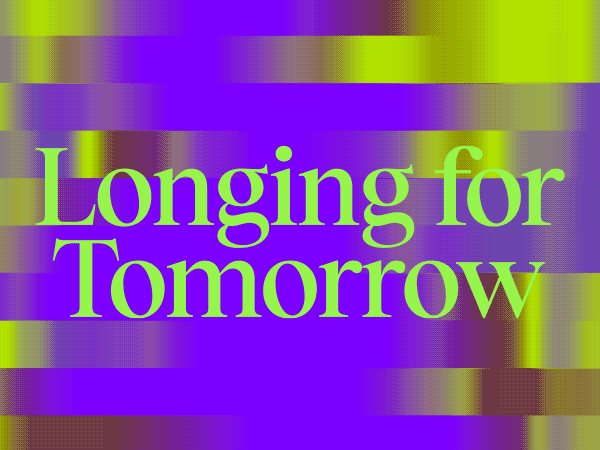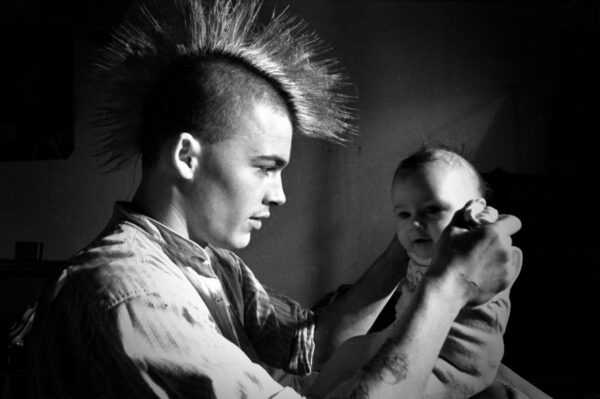Es ist ein Einschnitt: Nach 27 Jahren hat Lars Henrik Gass die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen verlassen und Madeleine Bernstorff die künstlerische Leitung gemeinsam mit Geschäftsführerin Susannah Pollheim übernommen. Die Filmkuratorin war schon seit 2000 in der Wettbewerbs-Auswahlkommission tätig. Damit steht sie für Kontinuität und Wandel zugleich. Sie will mehr auf Teamarbeit setzen – das zeigt sich auch darin, das sie das Interview gemeinsam mit der Filmkuratorin Katharina Schröder gibt.
kultur.west: Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen blicken auf eine ebenso beeindruckende wie bewegte Geschichte zurück. Was bedeutet das für Sie und für Ihre Arbeit?
SCHRÖDER: Ich bin mir jederzeit bewusst, dass es diese Geschichte gibt. Aber ich empfinde diese lange Tradition nicht als Bürde. Es ist ein Privileg, diese Geschichte wahrzunehmen, zu spüren und auf das zurückgreifen zu können, was war. Und natürlich auch mitzudenken, wohin sich das Festival entwickeln kann.
BERNSTORFF: Um ein wenig auszuholen. Was mir und Susannah Pollheim als gemeinsamen Leiterinnen wichtig ist, ist hier an diesem Ort noch ein anderes Team-Playing zu gestalten. Der konkrete Ausdruck davon ist diese Programmkommission, mit der wir uns regelmäßig treffen. Wir haben dann lange darüber nachgedacht, wie lässt sich dieser Gedanke der Zusammenarbeit auch über größere Entfernungen hinweg, denn die Mitglieder der Programmkommission leben über verschiedene Städte verteilt, als Bild repräsentieren. Schließlich haben wir uns für eine Collage entschieden, in der unsere aus Farbfotos kommenden Köpfe auf den Schwarz-Weiß-Körpern derer collagiert sind, die bei der Verkündung des Oberhausener Manifests anwesend waren. Es gibt dabei auch Personen, deren Köpfe sitzen etwa auf dem Körper von Alexander Kluge und anderen Berühmtheiten. Insofern erzählt die Collage von der Geschichte des Festivals und unserer Idee, wie es sich heute entwickeln kann.
kultur.west: Ich weiß, die Frage nach Trends ist immer heikel. Haben Sie den Eindruck, dass sich die gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in die eingereichten Kurzfilme eingeschrieben haben?
SCHRÖDER: Ich glaube, man sollte eine derartige Frage nicht auf das Politische verengen. Aber die Stärke des Kurzfilms als Form liegt sowieso in seiner Offenheit. Insofern kann es den einen großen Trend nicht geben. Aber es fällt auf, dass sich eine größere Zahl von Filmemacher*innen mit der Geschichte des Films oder seiner Materialität beschäftigen.
BERNSTORFF: Wir alle in der Auswahlkommission sichten pro Person in etwa 900 bis 1000 Filme im Jahr. Da kriegt man bestimmte Entwicklungen mit, aber trotzdem kann man nie sagen, hier ist ein Trend. Es gibt ein paar Tendenzen, die fallen auf. So hatten wir in der Auswahl einige Filme, die sich mit Flucht und Migration beschäftigen. Das hängt natürlich mit den großen gesellschaftlichen Debatten zusammen. Insgesamt kann man sagen, das Interessante ist ja, dass der Kurzfilm sehr viel näher an den Zeitläufen ist, weil die Leute nicht jahrelang Geld auftreiben müssen.
kultur.west: Die gemeinsame Arbeit im Team ist für Sie ein entscheidendes Merkmal der Neuausrichtung. Was heißt Team-Play für die Programmauswahl?
BERNSTORFF: Was aufgefallen ist, das hat zum Beispiel auch der Kollege Carsten Spicher vom Deutschen Wettbewerb gesagt, dass im Lauf des Auswahlprozesses sehr viel mehr als vorher geredet und diskutiert wird, und nicht nur mehr, sondern auch viel genauer. Das ist natürlich aufwendig, aber auch fruchtbar. Ich glaube, es ist uns gelungen, eine gute Ebene für die Diskussion zu schaffen, die uns hilft, auch Konflikte gut zu verhandeln. Von diesen ausführlicheren Gesprächen wird auch das Publikum profitieren. Denn es sind Mitglieder der Auswahlkommission, die während des Festivals die Publikumsgespräche moderieren und ihre Erfahrungen in den Dialog mit den Filmemachenden und dem Publikum einbringen können.
SCHRÖDER: Aber es gab natürlich längere Aushandlungsprozesse und durchaus auch kleinere Kämpfe. Wir mussten uns selbst Regeln geben. Natürlich wollten wir ein Klima etablieren, in dem alle vernünftig gehört werden. Zugleich muss am Ende ein Ergebnis stehen. Zwischen diesen Seiten zu navigieren, war eine sehr interessante Erfahrung.
kultur.west: Im vergangenen Jahr gab es eine Protestaktionen gegen Lars Henrik Gass, der sich kritisch gegenüber Antisemitismus geäußert hatte. Wie gehen Sie mit den insgesamt sehr aufgeheizten Diskussionen um gesellschaftliche Fragen, aber eben auch um Kunst und Kultur um?
SCHRÖDER: Dadurch, dass wir überhaupt diese Gesprächsformate etablieren, setzen wir dieser Entwicklung etwas entgegen. Meine Erfahrung aus dem letzten Jahr ist, dass es diese sehr starke Polarisierung, die von vielen wahrgenommen wird, gibt, aber es gibt sie so vor allem im digitalen Raum. Wenn man sich dann wirklich begegnet, sich in die Augen schaut, entsteht eine andere Situation, und in der kommt man dann auch wieder ins Gespräch. Da zeigt sich auch wieder eine Bereitschaft, auch zuzuhören, Einwände und Zwischentöne zu akzeptieren. Ich glaube, es ist zu kulturpessimistisch zu sagen, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. So ist es nicht.
BERNSTORFF: Als Festivalmacher*innen ist es uns wichtig, mit klarer Haltung zu vertreten, dass die Zwischentöne, die Ambivalenzen, sichtbar werden und auch bleiben. Wir bemühen uns, einen freundlichen Raum zu schaffen, in dem das möglich ist. Zugleich muss ich aber auch sagen, dass Konflikte immer schon zur Geschichte der Kurzfilmtage gehörten. Man muss doch nur an das sehr schwierige Verhältnis zur DDR und ihren politischen Verantwortlichen erinnern, von dem auch unsere diesjährige Programmreihe »Umwege zum Nachbarn – Der Film der DDR in Oberhausen« zeugt.
kultur.west: Was empfehlen Sie aus dem Programm?
SCHRÖDER: Ich empfehle, eine Offenheit mitzubringen, sich auf ganz unterschiedliche Arbeiten einzulassen, also vielleicht mal zu gucken, okay, was passiert, wenn ich mich in einem Wettbewerbsprogramm wiederfinde und was passiert, wenn ich danach in ein Themenprogramm mit DDR-Filmen gehe? Wie kommunizieren diese ganz unterschiedlichen Arbeiten in einem? Was für eine Spannung entsteht dabei?
BERNSTORFF: Ich würde gerne auf zwei Programmpunkte hinweisen, die auf mehrere Jahre angelegt sind. Der eine widmet sich der Recherche des Filmwissenschaftlers Christoph Hesse, der gerade an einem Buchprojekt zur Entstehungsgeschichte von Claude Lanzmanns »Shoah« arbeitet. Er wird Materialien aus seinen Recherchen zeigen. So entsteht eine fast schon Workshop-ähnliche Situation. Der andere Programmpunkt widmet sich dem filmgeschichtlich vernachlässigten Genre der Omnibus- und Episodenfilme. Dabei sind die gerade für uns besonders interessant, weil in ihnen der Kurzfilm im Langfilm vorkommt, dieses Jahr feministisch grundiert.
Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen finden 29. April bis 4. Mai statt

Madeleine Bernstorff, Jahrgang 1956, hat in München und Zürich studiert und 1984 das Kino Sputnik in Berlin-Wedding mitbegründet. Seither ist sie als Filmkuratorin, Autorin, Publizistin und Dozentin, unter anderem an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf, tätig.

Katharina Schröder, Jahrgang 1993, hat in Bochum, Göteborg, Paris und Amsterdam studiert. Von 2020 bis 2024 gehörte sie zum Leitungsteam vom blicke filmfestival des ruhrgebiets. Für die Kurzfilmtage arbeitet sie seit 2018 und ist nun für den Internationalen Wettbewerb verantwortlich.