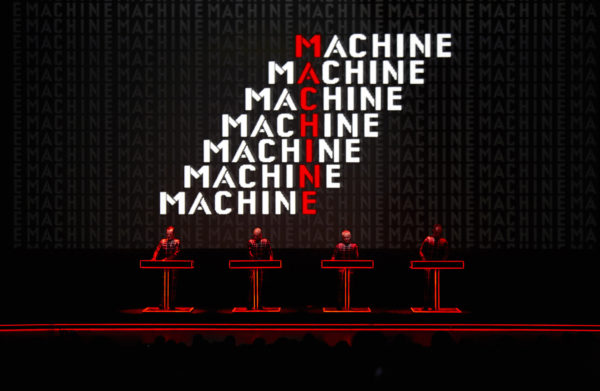Industriearbeit hat es längst in den Kanon der Kunst geschafft. Das ist vor allem im Ruhrgebiet mehr als augenscheinlich, wo es etliche Industriemuseen gibt. Auch schaffen Künstler*innen mit den Methoden der Stahlproduktion oder mithilfe von 3D-Druckern Skulpturen. Haushalts-, Pflege-oder Betreuungs-Arbeiten, heute unter dem Begriff Care-Arbeit zusammengefasst, sind im Kunstkontext noch nicht besonders stark vertreten. Sie stehen am Rand – genau wie im Gesellschaft- und Wirtschaftsleben. Die Ausstellung »Kochen Putzen Sorgen. Care-Arbeit in der Kunst seit 1960« im Josef Albers Museum Quadrat in Bottrop gibt endlich einen guten Überblick.
In der Ausstellung werden ausschließlich Arbeiten von Künstlerinnen gezeigt, 40 sind es insgesamt, die sich in Videos, Fotografien, Gemälden, Skulpturen oder Installationen künstlerisch mit Care-Arbeit auseinandergesetzt haben. Außerdem gibt es Dokumentationen von Performances oder Materialien aus dem feministischen Archiv ausZeiten in Bochum oder dem Frauenzentrum Courage in Bottrop.
Geht man als Mann durch diese Ausstellung, fühlt man sich wahrscheinlich immer ein wenig wie der Fernsehmoderator in einem TV-Ausschnitt von 1987, der auf einem alten Röhrenfernseher in der Ausstellung zu sehen ist: Zwei feministische Künstlerinnen des mexikanischen Kollektivs Polvo de Gallina Negra hängen ihm live eine Schürze mit schwerem Bauch-Teil an und machen ihn zur »Mutter für einen Tag«. Dazu bekommt er Pillen, um etwa Sodbrennen oder Verdauungsprobleme zu simulieren. Der Moderator macht kurz mit, kichert mit seinem Sidekick über die Situation und legt die ungewohnte Rolle nach ein paar Minuten wieder ab. Nein, er wird nie wirklich nachvollziehen können, wie es ist, Mutter zu sein.
Feministische Kämpfe
In der Ausstellung wird die Rolle der hausarbeitenden Frau vor allem als eine gesellschaftlich nicht besonders hoch bewertete dargestellt – und in vielen Arbeiten vor allem auch als ökonomisch benachteiligte beziehungsweise überhaupt nicht relevante. In den ersten der acht Räume wirkt die Hausarbeit sogar unheimlich, beängstigend, vereinsamend, die Küche wie ein Gefängnis. Die Videoarbeit, deren Ton den ersten Raum erfüllt, heißt »Semiotics of the Kitchen«. Martha Rosler hat sie 1975 gedreht. Sie zeigt typische Küchenutensilien wie die Nudelrolle, den Saftpresser oder ein Messer in die Kamera und führt die typischen Bewegungen vor, die Frau damit ausführen soll.
Die Begriffe der Dinge, die die Haushalts-Arbeiterin umgeben, erklingen stoisch und emotionslos. Die Bewegungen, die die Künstlerin mit ihnen ausführt, haben etwas ruckartiges, unterschwellig aggressives, drücken Wut und Verachtung für diese Art der Arbeit aus. Mit dem Messer sticht sie etwa mehrmals in die Luft in Richtung der Kamera – und also des Zuschauers. Eine Befreiungs-Bewegung? Wehrhafte Gesten, um der Unterdrückung zu entkommen? Die Videoarbeit könnte außerdem daran erinnern, dass die Küchenarbeit, die lange Zeit – und in vielen Teilen der Gesellschaft bis heute – als vornehmlich weiblicher Bereich galt und gilt, dass sie lange kein institutionell erlernbarer Bereich mit einem klar definierten Zeichensystem war. Sie war tradiert, variierte von Familie zu Familie, wurde von Frau zu Frau weitergegeben.
Im Kunstmuseum Bochum war vor drei Jahren eine fantastische Ausstellung der Schweizer Künstlerin Evelina Cajacob zu sehen, die diese traditionell im weiblichen Bereich angesiedelten Tätigkeiten und Objekte der Hausarbeit zu einem quasi heiligen Raum überhöhte und transzendierte. Einem Raum, der losgelöst ist vom kapitalistischen Zugriff, in den sich familiäre Geschichte und Haltungen zur Welt ein- und fortschreiben, dessen Traditionen mündlich weitergegeben werden, von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation. Arbeit, die Verbindung schafft, gerade weil sie nicht dem Kosmos der Lohnarbeit angehört.
Solch eine positive Sicht auf Haus- oder Care-Arbeit gibt es in der Bottroper Ausstellung nicht. Die Arbeiten, die vor allem aus der feministischen Welle stammen, die von den 1960er bis in die 1980er Jahre rollte, zeigen sie als Unterdrückungsmechanismus der patriarchal geprägten kapitalistischen Gesellschaft. In Vitrinen und an Wänden sind Materialien aus den feministischen Kämpfen der Vergangenheit zu sehen. Auch viele künstlerische Arbeiten lassen sich als Ausdruck eines politischen Kampfs lesen. Eine Arbeit trägt den Kampf im Titel: »Der doppelte Kampf der Wrestlerinnen« der mexikanischen Fotografin Lourdes Grobet zeigt Wrestlerinnen beim Kampf im Ring und bei der Care-Arbeit Zuhause.

Im selben Raum läuft eine Video-Arbeit von Krystyna Gryczelowska. »24 Stunden im Leben von Jadwiga L.« heißt sie und zeigt eine Frau, die in einem Alltag aus pausenloser Arbeit gefangen ist. Abends kocht sie das Essen für ihre Familie vor, dann geht sie zur Nachtschicht, zum Drähte ziehen, umgeben von vielen anderen Frauen ihrer Generation. Morgens bringt sie ihr Kind in die Tagesstätte, der Tag geht weiter mit Einkaufen, Schlangestehen, Aufräumen, Kochen, Bügeln, Spülen, den Wecker stellen. Dieser Film braucht keinen Kommentar, seine Botschaft ist klar und den meisten Betrachtern wird bewusst sein, dass es auch in der Gegenwart noch viele Entsprechungen der Jadwiga L. gibt.
Unter den ausgestellten Werken sind viele frühe Arbeiten von Künstlerinnen, die heute einen großen Namen in der Szene haben wie Rosemarie Trockel oder Valie Export. Auch Chantal Akerman wurde berühmt für »Jeanne Dielmann« von 1975, der in vielen Umfragen und Listen als einer der besten Filme der Geschichte genannt wird. In der Ausstellung ist ihr erster Kurzfilm von 1968 zu sehen: »Explodier, meine Stadt«, den sie drehte, nachdem sie gerade das Studium an der Filmhochschule abgebrochen hat. Man sieht eine Frau in ihrer Wohnung, wie sie sich bei dem Versuch verliert, Ordnung ins Chaos zu bringen. Am Ende steht eine angedeutete Explosion, als sie nach heftigen Gefühlsturbulenzen einen Brief am Gasherd verbrennen will. Es ist nicht klar, ob die Explosion unabsichtlich geschieht – oder hier wieder das Motiv der Befreiung aufflammt. Ein selbstbestimmter Austritt aus dem Leben, das voller Ketten ist.
Stark sind auch die vielen Fotografien in der Schau: Natalia Iguiñiz portraitiert in ihrer Serie »La Otra« (»Die Andere«) peruanische Hausangestellte neben ihren Dienstherrinnen. Diese Anderen sind meist unsichtbar, in fast allen Motiven auch körperlich kleiner. Das Motiv der »Anderen« wird in Südamerika meist mit der Geliebten assoziiert, die die Frau in ihrer Stellung bedroht. Diese Anderen haben keine Macht – bis sie sich als politische Gruppe begreifen und für ihre Rechte eintreten. Koreanische Krankenschwestern haben dies in Deutschland getan – auch daran erinnert die Ausstellung. »Geschätzt, aber nicht mehr gebraucht – wir sind keine Ware!«, heißt es in einem ihrer kämpferischen Slogans, der sehr an Max Frischs Kommentar zum Phänomen der sogenannten Gastarbeiter erinnert: »Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.«
Wenn die Bottroper Ausstellung eines besonders verdeutlicht, dann dass unsere Gesellschaften noch einen weiten Weg zu gehen haben wird – zum Ziel des gleichberechtigten Lebens und Arbeitens aller Menschen.
»Kochen Putzen Sorgen. Care-Arbeit in der Kunst seit 1960«
bis 3. März 2024
Josef Albers Museum Quadrat, Bottrop