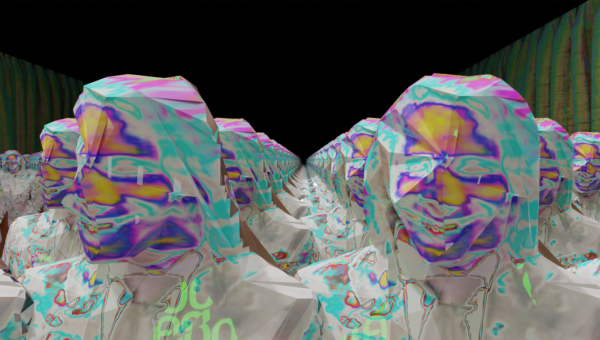Was Fassbinder für die Bundesrepublik der späten sechziger bis frühen achtziger Jahre (viel zu kurz) gewesen ist – kritischer Chronist der Gesellschaft am Modell weiblicher Figuren, die Mechanismen von Macht und Ohnmacht wie unter einer Lupe sichtbar machen, ist Pedro Almodóvar für das Spanien nach der Franco-Diktatur, das sich als verspätete Republik (nach deren Vernichtung 1936/39) in den 1970er Jahren neu erfand. Seinen Satz »Mein Ideal einer Geschichte ist eine Frau, die sich in einer Krise befindet.« hätte auch der wenig ältere RWF sagen können. Dass Almodóvar erst zu diesem kleinen Jubiläum, nämlich der 25. Folge unserer Serie, zur Ansicht kommt, ist eigentlich verspäteter Tribut.
Der 1949 in der La Mancha geborene Almodóvar bestimmt mit seiner Kreativ-Factory seit beinahe vier Jahrzehnten und mit zwei Dutzend Filmen das Kino seines Landes und Europas. Beeinflusst wurde er vom Hollywood der farbsatten Melodramen des Douglas Sirk (Ästhetik und Set-Design mit dem berühmten Almodóvar-Rot sind selbst stilprägend exquisit) und den feinsinnig ironischen Komödianten Ernst Lubitsch, George Cukor und Billy Wilder. Ihm gelingt der Spagat, zugleich Camp und spanischer Volkskünstler zu sein. Penélope Cruz wurde mit und dank ihm zu einer atemberaubend guten Schauspielerin und, wie auch Antonio Banderas, zum Weltstar.
Es sind Familienfilme, allerdings in einem schräg verschobenen, schillernden Sinn, nicht gemäß dem katholischen Ideal einer unter Oberhoheit des Mannes stehenden Einheit mit einer verweltlichten heiligen Mutter und braven Kindern, sondern orientiert an anderen sozialen Strukturen, verbunden durch Freundschaft, Eros und Sinnlichkeit, Solidarität, Empathie. Almodóvar hat sich um die Selbstermächtigung der spanischen Gesellschaft verdient gemacht. Spielerisch, im Frühwerk überkandidelt, bevor er in seine klassische Periode als großer Erzähler eintrat mit mindestens vier Meisterwerken: »Alles über meine Mutter« (1999), »Volver« (2006), »Parallele Mütter« (2021) sowie dem nicht ohne autobiografischen Bezug inszenierten »Leid und Herrlichkeit« (2019) über einen Filmregisseur, Salvador Mallo, darin sich ein weiter Bogen spannt von der Kindheit zum Alter, von Partikeln der Wirklichkeit und deren Verwandlung in Kunst, von Krankheit, Schaffenskrisen, Lebensschmerz und Verlust zur Erkenntnis sinnstiftend bereichernder Erfahrung.
Ausgezeichnet mit 14 internationalen Preisen
Entlang dieser existentiellen Situationen und Bruchlinien führt auch »Alles über meine Mutter« parallel zum Hin und Her zwischen Madrid und Barcelona. Almodóvars mit 14 internationalen Preisen ausgezeichneter, vielleicht sein komplexester und motivisch verschachteltster Film ist zugleich Hommage an Joseph L. Mankiewicz’ »All about Eve« und John Cassavetes’ »Opening Night« mit seinen Darstellerinnen Bette Davis und Gene Rowlands sowie an Romy Schneider. Die in der Organspende-Abteilung arbeitende Krankenschwester Manuela (Cecilia Roth) sieht mit an, wie ihr Sohn Esteban an seinem 17. Geburtstag durch einen Autounfall stirbt, als er sich ein Autogramm der Schauspielerin Huma Rojo (Marisa Paredes) holen will. Beide hatten sie zuvor in Tennessee Williams’ »Endstation Sehnsucht« als Blanche Du Bois auf der Bühne gesehen. Manuela verlässt Madrid, um in Barcelona Estebans Vater von dem Unglück zu unterrichten, der sein Geschlecht angeglichen hat, nun als Lola lebt, aber erotische Freibeuternatur geblieben ist und als drogensüchtiger HIV-Infizierter auch die junge Maria Rosa (Penélope Cruz) angesteckt hat. Manuela findet zu Mut und Stärke zurück, indem sie für andere da ist und sie rettet: die lebensuntüchtige Huma, die schwangere, bei der Geburt sterbende Maria Rosa und deren neugeborenen Sohn, den sie ebenfalls von Lola bekommen hat. Der Tod hält reiche Ernte in diesem Film, an dessen Ende das Ja zum Leben als frohe Botschaft und irdischer Segen steht. Almodóvars Produktionsfirma heißt »El Deseo« – Begehrensunruhe ist der Impuls seines Werks.