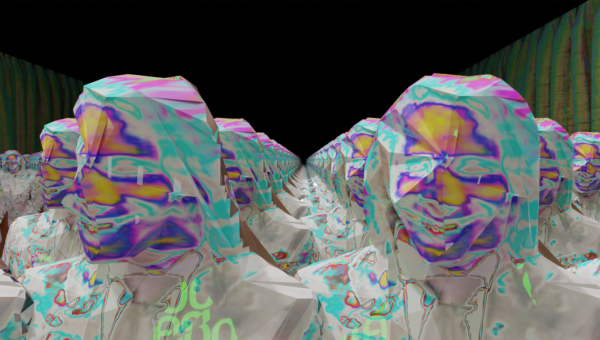»Alles muss sich ändern, damit alles beim Alten bleibt.« Aus dem Satz seines geschmeidigen Neffen Tancredi, den er ebenso bewundert und beneidet wie verachtet, hört Don Fabrizio Corbera, Fürst von Salina, eine ihn melancholisch stimmende Lebenswahrheit heraus. Dieser »Gattopardo« mit der mächtigen Pranke, ein Monument an Statur und Charakter, ist Repräsentant und Relikt des abgesetzten bourbonischen Systems auf Sizilien und schaut aus skeptischem Abstand, wie es seiner Natur entspricht, auf die Zeit: das Risorgimento, die Revolution von 1860, Garibaldi, Vittorio Emanuele II. und das sich vereinigende Königreich Italien.
Seine Neigung zur Astronomie lässt ihn die Dinge von höherer Warte betrachten. Als Weltmann hat er für die Bigotterie der Kirche, den Verfall des Adels wie für die ordinäre Gewinngier der sich etablierenden Bourgeoisie nur Spott übrig und als Familienoberhaupt für seine ihm lebensuntauglich scheinenden, blutleeren Söhne und Töchter illusionslose Wehmut. Dass er die Ehe zwischen dem verwegenen Glücksritter Tancredi (Alain Delon), und der schönen, vor Erotik und Ehrgeiz vibrierenden Angelica (Claudia Cardinale), Tochter des Profiteurs Don Calogero Sedara, selbst stiftet, zeigt seine Resignation, aber auch seine Einsicht, dass die Zeit der Löwen, Leoparden und Adler vorüber und die Epoche der Schafe, Hyänen und Schakale angebrochen sei.
Burt Lancaster war 50 Jahre alt, als er die Rolle des Salina spielt, dem er Würde, Noblesse, Autorität und sinnliche Leidenschaft mitgibt, die er für Visconti ein Jahrzehnt danach noch einmal aufbringen wird als abgeschieden lebender Professor in dem Trauer- und Kammerspiel »Gewalt und Leidenschaft«. Die aristokratische Aura hat nichts von Dünkel, sondern ist vollendeter Stil und Ethos. Aber Salina ist blind für die Idee des Volkes, das Proletariat der Zukunft, die der hochadlige Kommunist Visconti in seiner Zeit begrüßt und deren Fehlentwicklung er ebenso schmerzvoll erkannt hat.
Giuseppe Tomasi di Lampedusas Epochen-Roman bietet den idealen Stoff für Luchino Visconti, diesen »Beschwörer des Imperfekts« (Thomas Mann). Seine dreistündige Adaption von 1963 ist ein rares Beispiel dafür, dass ein Film sich neben der literarischen Vorlage gleichrangig behauptet. Betörendes Tableaux eines Bilderkinos, minutiöses Gesellschaftspanorama, psychologisches Menschentheater. Ein epischer Film, der zu atmen scheint, der prunkvoll und zeremoniös und zugleich karg und einfach ist wie Siziliens Landschaft in ihrer archaischen Dauer. »Der Leopard« zeigt, wie es ausgesehen haben würde, hätte Visconti seine Absicht verwirklicht, Prousts »Recherche« zu verfilmen.
Die Reise vom Stadtpalast zur Sommerresidenz Donnafugata und der Aufenthalt in dem riesigen Schloss, das Dorf, Land und Kirche beherrscht, die Avancen der neuen Regierung in Rom, ihn zum Senator zu machen, der Ball beim Fürsten Ponteleone in Palermo, all seine Begegnungen – der Fürst betrachtet sie wie ein Sternenreisender, versonnen, verwundert, befremdet. Im Morgengrauen geht er durch schmutzige Straßen, kniet nieder, als er auf einen Priester mit den Sterbesakramenten trifft, hört Schüsse eines Erschießungskommandos. In Lampedusas Roman stirbt der Fürst. Viscontis historisch-allegorischer Schwanengesang verlässt ihn als lebenden Toten, dem die Welt abhanden gekommen ist. Asche zu Asche, Staub zu Staub.