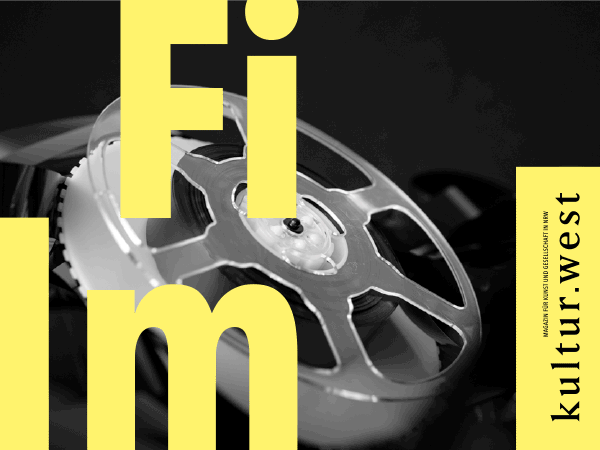Eigentlich sei alles eher Zufall gewesen, sagt Anja Blacha heute. Mit ihrer Schwester war sie 2013 nach Peru gereist, um den Machu Picchu (2430 Meter) zu besteigen. Doch das war ihr »Schlüsselerlebnis«. 2015 machte sich die Bielefelderin zu ihrer ersten Expedition auf – zum höchsten Berg Südamerikas, dem Aconcagua in Argentinien (6962 Meter). Danach kamen der Kilimandscharo in Tansania (5895 Meter), der Mont Blanc in Frankreich (4810 Meter), der Denali in Alaska (6190 Meter) und die Carstensz Pyramide (4884 Meter) in Indonesien. Alle »Seven Summits«, die höchsten Berge aller Kontinente, in knapp drei Jahren.
Frau Blacha, Sie haben erst vor wenigen Jahren mit dem Bergsteigen angefangen. Wie schwer war das?
BLACHA: Ich habe in vielen Bereichen Glück. Beim Extrembergsteigen geht es um drei Faktoren. Um mentale Stärke, die bringe ich mit. Ich komme halt aus Westfalen, da sind die Menschen ein wenig sturer. Wenn sie sich etwas vornehmen, dann ziehen sie es auch durch (lacht). Das zweite ist die Fitness. Die ist gar nicht so extrem, denn es geht um keine Fitness, für die man jeden Tag trainieren muss – das habe ich auch gar nicht. Ich war immer irgendwie sportlich aktiv, bin geritten und habe gefochten. Man braucht eine gewisse Grundausdauer, eine Grundstärke in den Beinen. Aber wenn man zu viele Muskeln hat, verbrennt man auch viel Sauerstoff auf der Höhe, das schlaucht. Ein Bodybuilder würde sich da viel schwerer tun als ich. Wenn man sehr groß ist, hat man einen anderen Körperschwerpunkt als ich mit 1,67 Metern. Außerdem ist es von Vorteil, wenn man nicht allzu schwer ist.

Wie haben Sie sich auf die Touren vorbereitet?
BLACHA: Jede Bergtour ist schon die Vorbereitung auf die nächste. Ich habe versucht, Dinge in meinem Alltag zu integrieren. Vor dem Aufstieg auf den Denali bin ich zum Beispiel mit Fußgelenkgewichten herumgelaufen, zum Einkaufen, zur Arbeit. Zwei Kilo links, zwei Kilo rechts.
Es heißt, das Wichtigste beim Bergsteigen sei der Kopf. Stimmt das?
BLACHA: Absolut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es für sich selber tut. Bei der Everest-Truppe waren zwei Teammitglieder aus den Niederlanden dabei. Beider waren Väter. Der eine wollte seinen Söhnen ein Vorbild sein – alle in der Familie haben mitgefiebert. Der andere hat nur daran gedacht, was ihm alles zustoßen könnte und wie es wäre, wenn seine Tochter ohne Vater aufwachsen müsste. Das hat ihn extrem blockiert.
Tatsächlich haben Sie beim Aufstieg einige verunglückte Bergsteiger gesehen. Wie geht man damit um?
BLACHA: Das ist schwierig, man sieht die Leichen nur am Gipfeltag, denn auf der Strecke davor können sie noch geborgen werden – nur auf dem letzten Stück eben nicht. Beim letzten Abschnitt hatten wir eine sternklare Nacht, es war windstill. Das war echt ein Friedhofsgefühl. Und ein Mahnmal an das eigene Bewusstsein. Umso erschreckender war auch, dass eine Person, die ich am Gipfeltag überholt habe, auf dem Rückweg tot am Wegesrand lag.

Wie behält man da die Nerven?
BLACHA: Man muss vorsichtig sein, achtsam, aber nicht ängstlich. Ich habe mit jedem Schritt versucht, mich nie auf die Seile zu verlassen. Lieber langsamer gehen als schnell. Ein Fehltritt reicht. Das war für mich wie im Turniermodus beim Fechten. Vielleicht springt da bei mir so eine Art Leistungsmodus an, in dem ich weiß: Ok, jetzt gilt’s.
Aber so ein Turniermodus ist nicht dauerhaft auszuhalten. Die Expedition hat 50 Tage gedauert.
BLACHA: Ja, im Turniermodus waren wir eigentlich nur am Gipfeltag. Man verbringt vorher verdammt viel Zeit damit, im Basislager zu sitzen, zu essen und zu trinken und sich auszuruhen, weil man auf der Höhe sich ganz, ganz schnell verausgabt, aber nicht wieder regeneriert. Deswegen verbringt man viel Zeit mit Leerlauf und Warten auf das richtige Wetter.
Wie haben Sie sich in dieser Zeit beschäftigt?
BLACHA: Man redet und liest viel. Vor allem in der Anfangszeit macht man viele Akklimatisierungs-Hikes, bei denen man auf nahgelegene Hügel läuft. Gerade in der Schlussphase ist man viel damit beschäftigt zu klären, wer wann mitgeht und wie sich das Wetter entwickelt. Man ist da die ganze Zeit in einer angespannten Wartehaltung.
Wie ist das Gefühl, dass Bergführer und Sherpas einen begleiten – und unter Umständen auch ihr Leben riskieren?
BLACHA: Unserem Bergführer hat die Höhe so zugesetzt, dass er auf 7700 Metern umdrehen musste. Die Sherpas sind nicht einfach nur Höhenträger, sondern die Superstars am Berg. Unsere Sherpa-Truppe wusste sehr genau, welche Risiken sie eingehen. Unser Lead-Sherpa war zum 17. Mal auf dem Mount Everest, das war für ihn Routine.
Macht es einen Unterschied, als Frau solch eine Besteigung geschafft zu haben?
BLACHA: Der Vorteil ist, dass wir Frauen vor so einer Sache wohl eher zu Understatement neigen und das ist in dem Fall einer Bergbesteigung gar nicht mal so schlecht.
Sie arbeiten als Teamleiterin in der Telekommunikationsbranche. Wie vereinbart man all diese Bergtouren mit einem festen Job?
BLACHA: Es ging bei mir viel durch den Good Will in der Firma, aber auch durch meine Einsatzbereitschaft: Ich habe natürlich sonst keine langen Urlaube mehr gemacht. Und mich gefragt, wie ich meinem Arbeitgeber etwas zurückgeben kann. Ich arbeite zum Beispiel wegen der Schulferien, an die meine Kollegen gebunden sind, im Sommer durch.
Gibt es etwas, das Sie beim Bergsteigen gelernt haben und das Ihnen heute in Ihrem Beruf hilft?
BLACHA: Auf der persönlichen Ebene definitiv. Schließlich gibt es auch bei uns Situationen, in denen man für andere einspringen muss. Dass Kollegen versuchen, alles zu geben, aber im Privatleben Hürden haben. In solchen Situationen stellt sich die Frage, wie man ihnen helfen kann, dass sie trotzdem erfolgreich sind. Das ist durchaus vergleichbar mit einer Situation am Mount Everest: Auch da gab es ein Teammitglied, dass große emotionale Lasten mit sich herumgeschleppt hat, da mussten wir uns auch fragen, wie gehen wir darauf ein, wie schafft man es, trotzdem als Team weiterzukommen.