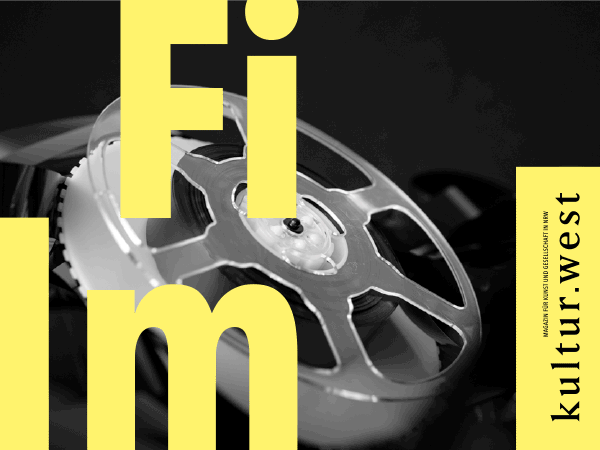PROTOKOLL: KATRIN PINETZKI
»Als ich ein Kind war, gab es noch richtige Grenzen. Wir sind an fast jedem langen Wochenende von der Ostschweiz, wo wir lebten, über Österreich nach Südtirol gefahren, wo meine Eltern herkamen. Bei der Wiedereinreise wurde oft das Auto auf den Kopf gestellt und kontrolliert, ob man eine Salami aus Italien dabei hatte. Wenn ich an dieses Mädchen zurückdenke, dann waren geografische Grenzen gar kein Thema, es war normal, sie zu überwinden. Vielleicht hat mir das von vornherein einen etwas weiteren Blick gegeben.
An unserer Wohnungstür hatte einmal jemand ›Tschingg‹ geschmiert, das Schimpfwort der Schweizer für Italiener. Dass ich anders war als die Mitschüler, erkannte ich früh, aber daraus entwickelte sich gleichzeitig Selbstbewusstsein. Ich war ein intelligentes, pfiffiges Mädchen und wusste früh, dass ich Medizin studieren und raus in die Welt will.
Auf mein Lebensthema stieß ich durch meine Familie. Meine Mutter erzählte mir sehr viel über den Krieg. Sie erlebte die Angst vieler Kriegskinder. Als junges Mädchen hütete sie Gänse auf dem Feld, dann kam der Tiefflieger. Sie wusste nie, ob sie den Tag überleben würde. Meine Großmutter erzählte mir von Vergewaltigungen in Südtiroler Dörfern. Ich war in den Ferien bei ihr, auf unseren Spaziergängen kam sie ins Reden. All das hat mich natürlich berührt, und ich konnte es mit 13, 14 Jahren nicht verarbeiten. Gleichzeitig wuchs da eine Kraft.
DEN DRECK GEBEN WIR MONIKA
Nach Studium und Dissertation war klar: Hier bin ich, und ich will was in der Welt verändern, zum Besseren für Frauen! Die Gynäkologie habe ich bewusst gewählt, Frauenschicksale haben mich sehr berührt. Ich hatte während meiner Fachärztin-Ausbildung in Essen mit vergewaltigen Frauen zu tun, mit drogenabhängigen Frauen, mit Frauen nach Totgeburten. Ich habe mir das nicht unbedingt gesucht, aber ich habe es angenommen. Die Kollegen sagten, ›den Dreck geben wir zu Monika‹. Und mit ›Dreck‹ meinten sie HIV-positive, schwangere Frauen. Ich dachte mir, gut, dass sie bei mir landen, weil ich sie mit Respekt behandle.
Einer meiner Chefs hat mir gewisse Freiräume gelassen, die ich sofort genutzt habe. Zusammen mit einer Psychologin haben wir in der Klinik ein interdisziplinäres Konzept entwickelt, das bei medica mondiale heute immer noch tragend ist. Wir hatten eine ganzheitliche Sicht und haben nicht nur gynäkologische Symptome gesehen, haben uns mit Drogenberatung und anderen Organisationen vernetzt. Es war ein Modellprojekt, ohne dass wir es so beantragt oder konzipiert hatten. Wir haben es einfach gemacht. Ich bekomme heute noch manchmal Briefe von Frauen, die sich sehr unterstützt gefühlt haben.
VON DER KLINK NACH BOSNIEN
Die Arbeit war enervierend und grenzenlos. Ich habe mich zu 150 Prozent gegeben und wenig geschützt. Self Care – das gab es damals nicht. Die Patientinnen riefen mich auch an, wenn ich keinen Dienst hatte. Es hat niemand gesehen, welche hohe Qualität meine Arbeit hatte. Das hat mich frustriert. Zutiefst. Andererseits stieß ich in der Klinik immer wieder an Grenzen, weil ich die Dinge nur unzureichend verändern konnte. Da wurde mir klar, mein Wirkungskreis kann nirgends sein, wo ich so abhängig bin von fremden Strukturen. Nach vier Jahren, im Sommer 1992, kündigte ich. Ich überlegte, nach Nicaragua zu gehen, um dort in einer Klinik zu arbeiten.
Doch im November erschien im Stern ein Artikel über Massenvergewaltigungen im Bosnienkrieg. Die Kriegserzählungen meiner Mutter und die Gewaltgeschichten meiner Großmutter – beides kulminierte in dem Moment. Ich wusste nicht wirklich, worauf ich mich einließ, als ich Ende 1992 zum ersten Mal nach Bosnien fuhr. Ich kannte weder die politischen Komplexitäten im auseinanderbrechenden Jugoslawien, noch wusste ich, welche medizinischen Einrichtungen ich vorfinde, wusste weder, was ›schwer traumatisiert‹ bedeutet, noch, wie man eine Initiative aufbaut, PR macht, Spenden sammelt.
Das Jahr 1993 wurde dann das intensivste Jahr meines Lebens, und das wird es immer bleiben. Ich habe noch lange danach im Rhythmus des Jahres 1993 gelebt, das Jahr hat sich quasi biologisch eingeschrieben. Im Januar: erste Gespräche in Zenica, die Suche nach geeigneten Räumen. Es wurde ein ehemaliger Kindergarten. Februar: Zurück nach Essen, Inventar zusammensuchen für die Klinik: vom Ultraschall über Pinzetten und Computer …
Lesen Sie weiter in der gedruckten Ausgabe von K.WEST!
»medica mondiale« unterstützt traumatisierte Frauen inzwischen auch im Kosovo, in Albanien, Afghanistan und in Westafrika nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: Später werden die Projekte von lokalen Partnerinnen weitergeführt. Für ihren herausragenden humanitären Einsatz wurde Monika Hauser im November mit dem Staatspreis NRW ausgezeichnet. 2008 wurde sie bereits mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt. Zwölf Jahre zuvor hatte sie das Bundesverdienstkreuz abgelehnt, aus Protest gegen die ihrer Ansicht nach zu frühen Rückführung der Flüchtlinge durch die Bundesregierung. Heute ist Hauser geschäftsführendes Vorstandsmitglied von medica mondiale mit Sitz in Köln.