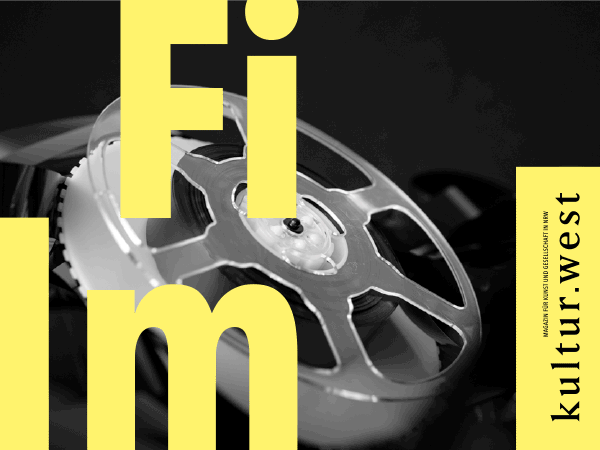TEXT: MARTIN KUHNA
Krupp im Ruhrmuseum, das passt. Zumal es einen kalendarischen Aufhänger gibt: das zweihundertjährige Bestehen der legendären Firma. Allerdings wurde die schon im November 1811 gegründet, doch wäre man pünktlich gewesen, hätten wichtige Exponate aus der vorangegangenen Foto-Schau auf Villa Hügel nicht zur Verfügung gestanden – sagt Heinrich Theodor Grütter, der neue Ruhrmuseums-Chef. Und die Verlegung um ganze vier Monate, nah ans Geburtsdatum Alfred Krupps (26. April 1812), führt überdies mitten hinein ins Thema Mythos. Denn schon der Firmen-Titan produzierte Legenden-Nebel um die Gründung seines Betriebs.
In drei parallel verlaufenden Gassen mit Querverbindungen kann man sich nun im Ruhrmuseum drei grundlegende Teil-Mythen der Krupp-Geschichte erwandern. In der Mitte geht es um die Familie, um die auf unterschiedliche Weise starken und absonderlichen und meist unglücklichen Männer und ihre starken Frauen. Links geht es um die Produkte des Unternehmens, um den epochemachenden und wiederum sagenumwitterten Werkstoff Stahl. Rechts wird das Phänomen der »Kruppianer« beleuchtet, der bevormundeten, umsorgten, stolzen Werksangehörigen. Schon am Eingang wird die Ambivalenz des Firmenmythos gezeigt: links Postkarten, mit denen die Stadt Essen sich selbst geradezu obszön als »Kanonenstadt« feiert und Krupp als Wohltäter; links Karikaturen und Pamphlete, die blutige Kriegstreiberei und Sozialschwindel geißeln.
Zu Beginn der Familien-Geschichte macht die Ausstellung sehr deutlich, dass die Krupps in Essen seit langer Zeit arriviert und bestens vernetzt waren, als Friedrich Krupp sich mit ererbtem Geld daran machte, das Geheimnis des Gussstahlverfahrens aufzuspüren. Und dieses Geld, da nimmt Ausstellungsmacher Grütter kein Blatt vor den Mund, hatte der »Hasardeur« schlicht vertan, als er am Ende seines Lebens hochverschuldet samt Familie in das berühmte Aufseherhäuschen seiner Fabrik zog, die zu jenem Zeitpunkt nicht mehr als eine kriselnde »Klitsche« mit sieben Mitarbeitern war. Dass der Tüftler in ökonomischer Hinsicht völlig versagte, mag man im Krupp-Archiv noch heute nicht gern aussprechen. Seinem Sohn Alfred war es so peinlich, dass er die Erinnerung daran mit einem eigenen Gründungsmythos überdeckte und den Vater, so Grütter, bei Rückblicken »mit keinem Wort erwähnte«.
Leicht könnte man am Eingang der Ausstellung eine Art Stele übersehen, dicklich, rostig, kaum mannshoch. Sie ist ein Beweis für die Wirkmacht der Bilder, die Alfred Krupp selbst von seinem Unternehmen entwarf. Weithin bekannt ist die Geschichte, wie er seit 1851 Weltausstellungen nutzte, um mit immer größeren Stahlblöcken auf seine Firma aufmerksam zu machen. Legendär ist die Anekdote, wie 1855 in Paris solch ein Klotz durch den hölzernen Hallenboden brach – gern zitiert als eine der ersten, wenngleich wohl zufällig entstandenen PR-Aktionen überhaupt. Wer heute von diesen – im übrigen zweckfreien – Stahlblöcken liest, denkt wohl unweigerlich an Giganten. Tatsächlich sind sie historische Scheinriesen, nach heutigen Maßstäben eher klein, so wie die »Stele« in der Ausstellung.
Ein ähnliches Erlebnis wenige Meter weiter: Dort steht eine Stahlkanone, wie sie Preußendeutschland zum Sieg über Dänemark und Frankreich verhalf. Klein, grazil, harmlos wirkend auf ihrer hochrädrigen Lafette. Man ist überrascht, weil man Bilder im Kopf hat von der »Dicken Berta« und von Krupp-Geschützen der folgenden Jahre: monströse Apparate, deren phallische Imponiergeste nur mühsam vor Durchhängern bewahrt wurde. Von Heer und Krupp gemeinsam ersonnen, waren sie militärisch überflüssig – Beispiele dafür, wie der Mythos ins Sinnleere laufen konnte. Eine solche Waffe hat das Ruhrmuseum nicht zu bieten, wohl aber ein Projektil des 42-Zentimeter-Mörsers »Dicke Berta«. Was dem Feind mit tödlicher Wucht auf die Köpfe fiel, sieht nun wieder erstaunlich banal aus; ein Eindruck, der durch die pop-orange Färbung noch verstärkt wird.
Parallel zur Kanonenseligkeit hypertrophierte der Gründungsmythos. Die pompöse Hundertjahrfeier fand keineswegs aus praktischen Gründen mit Verspätung statt, sondern verwob das Gründungsdatum ungeniert mit dem Geburtstag des Firmenhelden Alfred Krupp: »1812–1912«. Friedrich Krupp war praktisch zur Unperson geworden. Eine Feier der Superlative beschwor die »Werksgemeinschaft« und brachte womöglich erstmals das Wort von den »Kruppianern« ins Spiel. Sie sollte in einem Besuch des kaiserlichen Hausfreunds Wilhelm II. gipfeln. Doch die geplanten Ritterspiele fielen aus, weil der Kaiser nach Bochum eilte, wo tags zuvor bei einer Explosion auf der Zeche Lothringen 112 Bergleute gestorben waren. Da ist, merkt Theo Grütter an, die Inszenierung einer idyllischen Werkgemeinschaft an der brutalen Realität der damaligen Arbeitswelt gescheitert.
Eine so weit gehende Legendenpflege hat es nach 1918 nicht mehr gegeben. Zwar bediente die Feier des 125-jährigen Jubiläums noch einmal den Mythos der »Waffenschmiede des Reiches«, doch bezog sie auch den Firmengründer ein, wie jetzt im Ruhrmuseum zu sehen ist: Friedrich Krupp, der Besessene und glücklose Kapitalist, figurierte als »Der ewige Deutsche«; offensichtlich ein Rückgriff auf Richard Wagners »Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun«. 150 Jahre Krupp wurde dann ganz korrekt im November 1961 gefeiert. Zugleich aber wurde eine Replik des im Krieg zerstörten Aufseherhäuschens gebaut, das seit Alfred Krupps Zeiten als »Stammhaus« gefeiert wird, was die erfolglose Vorgeschichte doch wieder ausblendet. Die Haltung zum Gründer blieb ambivalent.
Alfreds Sohn Friedrich Alfred erscheint im Ruhrmuseum als der »unterschätzte Krupp«. Er sei keineswegs bloß ein schwächlicher Studierstubentyp gewesen, der am Ende auf Capri in homoerotische Schwärmereien flüchtete. Unter seiner Leitung sei das Unternehmen erst zur Weltfirma gewachsen. Und Friedrich Alfreds Neigung zur Naturwissenschaft sei dabei keineswegs hinderlich gewesen, sagt Theo Grütter – eher im Gegenteil. Was sein Großvater bei der geheimnisvollen Stahlherstellung noch alchimistisch betrieb, stellte Friedrich Alfred auf eine wissenschaftliche Grundlage. Selbst seine berühmte, später ans Ruhr(land)museum gelangte naturkundliche Sammlung wurde instrumentalisiert: Die Ausstellung zeigt ein Meteoriten-Stück, das bei Krupp analysiert wurde – und beschossen, auf der Suche nach besseren Panzerungen gegen die eigenen Waffen.
Meriten attestiert die Ausstellung sogar Gustav von Bohlen und Halbach, eingeheirateter Krupp und bevorzugte Hassfigur aller Krupp-Kritiker. Sicher, er hat Konzentration auf Waffen und Verquickung mit Machtpolitik auf die Spitze getrieben, und am Ende hat er sich mit den Nazis eingelassen, wenn auch keineswegs so eifrig wie andere Industrielle. Aber 1919 habe er das Unternehmen gerettet, sagt Grütter. Die Ausstellung zeigt, auf wie vielen Feldern sich die abgerüstete Firma neu zu erfinden versuchte: mit Lokomotiven, Lastwagen, Motorrollern, Registrierkassen, Zahnersatz. 40 Jahre später sollte die Gemischtwaren-Strategie zum Problem werden. Aber 1919 habe Gustav Krupp sich damit gegen Direktoren durchgesetzt, die das Unternehmen aufgeben wollten, sagt der Ausstellungsmacher. Auch dieser erste Wiederaufstieg habe zum Mythos beigetragen.
Der Vorstellung, dass ein tyrannischer Gustav seiner Familie das Leben zur Hölle gemacht hätte, setzt die Ausstellung Bilder entgegen. Von den Krupps gesammelte Kunst, die nach Aufgabe der Villa Hügel als Wohnsitz in alle Welt verstreut wurden und jetzt erstmals nach Essen zurückkehren. Privat gedrehte Filme, die von Bohlen und Halbachs in entspannten Momenten zeigen – nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und insofern doch ein kleines Korrektiv gegen Klischees. Wie sehr das Leben der seltsamen Krupps unvermeidlich Stoff für »großes Kino« ist, wird zum Ende der Familiengeschichte besonders deutlich, bei Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und seinem Sohn Arndt.
Man weiß, dass Alfried ein verschlossener, melancholischer Mann war. Man weiß, dass Arndt die Tradition der unglücklichen Krupp-Männer als traurige Farce ausklingen ließ. Aber es ist etwas anderes, wenn man nun sieht, wie besessen der letzte Firmeninhaber seine riesige Schallplatten-Sammlung in langen Nächten archivierte, in einem sinnlosen Versuch, sich die Welt zu ordnen. Wenn man sieht, wie der abgefundene Playboy Arndt trotz ewiger Geldnöte zumindest die kruppsche Rolle des Mäzens beibehalten wollte. Wie er in weit geschwungener Schrift eben doch mit jenem Namen unterzeichnete, auf den er nach seinem angeblich freiwilligen Erbverzicht kein Anrecht hatte: Arndt Krupp von Bohlen und Halbach.
Im Blick auf die »Kruppianer« zeigt die Ausstellung, wie sehr dieser Teilmythos trotz Fort-existenz einer Firma namens »ThyssenKrupp« Vergangenheit ist. Man wird zwar daran erinnert, dass die Welt der Werkswohnungen, Werkschöre, Werksbibliotheken, der Jubilar-Uhren, der kruppschen »Konsum«-Geschäfte zeitlich noch gar nicht so weit entfernt ist: Plastik-Einkaufstüten mit dem K-Logo gab es in Essen noch bis in die 70er Jahre! Doch vor dem Hintergrund heutiger Arbeitsverhältnisse – »flexibel«, temporär, prekär – wirkt das Konzept der fürsorglichen Firmenbindung wie von einem anderen Stern.
Natürlich figuriert auch ein Mann in der Ausstellung, der in widersprüchlichen Rollen Teil des Mythos ist: Einerseits nassforscher Liquidator des fürsorglichen, ineffizienten kruppschen Gemischtwarenladens. Andererseits Vertrauter Alfried Krupps und Gralshüter seines Vermächtnisses. Maßgeblich daran beteiligt, mit Geschick, mit Chuzpe und Fortüne, wie das Unternehmen Krupp durch Krisen, Häutungen und Fusionen gelenkt wurde. Berthold Beitz hat dafür gesorgt, dass das Krupp-Archiv gut die Hälfte der 1500 gezeigten Exponate beisteuert. Museumsdirektor Grütter lobt die enge Kooperation trotz notwendiger professioneller Distanz. Man ahnt, dass das nicht leicht war. Und dass die Geschichte von Krupp und vom Krupp-Mythos, sine ira et studio, noch nicht zu Ende erzählt ist.
200 Jahre Krupp. Ein Mythos wird besichtigt, 31. März bis 4. Nov. 2012. Tel.: 0201/24681 444. www.ruhrmuseum.de