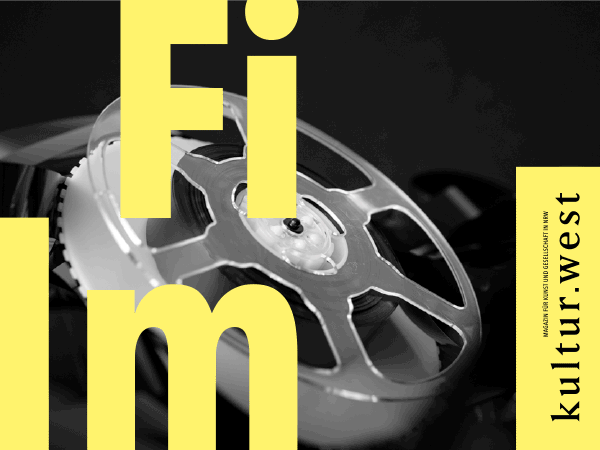TEXT: CHRISTOPH VRATZ
Richard Strauss hätte sich vermutlich zweifelnd an den Kopf gefasst, hätte er gesehen, wie diese Zwei dirigieren. Strauss war mit seinen Bewegungen am Pult geradezu ein Geizhals. Yannick Nézet-Séguin und Andris Nelsons sind das Gegenteil. Sparsamkeit, Zurücknahme oder scheinbare Selbstkontrolle ist ihnen fremd. Sie schleudern ihre Arme in die Luft, gestikulieren wild im Sog der Musik, reißen bei Fortissimo-Stellen den Mund weit auf. Hasardeure am Pult. Energieträger.
Ähnlich vehement sind auch ihre Karrieren verlaufen. Nelsons, 1978 in eine lettische Musikerfamilie hineingeboren, begann als Sänger und an der Trompete, ging aufs Petersburger Konservatorium, Russlands Renommier-Institut. Anschließend saß er mit seinem Instrument einige Jahre im Orchester der Nationaloper von Riga. Doch Nelsons hatte da bereits erste Dirigier-Kurse genommen, darunter bei Neeme Järvi und Jorma Panula, dem Talent-Entdecker und -Förderer schlechthin: Saraste, Salonen, Vänskä sind durch eine Orchesterleiter-Schule gegangen.
2003 wechselte Nelsons dann die Seiten und übernahm 24-jährig den Posten des Chefdirigenten der Rigaer Oper. Die frühe Bindung zur Oper hat ihn geprägt. Für ihn sind »alle Werke dramatisch – nicht programmatisch natürlich, aber es gibt immer eine Reise durch bestimmte Emotionen«. Erste Konzert-Engagements folgten rasch, bereits 2008 kürte ihn das City of Birmingham Symphony Orchestra zum neuen musikalischen Leiter. Nach einer kurzen Akustikprobe und einer CD-Aufnahme mit Tschaikowskys Violinkonzert war den Engländern ruckzuck klar: der oder keiner. Im letzten Jahr gastierte Nelsons erstmals in Bayreuth, um den umjubelten »Lohengrin«, inszeniert von Hans Neuenfels, zu dirigieren.
Nézet-Séguin wirkt – obwohl kleiner und gedrungener – sportlicher, drahtiger. Kurzhaarschnitt, Athleten-Arme. Unter seinen T-Shirts, die er auch im Konzert unterm Jackett trägt, schimmert ein Kettchen durch. Unkonventionell im strengen Klassik-Geschäft. Seine Karriere hatte ebenfalls Rasanz. Der 1975 geborene Nézet-Séguin, also drei Jahre älter als Nelsons, ist Franco-Kanadier mit einem bretonischen Großvater. Er studierte Klavier, Komposition und Dirigieren am Conservatoire de musique du Québec. Anfangs hat er ausschließlich Chöre dirigiert, was seine Vorliebe für chorsinfonisches Repertoire erklärt. Im Jahr 2000 wurde er Chef beim Orchestré Métropolitain du Grand Montréal. Nur ein paar Gastauftritte genügten, um dieselbe Position sechs Jahre später beim Philharmonischen Orchester von Rotterdam einzunehmen, als Nachfolger von Valery Gergiev. 2007 ernannte ihn das London Philharmonic zum Ersten Gastdirigenten. Was verbindet beide Orchester miteinander? »Wenn ich mehr Ausdrucksintensität fordere, explodieren sie geradezu«, sagt er. Dasselbe gilt für den Dirigenten selbst.
2008 kam Nézet-Séguin nach Salzburg und dirigierte Gounods »Roméo et Juliette« mit Rolando Villazón: auswendig. Die Partitur blieb unbenutzt. Seit 2010 ist der Überflieger designierter Musikdirektor in Philadelphia, einem der Big Five-Orchester in den Staaten. Im nächsten Jahr wird die Position offiziell.
Ob sich die beiden Musiker etwas zu sagen hätten? Vermutlich. Man muss bloß ihre Vorlieben betrachten. Richard Strauss steht bei ihnen obenan, dessen »Heldenleben« haben sie binnen eines Jahres mit ihren Orchestern in Birmingham und Rotterdam aufgenommen. Unterschiede gibt es dabei nur im Detail, was wohl weniger an ihren Dirigentenpersönlichkeiten liegt, als am Komponisten, der seine Partitur mit minutiösen Anweisungen versah. Nézet-Séguin erweist sich bei der Gestaltung der Tempi eigenwilliger, gönnt sich größere Freiheiten, begreift das Werk mehr als spätromantische Ballade. Nelsons’ Ansatz wirkt eine Spur analytischer. Beide eint das Bemühen, das Orchester transparent klingen zu lassen – und auch ihr Pathos. Die Sinfonische Dichtung wird zur Bekenntnismusik.
Die Mittdreißiger fühlen sich in der Romantik und ihren Ausläufern offenbar besonders wohl, Nelsons mehr bei Mahler, Nézet-Séguin mehr bei Bruckner und den Franzosen von Berlioz und Bizet bis zu Ravel und Debussy. Nelsons ist eher bei Tschaikowsky zuhause; kein Wunder, hat er doch fast zehn Jahre lang bei Mariss Jansons Privatstunden genommen. Auch der ein musikalischer Emphatiker, der die Linie der russisch geprägten Dirigenten fortsetzt und die Tradition an Auserwählte wie Nelsons weitergibt.
Nézet-Séguin nahm noch Privatstunden beim Grandseigneur Carlo Maria Giulini, der freilich gesagt habe, dass man Dirigieren eigentlich nicht unterrichten könne. Von dem Italiener rührt womöglich seine Bruckner-Liebe. Nézet-Séguin würde sich zwar nicht als Autodidakt bezeichnen, doch gehöre zum Dirigieren mehr als nur Handwerk: »Wissen über Psychologie und die Entstehungsgeschichte eines Werkes«.
Mit den autokratischen Dirigentenbildern ihrer Vorgänger-Generation haben beide nichts gemein. Sie verstehen sich als Teamplayer, die – wie man hören kann – zu motivieren wissen. Sie wirken so, als hätten sie ihre Kunst nie übereilt vorangetrieben – eben das mag sie so schnell vorangebracht haben. Beide wissen auch, dass man nach mehr als einem Jahrhundert Tonaufzeichnung nicht jedes Stück anlegen kann, als sei es noch nie gehört worden. »Wir alle, Dirigenten, Regisseure, Sänger neigen dazu, zu viel von unserem Ego in die Interpretation zu legen«, sagt Nelsons.
Was ist nun mit ihrem am Pult ähnlich leidenschaftlichen Stil, trotz ganz unterschiedlicher Herkunft? Oder registriert dieses Temperament nur ein deutsches Publikum? Nelsons hat einmal gemahnt, in der deutschen Musik sei die Selbstbeobachtung stark ausgeprägt. Nicht nur in der Musik: »Wenn ein Russe wütend ist, würde er einen Tisch nehmen und gegen die Tür werfen. Der Deutsche würde vorher über die Folgen seiner Handlung nachdenken.«
Konzert des Rotterdam Philharmonic Orchestra und Yannick Nézet-Séguin mit Mozart und Bruckner am 1. Okt., Konzert des WDR Sinfonieorchesters Köln unter Andris Nelsons mit Puccini, Ravel, Beethoven am 16. Okt. 2011; www.konzerthaus-dortmund.de