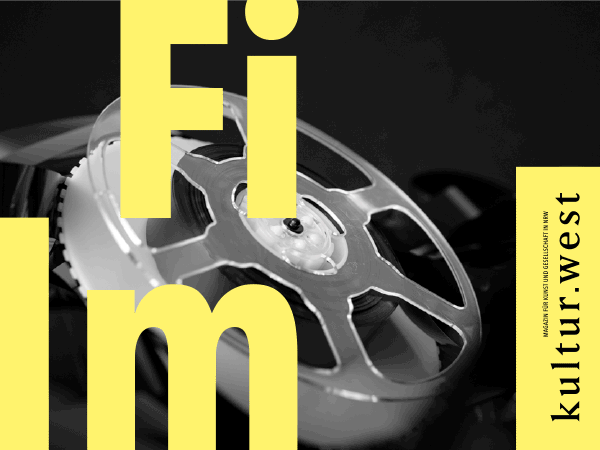TEXT: CHRISTOPH VRATZ
Wer ihn nicht kennt, könnte ihn für wirr halten. Die Haare stehen in alle Richtungen ab, die Hände fuchteln, die Augen funkeln wie wild. Doch Christian Gerhaher entstammt keiner Erzählung von E.T.A. Hoffmann, auch wenn seine Biografie den Verdacht nähren könnte. Nach dem Abitur entschied sich der 1969 in Straubing Geborene für ein Medizin-Studium in München und Rom. In der knappen Freizeit fand er jedoch zunehmend Gefallen am Gesang. Gerhaher professionalisierte seine Passion, und zwei Tage nach dem dritten Staatsexamen unterschrieb er am Staatstheater Würzburg sein erstes Engagement – nicht als Betriebsarzt, sondern als Bariton.
Bereits zwei Jahre später gab Gerhaher alle vertraglichen Bindungen auf und ist seither freischaffend tätig. Der Seiteneinstieg ermöglicht ihm bis heute eine willkommene Außenperspektive. Was er sagt, wirkt mitunter kühn. Etwa: »Es ist völlig in Ordnung, dass Platten einen nicht mehr zum Großverdiener machen. Man muss sich auf der Bühne beweisen.« Die These lässt im sehr marktorientierten Musik-Geschäft aufhorchen. Ego-Dünkel erteilt er eine Absage. »Eitelkeit gibt es natürlich bei Musikern, aber sinnvollerweise nur als Existenz erhaltende Triebkraft.«
Wenn man Gerhaher auf der Bühne erlebt, im Konzert oder in der Oper, klingt seine hell timbrierte Baritonstimme nicht sonderlich raumfüllend. Keine Posaune, keine Daseinsorgel. Dafür ungemein prägnant, direkt. Tragfähig ohne viel Dazutun. Das liegt auch an der phänomenalen Sprachgestaltung. Nicht nur, dass man jedes Wort versteht. Bei Gerhaher ist jede Silbe Bedeutungsträger, nicht wie beim späten Fischer-Dieskau, der zum Doktor Didaktikus werden konnte, indem er überbetonte. Bei Gerhaher hingegen verschmelzen Wort und Text zur Sinn-Allianz.
Auch mit Gerold Huber, seinem Klavierpartner, bildet er inzwischen eine feste Einheit. Kuriosum am Rande: Hubers Vater war es, der einst Gerhaher als Geigenlehrer unterrichtete und sein Stimmpotenzial entdeckte. Sie seien mittlerweile wie Brüder, »wir verstehen uns blind und kommen viel schneller auf den Punkt, an dem es interessant wird«. Kürzlich sollten Gerhaher und Huber für ein Fernsehporträt eine Probe simulieren. Da habe er gemerkt, »dass wir fast nur aufeinander hören und nur wenig sprechen. Es lässt sich auch kaum herausdestillieren, welche Ideen von ihm, welche von mir wären. Es ist wie ein gemeinsamer Organismus.«
Doch Gerhaher klebt nicht am Hergebrachten, immer wieder testet er die Zusammenarbeit mit anderen Pianisten, wie kürzlich in Salzburg, als er mit András Schiff auftrat. Auf dem Programm: die selten zu hörende Klavierfassung von Mahlers »Lied von der Erde«. In Mahlers Welten hat Gerhaher sich tief vergraben, in der Region zwischen Kunst- und Volkslied, subtiler Ironie und offener Bitterkeit, Weltleiden und himmlischer Hoffnung eine Art künstlerischer Heimat gefunden. »Mahlers Liedtexte kennt jeder ein bisschen aus der eigenen Kindheit. Wie Märchen werden Volkslieder einem von klein auf mitgegeben, mehr als man gemeinhin annimmt. Diese Saite wird zum Schwingen gebracht, sobald die Texte erklingen.«
Gerhaher bewundert Mahler dafür, dass er nie Gefahr lief, in den Kitsch abzudriften. Zumal er düstere Inhalte vertont hat: Krieg, Tod, Hinrichtung, Abschied und Verlust. Daneben die sogenannten Humoresken, »die sich in der Kombination mit den schweren Themen jedoch eher als Fratzen oder Grotesken darstellen«.
Mahlers Musik wirkt unmittelbar. Das bedeutet zugleich, zu den Gefühls-Inhalten als Interpret intellektuelle Distanz wahren zu müssen. »Mahlers bizarre Farben, seine unverhofften formale Brüche und gleichzeitig der Versuch, die schäbige äußere Welt mit dem Mensch-Sein in Einklang zu bringen, kann man nicht nur rein emotional vermitteln.« Das mag einer der Gründe sein, weshalb Gerhaher den Klavierversionen der Mahler-Lieder oft den Vorzug gibt: »Viele Vorteile, die das Klavier bietet, können vom Orchester nicht erreicht werden. Allein die Übergänge sind so kleinteilig, dass es mit siebzig Leuten kaum möglich ist. Außerdem hat der Sänger viel mehr Möglichkeiten, seine Gestaltung auf stimmliche Farben zu konzentrieren. Schließlich kann man beim Klavier dynamisch weiter zurückgehen.«
Ob Mahler, Wolf, Schumann oder Schubert – Christian Gerhaher hat eine klare Vorstellung von den Werken und ihren Schöpfern. Schuberts »Winterreise« sieht er, was die zyklische Struktur betrifft, kritisch. Er möge zwar »die einzelnen Bilder der Dichtung«, doch das Gesamtbild biete »nicht annähernd eine solche Innenschau wie die ›Schöne Müllerin‹«. Den Winterreisenden hält er »für einen karrieristischen, opportunistischen Querulanten, der mit dem Tod nichts am Hut hat, mit Selbstmord schon gar nicht.«
Während das Lied Gerhaher vertraut ist, hat er sich die Oper seinem frühen Erst-Engagement zum Trotz erst langsam erschlossen. Beginnend mit Mozart, Papageno und Guglielmo, dazu Operettiges von Johann Strauß. Zaghaft erweiterte er das Repertoire: Wolfram im »Tannhäuser«, Prinz von Homburg, Orfeo von Monteverdi und demnächst Pelléas und – oh Wunder – Marquis Posa in Verdis »Don Carlo«. Gerhaher gibt zu, dass ihm das noch fremd sei: »ein anderes Idiom, die Konsonanten dienen viel stärker als Element des Dramatischen, haben größeres expressives Gewicht«.
Gerhaher ist wählerisch mit seinen Opern-Auftritten, auch weil daheim in München die Familie mit drei Kindern wartet. »Doch wenn man dann mal zuhause ist, lassen sich die kurzen Phasen nicht automatisch in pures Glück verwandeln.«
Konzert mit Christian Gerhaher und dem Finnish Radio Symphony Orchestra unter Sakari Oramo beim Beethovenfest am 9. Okt. 2011 u..a. mit Liedern aus Gustav Mahlers »Des Knaben Wunderhorn«. www.beethovenfest.de