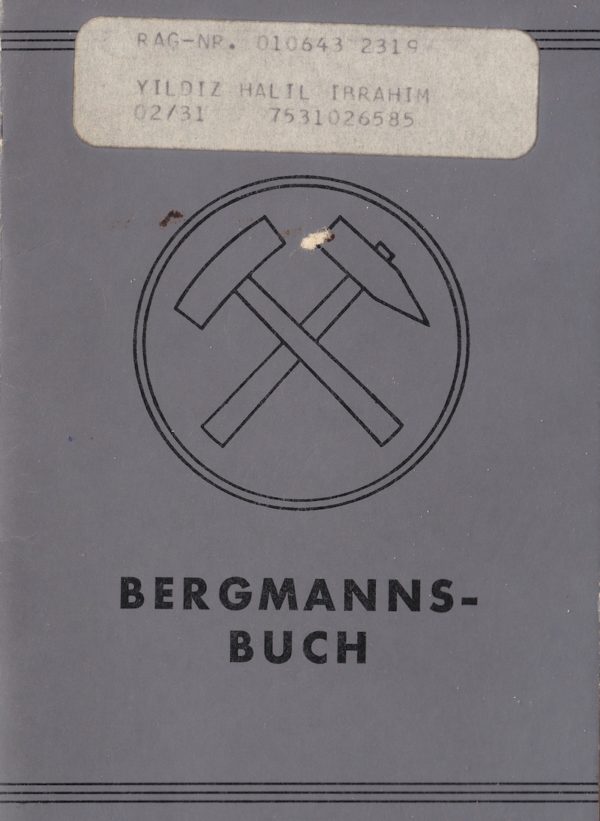INTERVIEW: ULRICH DEUTER
K.WEST: Auf welche politisch-historische Situation traf das Anwerbeabkommen mit der Türkei?
OHLIGER: Es war die Zeit der wachsenden Arbeitsmigration, die Hochphase des Wiederaufbaus, die Zeit des deutschen »Wirtschaftswunders«. Es herrschte – teils kriegsbedingt – starker Arbeitskräftemangel. Ganze Jahrgänge von Männern waren »ausgedünnt«. Die Frauen im Westen wurden systematisch aus dem Arbeitsmarkt verdrängt. Nach dem Mauerbau 1961 versiegte auch der Zustrom von Arbeitskräften aus der DDR. Ein großer Bedarf der Industrie an vor allem unqualifizierten Arbeitskräften hier, ein Angebot von genau solchen Personengruppen dort – vorrangig in den Ländern Südeuropas.
K.WEST: Welches Interesse hatte die Türkei an dem Abkommen?
OHLIGER: Tatsächlich ging die Initiative von der Türkei aus. Deren Interesse war dreifacher Natur. Zum einen wollte sie überschüssige Arbeitskräfte »exportieren«, Menschen, die sonst aus dem ländlichen Anatolien nach Ankara, Istanbul oder Izmir zugewandert wären. Zum anderen erhoffte man sich politisch und ökonomisch eine engere Anbindung an Europa. Und drittens rechnete man mit einem Rückfluss von Kapital ins Heimatland durch Geldtransfers der Migranten. Der Mythos der Migration war ja: Wir arbeiten ein Jahr, kehren dann zurück und machen einen kleinen Gewerbebetrieb auf. Passiert ist dann etwas Anderes. Der Aufenthalt verstetigte sich in vielen Fällen. Die »Gastarbeiter« überwiesen jahrelang Geld in die Herkunftsregionen und trugen so zur Entwicklung der Wirtschaft in der Türkei bei.
K.WEST: Welche Rolle spielte damals, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs, die Überlegung, die Türkei enger an den Westen zu binden?
OHLIGER: Eine spannende Frage. Ich habe jedoch bisher noch nichts zu einem solchen Deal gelesen: »Ihr nehmt unsere überschüssigen Arbeitskräfte auf, wir lassen eure Panzer, Truppen und Raketenabschussrampen rein«. Allerdings wären entsprechende Dokumente der NATO oder des amerikanischen State Departement sicher noch unter Verschluss. Die Türkei war ja außerdem 1961 schon seit elf Jahren Mitglied der NATO.
K.WEST: War damals im öffentlichen Bewusstsein, dass mit den Türken zum ersten Mal Menschen aus einem muslimischen Land nach Deutschland kamen?
OHLIGER: Nein. Das ist eine viel spätere Debatte. Für die Deutschen war die Türkei damals kein vorwiegend muslimisches Land, sondern eher ein irgendwie orientalisches Entwicklungsland. Die »Waffenbrüderschaft« zwischen dem Kaiserreich und dem Osmanischen Reich wurde noch erinnert. Die Arbeitsmigranten, die in den 60er Jahren kamen, waren meist nicht durch religiöse Symbole erkennbar. Das Kopftuch spielte keine bedeutende Rolle. Junge Frauen aus der Türkei passten sich z.B. durchaus der westlichen Mode mit Minirock an. Die Türkei der 60er Jahre war ja kein Gottesstaat, sondern ein dezidiert säkularer Staat in der laizistischen Tradition Atatürks.
K.WEST: Manche sagen, die Wahrnehmung des Muslimischen an den Muslimen begann mit der Wiedervereinigung. Auf einmal fingen die Deutschen an, sich wieder mit sich selbst zu beschäftigen.
OHLIGER: Das ist eine interessante Beobachtung. Dazu gibt es z. B. Forschungen, die diese These stützen. Bis 1989/90 entwickelte sich eine zwar manchmal holperige, aber dennoch zunehmende Einbeziehung der Migranten in die westdeutsche Gesellschaft. Ab 1990 wurde ein anderes Leitmotiv dominant. Das Nationale, vor 1989 nahezu ein Tabu, war wieder da. Es ging mit stärkerer Abgrenzung gegenüber dem Fremden einher. Man könnte es zugespitzt so formulieren: Die Folge der Einbeziehung der fremden Ostdeutschen in das vereinigte Deutschland war die stärkere Ausgrenzung der anderen Anderen. Es gibt aber nicht nur den einen Faktor, sondern mehrere. Um 1989/90 entstand auch eine neue Migrationswelt. Die Grenzen waren offen, es kam zu massiver Zuwanderung von Asylbewerbern und Aussiedlern. Verteilungskonflikte auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt entstanden. Dazu gab es eine entsprechende, meist dunkel tönende Begleitmusik in den Medien. Dies führte unter Migranten teils zu einem Rückzug in die eigene Community. Für Migranten aus der Türkei war dieser leichter als für andere, da sie zu der Zeit bereits über eine gut entwickelte eigene Infrastruktur verfügten: Vereine, Moscheen, Banken, Gewerbebetriebe usw. Was in der Migrationsforschung »ethnische Kolonie« heißt, existierte bereits.
K.WEST: Eigentlich war es von der Politik anders geplant: Der Anwerbestopp von 1973 sollte solche »Koloniebildung« eigentlich verhindern.
OHLIGER: Der Anwerbestopp erzwang aber eine Entscheidung: bleiben oder gehen. Wer ging, hatte meist keine Rückkehroption mehr, also blieben viele, und zwar auf Dauer. Der politischen Klasse war offenbar nicht klar, dass der Anwerbestopp die definitive Entscheidung bedeutete, Einwanderungsland zu werden, da jene, die nun dauerhaft blieben, darüber hinaus die Basis für neue Einwanderung über Familienzusammenführung bildeten. Ein schönes Beispiel für einen nicht intendierten Effekt intentionalen Handelns.
K.WEST: In der Geschichte der türkischen Migration gibt es zwei weitere Eckdaten: Solingen und 9/11 …
OHLIGER: Der Mordanschlag von Solingen 1993 bedeutete einen von mehreren entscheidenden Wendepunkten. Er löste bei vielen Angehörigen der türkischen Community Angst und Misstrauen gegenüber den Deutschen aus. Ein anderer solcher Punkt war die Kampagne gegen die doppelte Staatsangehörigkeit, die Roland Koch 1999 im hessischen Wahlkampf lostrat, nicht gerade ein Willkommenssignal. Zuletzt kamen die Anschläge von New York als global wirkendes Ereignis hinzu. Damit setzte die Auseinandersetzung um den politischen Islam ein. In Deutschland leben wir dennoch in einem vergleichsweise beschaulichen Zustand – verglichen mit den Niederlanden, Dänemark, Österreich oder Frankreich, wo das Thema Einwanderung vor allem durch in Wahlen erfolgreiche rechtspopulistische Parteien viel stärker politisiert ist.
K.WEST: Seit dem 11. September 2001 steht die türkische Community unter Dauerbeobachtung …
OHLIGER: … und unter Generalverdacht der Integrationsverweigerung. Eine wichtige Entwicklung ist sicher, dass der Islam als Religion in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren politisiert wurde. Dies wirkt auf die christlich-atheistisch-säkulare Mehrheitsgesellschaft oft fremd und bedrohlich. In der heutigen Wahrnehmung ist der typische Migrant jung, männlich und Muslim oder weiblich und trägt Kopftuch. In beiden Formen gelten er oder sie der Mehrheitsgesellschaft als bedrohlich. De facto bilden die Russlanddeutschen und die Einwanderer aus der Türkei annähernd gleich große Gruppen. Erstere finden jedoch diskursiv nicht statt. Erst mit dem Heranwachsen einer sogenannten zweiten und dritten Generation mit mehr Bildung und Sprachmacht entsteht auch die Chance für einen Imagewandel und einen Dialog auf Augenhöhe. Dieser Wandel wird sich in den nächsten Jahrzehnten rapide vollziehen. Zum 100. Jahrestag des Anwerbeabkommens im Jahr 2061 werden Ihre Fragen und meine Antworten von heute dann wohl sehr verstaubt klingen. Der lange Weg in die neue Heimat wird dann beendet sein.
Rainer Ohliger ist Vorstandsmitglied des »Netzwerk Migration in Europa«, einer NGO, die an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis zu Fragen der Migration und Integration arbeitet.
»Tausendundeine Nachtschichten«
ist das Motto der 7. »deutsch-türkischen Buchmesse Ruhr«, die vom 14. bis 23. Oktober im Glaspavillon der Universität Essen sowie an anderen Orten stattfindet. In mehr als drei Dutzend Veranstaltungen (Lesungen, Diskussionen, Film- und Theateraufführungen, Musik) will die Messe beweisen, dass aus der Türkei nicht nur Arbeitskräfte und Döner-Buden importiert werden, sondern auch Bücher und andere Varianten der Kultur. Diesjähriger Ehrengast ist der Schriftsteller Aras Ören; zu Lesungen und Diskussionen kommen u.a. Emine Sevgi Özdamar, Zafer Senocak sowie Feridun Zaimoglu mit seinem Ruhrgebietsroman »Ruß«. (Komplettes Programm unter www.buchmesse-ruhr.de)