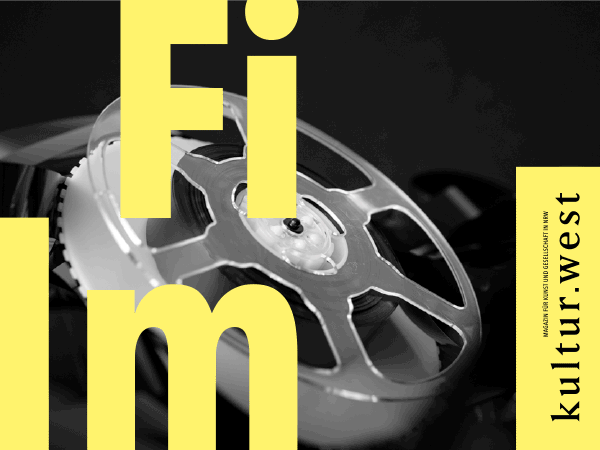// Im 20. Jahrhundert kam die Geschichte aufs Bild. Waren es zuvor eher Person, Tat, Ereignis gewesen, so wurden es jetzt Foto und Filmsequenz, in denen das Chaos des immerfort Geschehenden Halt fand, »Geschichte« wurde. »Bilder im Kopf« nennt sich eine Bonner Ausstellung, die einige solcher »Ikonen der Zeitgeschichte« von unserem inneren Leuchttisch herunternimmt, vor Augen stellt und in ihren Zusammenhang rückt. Um zu zeigen, dass das kollektive Gedächtnis sich aus solchen Bildern speist, ja dass es durch solche gemeinsam gesehenen Bilder erst kollektiv wird.
Wann aber wird ein Bild zum Metabild? Wann und wodurch gewinnt es einen Status, der es repräsentativ für ein gesamtes komplexes Geschehen eintreten lässt? Der ihm die Widerhaken verleiht, sich im Gedächtnis der meisten Menschen dauerhaft anzusiedeln? Zehn deutsche Geschichts-Ikonen rückt die Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte in den Mittelpunkt, um darum herum verschiedene Prozesse und Strategien des Ikone-Werdens anzuordnen: Bilder aus Nazi-Zeit und Krieg; aus den Anfangsjahren von BRD und DDR; vom Mauerbau und von ’68; von 9/11.
Bilder von Krisen- und Umbruchszeiten allesamt, das fällt auf. Erklärt sich aber auch durch den Umstand, dass in Zeiten von Wirrnis und schneller Veränderung das Bedürfnis nach Klarheit, sei es durch Parole oder Bild, naturgemäß groß ist. Anlass der Ausstellung ist der 60. Gründungstag der BRD und der 20. der Wiedervereinigung; die jüngere Geschichte Deutschlands aber ist nicht nur eine der Krise, sondern auch eine der Stabilität. Und so muss eingewendet werden, dass für das Selbstverständnis der heute lebenden Bundesbürger noch ganz andere Ikonen prägend sind als die in Bonn herausgehobenen: nicht nur der anfliegende »Rosinenbomber« während der Berlin-Blockade 1948, sondern auch der Boccia spielende Adenauer, der zigarrerauchende Erhard, der Atompilz; nicht nur der sterbende Benno Ohnesorg, sondern auch der auf dem Mond tanzende Astronaut; nicht nur der Kniefall Willy Brandts, sondern auch die Turnschuhe des Ministers Fischer oder die leere Autobahn während der Ölkrise 1973. Ganz zu schweigen von Bildern der Unterhaltungsindustrie und der Werbung, die bis heute Selbstverständnis und Verhalten der Menschen beeinflussen und ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit strukturieren.
In Bonn aber ging es offenbar um die »ernste« Geschichte politischer Ikonografie, und die fängt dort beim »Händedruck von Potsdam« zwischen Hitler und Hindenburg an. Das entsprechende Kapitel der Ausstellung beschreibt die Bilderzeugung und Bildverbreitung durch die nationalsozialistische Propagandamaschinerie, die in ihrer riefenstählernen Perfektion Maßstäbe setzte, und zeichnet den Aufstieg jener eher beiläufigen Handschlagszene von 1934 zum Kulminationsbild deutscher Geschichte nach – mit dem überraschenden Befund, dieser Status sei so recht erst nach der Nazizeit erreicht worden, als Sinnbild der Unterstützung Hitlers durch die alten Eliten. Mag sein, dass hier Illustration und Ikone verwechselt werden; der kollektive Bilderschatz hütet den »Händedruck von Potsdam« ganz sicher nicht.
Ähnliches gilt für die beiden Fotos des verängstigten kleinen Jungen mit den erhobenen Armen im Warschauer Ghetto und des sozialistischen Aktivisten Adolf Hennecke, die ebenfalls im Mittelpunkt der Ausstellung stehen; sie sind bekannte Bilder (Hennecke sicher nur für Menschen mit DDR-Biografie), aber befinden sich auf keinem ikonografischen Altar. Und der symbolische Handschlag zwischen KPD-Pieck und SPD-Grotewohl auf dem Gründungsparteitag der SED 1946 hat nur als Logo auf Flaggen und Anstecknadeln diese herausgehobene Position erreicht.
Ganz anders bei den »Bildern in der Mediengesellschaft«, wie dieser Teil der Ausstellung sich nennt. Auch die mögen manchmal gestellt oder manipuliert sein, aber ihre Verbreitung und damit ihre Nobilitierung zum Kultbild muss sich durchsetzen – nicht zuletzt gegen mächtige Konkurrenz. Was zur Folge hat: Was es geschafft hat, wirkt nachhaltig. Ein Überlebender in diesem Bilderstreit ist gewiss der Soldat, der während des Mauerbaus in Berlin über den Stacheldraht nach Westen springt; warum aber gerade dieses Foto in den Himmel der Heiligenbilder der Historie fuhr, kann auch die Ausstellung nicht ganz erklären. Vielleicht war es der Umstand, dass Fotograf Peter Leibing das Drama in der Sekunde seiner Peripetie erfasst hat, nämlich den Sprung genau auf dem Scheitelpunkt zwischen Drüben und Hüben. Und dass der 19-jährige Conrad Schumann, Oberwachtmeister der kasernierten Bereitschaftspolizei der DDR, mit seiner ganzen Körperhaltung Freiheitswille und Hoffnung ausdrückt.
Eine andere zweifelsfreie Ikone der Zeitgeschichte hat jüngst wieder neue Aktualität gewonnen: Das Bild vom sterbenden Benno Ohnesorg. Hier liegt der Grund für die Apotheose auf der Hand: Es ist das Motiv der Pietà, ein Zentralstück der kollektiven Heraldik, das sich in diesem Foto aktualisiert hat. Ähnlich beim Kniefall Willy Brandts vor dem Ehrenmal des Warschauer Ghettos 1970 in Polen: Die Welt konnte diese Überführung eines protokollarischen Zeremoniells in eine sakrale Handlung von Buße und Reue ernst- und annehmen, eben weil der von den Nazis vertriebene Brandt das andere, anständige Deutschland verkörperte.
Eine dritte Großikone – Referenzbild der Ausstellung, unauslöschlicher Bestandteil der Bilder im Kopf – ist das Konterfei des von der RAF gefangenen Hanns Martin Schleyer. Dieses Foto zerstörte die Ordnung der Welt. Nämlich die, welche, parallel zur Teilung der Welt in Ost- und Westblock, die deutsche Gesellschaft in fortschrittlich und reaktionär sortierte. Wer damals nicht auf Franz Josef Strauß’ Seite und der der Springerpresse stand, konnte automatisch nicht gegen die DDR sein und ignorierte sich diesen furchtbaren Staat schön. Konnte auch nicht für Schleyer sein. Nun blickte einen dieser Mann, Protagonist des »Establishments«, ehemaliger SS-Angehöriger, müde, verstört, verängstigt an. Darüber hinaus sandte das Bild eine Irritation aus, die man – ich – erst einige Zeit später begriff. Schleyer trägt ein Schild vor der Brust: »Gefangener der RAF«. Dieses Schild riss das Höllentor zu anderen »Ikonen« auf: den Bildern der von den Nazis durch die Straßen getriebenen, mit Schandschildern behängten Juden. Spätestens mit diesem Bild also hatte die RAF bewiesen, dass sie nicht angetreten war, um die Väter- und Tätergeneration zu bekämpfen, sondern um deren Werk fortzuführen. Ab diesem Bild war einfach links sein nicht mehr möglich.
Die jüngste der in Bonn gezeigten Ikonen ist der Einschlag der Flugzeuge in die Twin Towers am 11. September 2001. »Aus heiterem Himmel« sei der Angriff erfolgt, schreibt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler im Katalog. Die Doppeldeutigkeit des Ausdrucks erhellt, warum sich dieses Bild in all seinen Varianten so tief in unser Gedächtnis eingegraben hat, denn der blaue Himmel über New York bildet die Folie einer sicheren Ordnung, vor der die schwarzen Qualmwolken und das Zerbrechen der klaren, geometrischen Hochhauskörper die höchste Symbolik der Bedrohung entfalten können. Der Turm des hybriden Babylon, der von Gott geschleift wird; das Golgatha des Schuttbergs mit aufragendem Stahlskelett, als der Staub sich verzogen hat – das sind die Konnotationen unseres Bildunterbewussten, die mitschwingen. Während das Jetzt und die Distanz, die das Fernsehen herstellt, die urmenschliche Empfindung der »Süße« ermöglicht, angesichts des Unglücks anderer zu genießen, »von welcher Bedrängnis man frei ist«, wie es bei Lukrez heißt. //
Bis 11. Oktober 2009. Tel.: 02 28/ 91 65-0. http://www.hdg.de